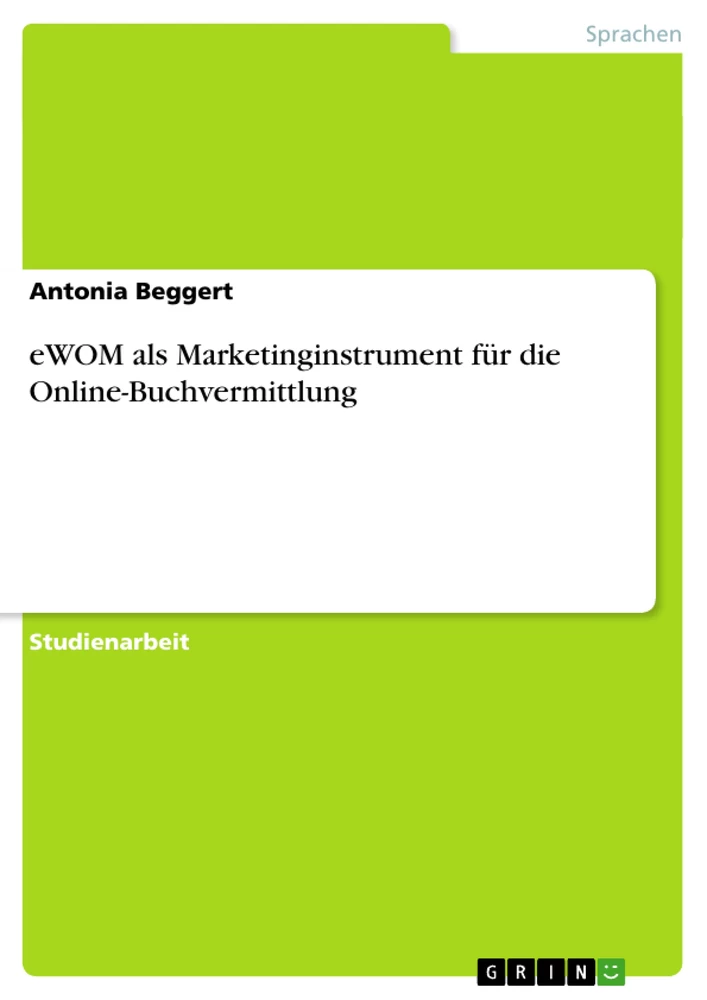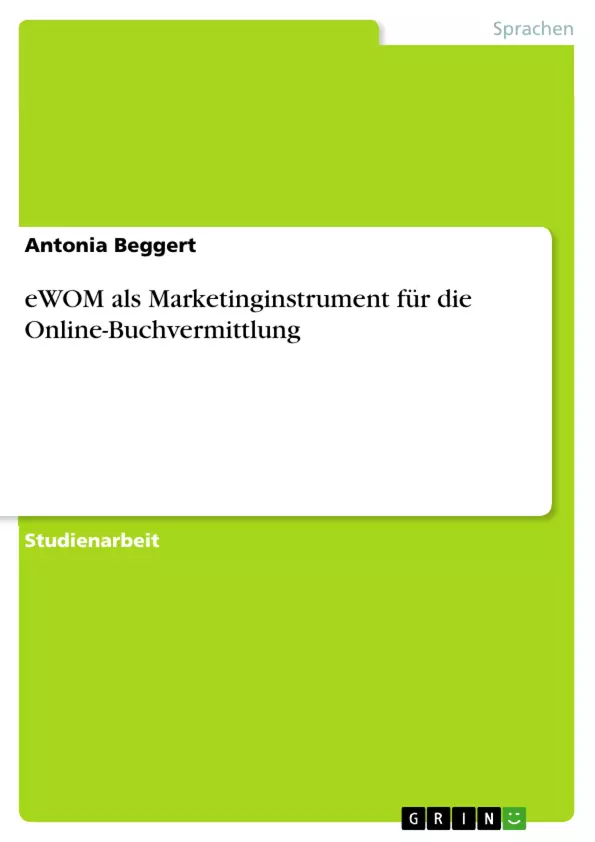Die Vermittlung von Büchern wird traditionsgemäß über Feuilletons oder Literaturzeitschriften betrieben. Mit der zunehmenden Verbreitung des Internet und der Entstehung des Web 2.0, dem so genanntem „Mitmachnetz“, bekommt die Buchvermittlung eine neue Dimension. Bücher können online auf verschiedene Weise vermittelt und rezensiert werden, sodass Konsumenten Informationen, die sie bislang aus Zeitschrift und Zeitung bekommen haben, durch das Internet erhalten und sich für Verlage ein neues Feld der Marketingkommunikation eröffnet. Konsumenten informieren sich über Produkte im Internet – gezielt mit Hilfe von Suchmaschinen und in Sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter oder interessenbezogenen Netzwerken. In diesem Zusammenhang nutzen sie Empfehlungen anderer Nutzer als Informationsquelle, entsprechend der früheren „Mund-zu-Mund-Propaganda“. Dieses Prinzip des „Word Of Mouth“ wurde durch die interaktiven Möglichkeiten von Nutzern in Netzwerken zum Prinzip des „electronic Word Of Mouth“. Inwiefern „electronic Word Of Mouth“ in der Online-Buchvermittlung eine Rolle spielt, gilt es zu untersuchen.
Inhaltsverzeichnis
- Buchvermittlung im Internet: kommunikationswissenschaftliche Grundlagen
- Kommunikationsmodell nach Shannon & Weaver
- Virales Marketing
- eWOM/virales Marketing
- eWOM und soziale Netzwerke
- Wirkung der Weiterempfehlung auf den Empfänger
- Case Study: Lovelybooks
- Funktionen bei Lovelybooks
- Buchvermittlung und eWOM bei Lovelybooks?
- Möglichkeit der optimalen Nutzung von eWOM im Web 2.0
- Literaturverzeichnis
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle von elektronischem Word of Mouth (eWOM) als Marketinginstrument für die Online-Buchvermittlung.
- Die Bedeutung von eWOM in der digitalen Buchvermittlung
- Kommunikationsmodelle und -theorien im Kontext von eWOM
- Der Einfluss von eWOM auf Konsumentenverhalten und Kaufentscheidungen
- Die Rolle von sozialen Netzwerken im eWOM-Prozess
- Möglichkeiten zur optimalen Nutzung von eWOM in der Online-Buchvermittlung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Grundlagen der Buchvermittlung im Internet und setzt sie in den Kontext der Kommunikationswissenschaft.
Kapitel zwei erklärt das Kommunikationsmodell von Shannon & Weaver und verdeutlicht seine Relevanz für die Analyse von Online-Kommunikationsprozessen.
Kapitel drei widmet sich dem Thema virales Marketing. Es werden die Konzepte von eWOM und viralem Marketing sowie die Rolle sozialer Netzwerke in diesem Zusammenhang beleuchtet.
Kapitel vier befasst sich mit der Case Study Lovelybooks, einer Online-Community für Buchliebhaber, und analysiert die Bedeutung von eWOM für deren Buchvermittlungsaktivitäten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen elektronisches Word of Mouth (eWOM), Online-Buchvermittlung, virales Marketing, soziale Netzwerke, Kommunikationsmodelle, Konsumentenverhalten und Kaufentscheidungen.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet eWOM im Marketing?
eWOM steht für "electronic Word Of Mouth" und bezeichnet die digitale Weitergabe von Empfehlungen und Rezensionen durch Konsumenten im Internet, ähnlich der klassischen Mundpropaganda.
Welche Rolle spielt eWOM für die Buchbranche?
Früher waren Feuilletons entscheidend. Heute informieren sich Leser vermehrt über Online-Rezensionen und soziale Netzwerke. eWOM beeinflusst die Kaufentscheidung bei Büchern massiv.
Was ist Lovelybooks?
Lovelybooks ist eine Online-Community für Buchliebhaber, die als Case Study dient. Nutzer können dort Bücher bewerten, an Leserunden teilnehmen und Empfehlungen austauschen.
Was ist der Unterschied zwischen eWOM und viralem Marketing?
eWOM ist der Prozess der Nutzerkommunikation. Virales Marketing ist die gezielte Strategie von Unternehmen, diese Kommunikation anzustoßen, damit sich Botschaften wie ein "Virus" verbreiten.
Wie können Verlage eWOM optimal nutzen?
Durch Präsenz in sozialen Netzwerken, die Zusammenarbeit mit Buchbloggern und das Bereitstellen von Rezensionsexemplaren, um authentische Nutzergespräche zu fördern.
- Quote paper
- Antonia Beggert (Author), 2011, eWOM als Marketinginstrument für die Online-Buchvermittlung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/208841