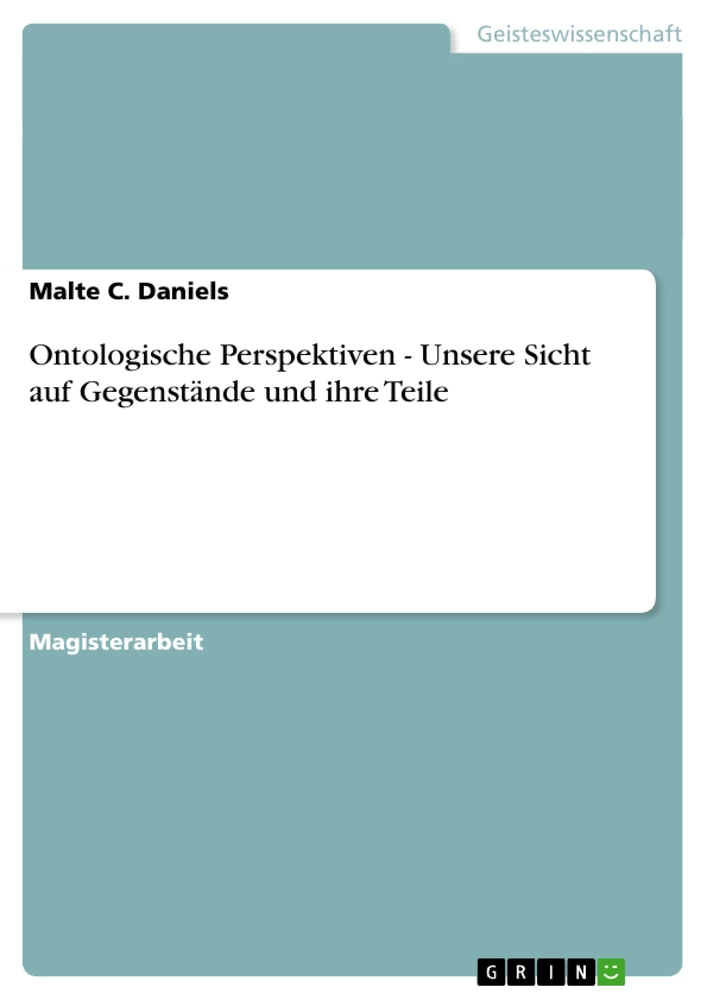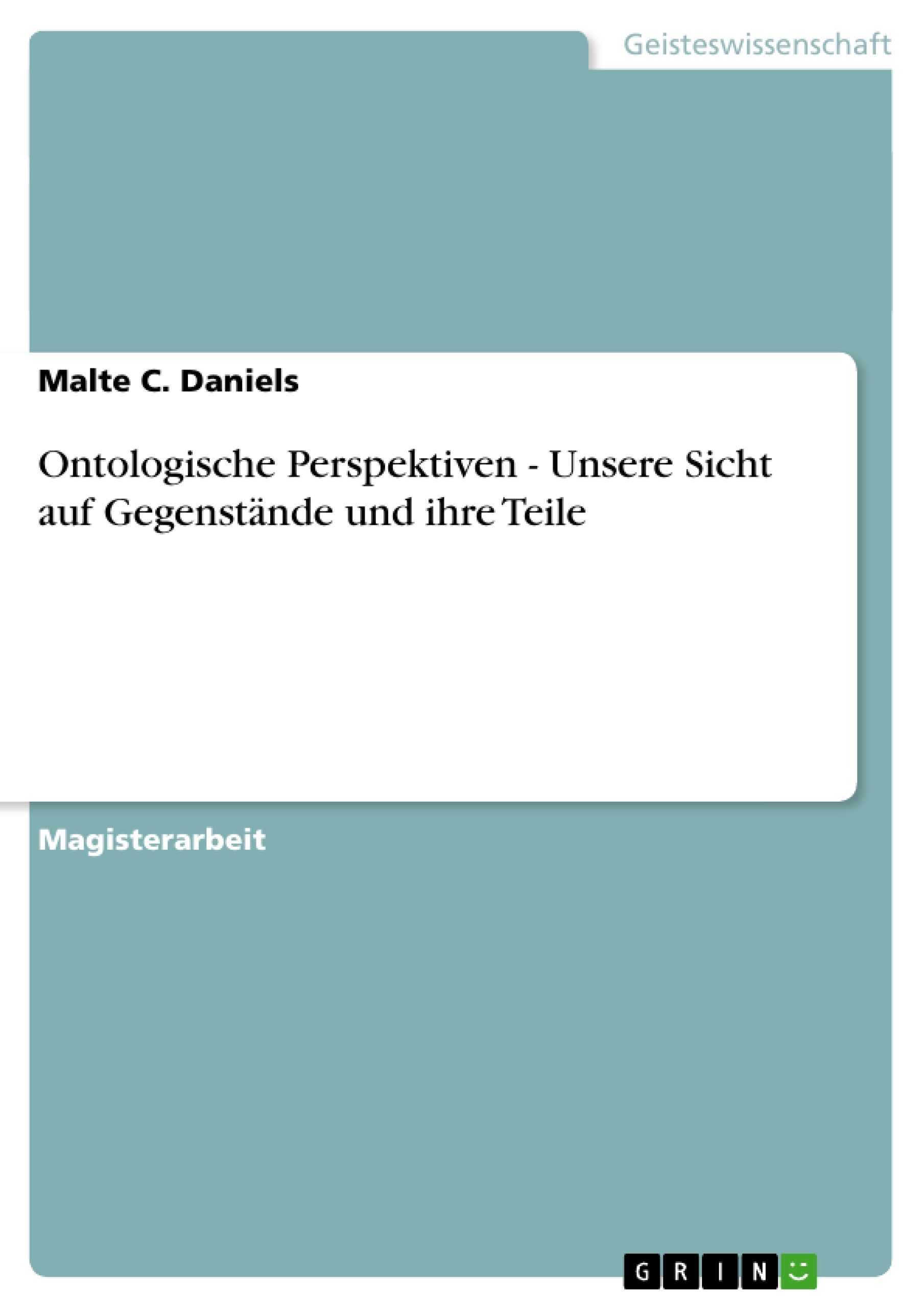[...] Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird der Versuch unternommen, dies für die konkurrierenden
Beschreibungen des Seienden einmal als dreidimensionale Ent itäten und ein
anderes Mal als vierdimensionale Entitäten zu leisten. Dazu werden nach einer generellen
Einführung in die Ontologie und ihre wichtigsten Begriffe sowie nach einer Klärung der
Grenzen dieser Arbeit (Kapitel 1) zunächst die sich scheinbar ausschließenden Beschreibungen
dessen, was ist, zuerst als dreidimensionale Entitäten (Kapitel 2) und danach als vierdimensionale
Entitäten (Kapitel 3) vorgestellt und diskutiert. Hierbei werden im Fall des Dreidimensionalismus
die Probleme der diachronen Identität dargestellt und im Fall des Vierdimensionalismus
die Raum-Zeit Analogie sowie der sich ergebende Objekt– oder Gegenstandsbegriff
problematisiert.
Über die Vorstellung der konkurrierenden Beschreibungen des Seienden hinaus wird es
für eine Kombination derselben notwenig sein, die in letzter Zeit zunehmend an Beachtung
gewinnende Theorie der Ganzen und ihrer Teile, die Mereologie, in ontologisch interessanter
Weise vorzustellen und einige Kritikpunkte an ihr zu formulieren (Kapitel 4).
Nach dieser Bereitung des Feldes, so wie es sich in der Literatur darstellt, wird es mö glich
sein, die hier zunächst nur angekündigte Unterschiedlichkeit der jeweiligen Perspektiven
zu erläutern und die konkurrierenden Beschreibungen dessen, was ist, in einer Beschreibung
zu integrieren (Kapitel 5). Hierbei wird dafür zu argumentieren sein, dass sich durch eine solche
Kombination des Dreidimensionalismus und des Vierdimensionalismus die in den Kapiteln
2, 3 und 4 dargestellten Probleme nicht mehr ergeben, sowie dafür, dass einige ontologische
Probleme einer Lösung zugeführt werden können.
Es ist ersichtlich, dass die eingangs gestellten Fragen nicht oder zumindest nicht in dem
klaren, erwünschten Sinn beantwortet werden. Stattdessen werden Antworten auf folgende
Fragen vorgeschlagen:
1. Wann ist etwas ein Gegenstand? Was macht etwas zu einem Gegenstand?
2. Was heißt es, von einem Ding auszusagen, es ve rändere sich und bliebe doch es selbst?
3. Wie ist das Verhältnis zwischen einem Ganzen und seinen Teilen ontologisch einzuordnen? [...]
Inhaltsverzeichnis
- 0. On what this is
- 1. Ontologie...
- 1.1. Carnaps Metaphysikkritik
- 1.2. Quines ontologische Verpflichtungen..
- 1.3. Strawsons Unterscheidung in deskriptive und revisionäre Metaphysik
- 1.4. Materielle oder physikalische Objekte.
- 2. Die Ontotheorie dreidimensionaler Objekte...........
- 2.1. Diachrone Identität dreidimensionaler Dinge
- 2.2. Kritik des Dreidimensionalismus
- 3. Die Ontotheorie vierdimensionaler Objekte.......
- 3.1. Analogie von Raum und Zeit.
- 3.2. Kritik des Vierdimensionalismus
- 3.2.1. Kritik der Raum-Zeit Analogie
- 3.2.2. Kritik der Objekt- und Gegenstandsauffassung .
- 3.3. Vor- und Nachteile einer Theorie vierdimensionaler Objekte...........
- 4. Mereologie....
- 4.1. Von den Teilen zum Ganzen.....
- 4.1.1. Mereologischer Nihilismus
- 4.1.2. Mereologischer Universalismus
- 4.1.3. Inwagens Kriterien der Zusammensetzung.
- 4.1.3.1 Exkurs: Inwagens material beings
- 4.1.4. Zwischenbilanz..
- 4.2. Komplexe Gegenstände.
- 4.2.1. Chisholms mereologischer Essentialismus ..
- 4.2.2. Konstituenten und Struktur komplexer Gegenstände ...
- 4.2.3. Eigenschaften komplexer Gegenstände….………………………..\n
- 4.3. Diachrone Identität und Veränderung komplexer Gegenstände
- 4.4. Vom Ganzen zu den Teilen....
- 4.5. Resümee
- 5. Ein ontotheoretisches Zwei-Ebenen-Modell....
- 5.1. Veränderung und die Theorie der relevanten Teile.
- 5.2. Konstante Teile und veränderliche Ganze..
- 5.3. Die Vierdimensionalität komplexer Gegenstände.
- 5.4. Vierdimensionale Gegenstandsauffassungen......
- 5.5. Ontologische Abhängigkeit.
- 5.6. Eigenschaften des ontotheoretischen Zwei-Ebenen-Modells..
- 6. On what this was...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit "Ontologische Perspektiven" von Malte C. Daniels befasst sich mit der Frage nach dem Sein und der Struktur der Welt. Ziel der Arbeit ist es, verschiedene ontologische Perspektiven auf Gegenstände und ihre Teile zu untersuchen und ein eigenes Modell zu entwickeln, das den Herausforderungen einer dynamischen Welt gerecht wird.
- Die Kritik der traditionellen Metaphysik
- Die Ontotheorie dreidimensionaler und vierdimensionaler Objekte
- Mereologie und die Frage nach den Teilen und dem Ganzen
- Die diachrone Identität und Veränderung von Gegenständen
- Ein ontotheoretisches Zwei-Ebenen-Modell
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Kritik an der traditionellen Metaphysik durch Carnap und Quine und stellt Strawsons Unterscheidung zwischen deskriptiver und revisionärer Metaphysik vor. Kapitel 2 behandelt die Ontotheorie dreidimensionaler Objekte und kritisiert die Annahme der diachronen Identität von dreidimensionalen Dingen. Kapitel 3 analysiert die Ontotheorie vierdimensionaler Objekte und ihre Kritikpunkte, darunter die Raum-Zeit Analogie und die Objekt- und Gegenstandsauffassung.
In Kapitel 4 befasst sich die Arbeit mit dem Konzept der Mereologie und untersucht verschiedene Ansätze zur Beantwortung der Frage, wie Teile zu einem Ganzen zusammengefügt werden. Es werden die Positionen des mereologischen Nihilismus, des Universalismus und Inwagens Kriterien der Zusammensetzung diskutiert. Kapitel 5 präsentiert schließlich ein eigenes ontotheoretisches Zwei-Ebenen-Modell, das die Herausforderungen der Veränderung von Gegenständen berücksichtigt und eine Verbindung zwischen den Theorien der relevanten Teile und der Vierdimensionalität komplexer Gegenstände herstellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit thematisiert zentrale Begriffe der Ontologie, wie z.B. Sein, Gegenstand, Teil, Ganzes, Veränderung, Identität, Vierdimensionalität, Mereologie, und beschäftigt sich mit den Philosophen Carnap, Quine, Strawson, Chisholm und Inwagen. Sie erforscht unterschiedliche Perspektiven auf die Frage, was es überhaupt gibt und wie sich die Welt konstituiert.
- Citar trabajo
- Malte C. Daniels (Autor), 2003, Ontologische Perspektiven - Unsere Sicht auf Gegenstände und ihre Teile, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20884