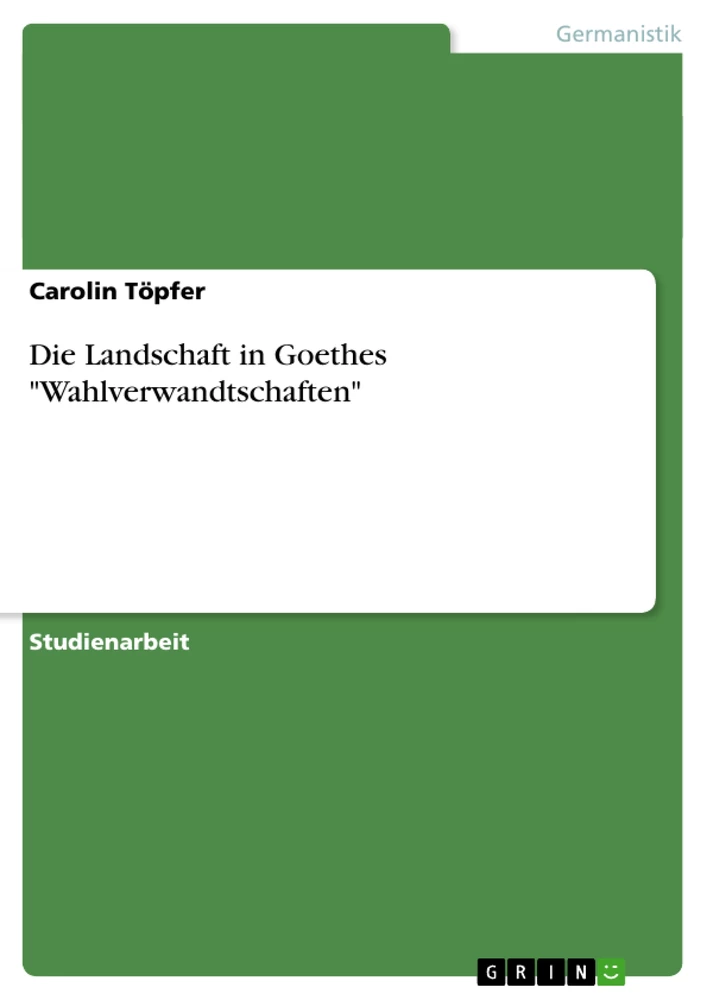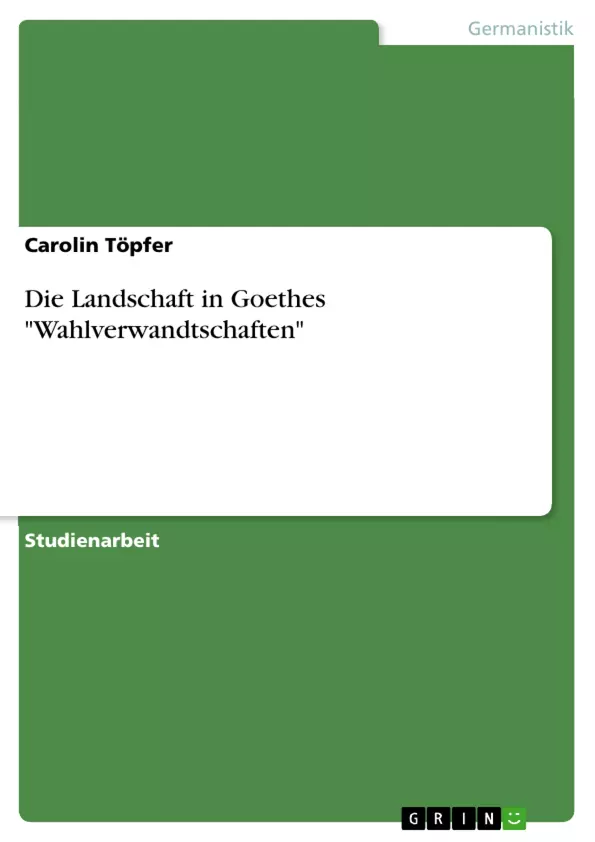Die Bandbreite der wissenschaftlichen Arbeiten zur Landschaftsthematik in der Literatur ist enorm. Selbst wenn man sich „nur“ mit der Goetheschen Auffassung beschäftigt, reicht der Rahmen einer Hausarbeit bei Weitem nicht aus. Aber gerade bei Goethe ist es eben diese Landschaft, die besondere Beachtung verdient. Seien es die Leiden des jungen Werther, das Universalwerk Faust oder eben die Wahlverwandtschaften – alle zeichnen sich durch die zentrale Bedeutung der Umwelt aus. Immer wieder wirkt diese nicht nur als Spiegel der Handlung, sondern auch als Vorbote einer Katastrophe. Die tragischen Elemente einer Handlung werden nicht nur von den Akteuren getragen, sondern auch oder vor allem durch „natürliche“ Elemente in deren Umgebung. Was wäre ein Werther inmitten einer Großstadt, ein Osterspaziergang durch die Korridore eines Schlosses und was wären die Wahlverwandtschaften ohne die herausragende Rolle des Parks?
Der folgende Text beschäftigt sich dementsprechend mit genau diesem Park, der Freiheit und Begrenztheit scheinbar möglich macht, am Ende aber doch nur eine Option zulässt. Es soll um ein natürliches Freiheitsgefühl gleich neben einer konstruierten Abgeschiedenheit gehen.
Vor allem wird das erste Kapitel untersucht werden, wobei Ausblicke auf den späteren Handlungsverlauf, speziell auf die Sterbeszene des Kindes, sicher nicht ausbleiben können.
Dazu wird zunächst die allgemeine Doppeldeutigkeit des Landschaftsbegriffs analysiert werden, um diese dann auf den Roman, seine Landschaft und die Protagonisten zu beziehen. Des Weiteren soll geklärt werden, wie sich die Landschaft im Verlauf der Handlung entwickelt und wie die Katastrophe am See durch verschiedene Elemente der Umwelt widergespiegelt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gestaltete Natur
- Über Natur und Landschaft
- Eduard - ein heraustretender Wanderer?
- Charlotte - ein Stadtmensch?
- Die Enge des Anwesens
- Die Insellage des Anwesens
- Die Metamorphose der Landschaft
- Die Katastrophe am See
- Schlussteil
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Bedeutung der Landschaft in Goethes „Wahlverwandtschaften“ mit Fokus auf die Gestaltung und Wahrnehmung der Natur im Roman. Sie untersucht, wie die Landschaft die Handlung beeinflusst und als Spiegelbild der Figuren und ihrer Beziehungen dient.
- Goethes Naturbegriff und seine Verbindung zur Landschaft
- Die Doppeldeutigkeit des Landschaftsbegriffs nach Joachim Ritter
- Die Rolle der Landschaft in der Handlung und ihre Beziehung zu den Protagonisten
- Die Entwicklung der Landschaft im Verlauf des Romans
- Die Metamorphose der Landschaft als Ausdruck der Veränderungen in den Beziehungen der Figuren
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung befasst sich mit der Relevanz der Landschaft in Goethes Werken und stellt die zentrale Bedeutung des Parks in den „Wahlverwandtschaften“ heraus.
- Gestaltete Natur: Das Kapitel analysiert Goethes Naturbegriff und die Beziehung zwischen Natur und Landschaft. Es stellt die Doppeldeutigkeit des Landschaftsbegriffs nach Joachim Ritter dar und diskutiert die Interpretation der Landschaft als Spiegelbild der menschlichen Wahrnehmung. Der Bezug zu den Protagonisten Eduard und Charlotte wird hergestellt, um die unterschiedliche Art und Weise der Landschaftswahrnehmung zu verdeutlichen.
- Die Enge des Anwesens: Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung der Insellage des Anwesens und untersucht die Metamorphose der Landschaft im Verlauf des Romans. Die Katastrophe am See wird in den Kontext der Umweltbedingungen und der Handlungsdynamiken gestellt.
Schlüsselwörter
Goethe, Wahlverwandtschaften, Landschaft, Natur, Joachim Ritter, Pantheismus, Gestaltung, Wahrnehmung, Metamorphose, Handlung, Figuren, Beziehung, Katastrophe, Anwesen, Insellage
- Arbeit zitieren
- Carolin Töpfer (Autor:in), 2008, Die Landschaft in Goethes "Wahlverwandtschaften", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/208862