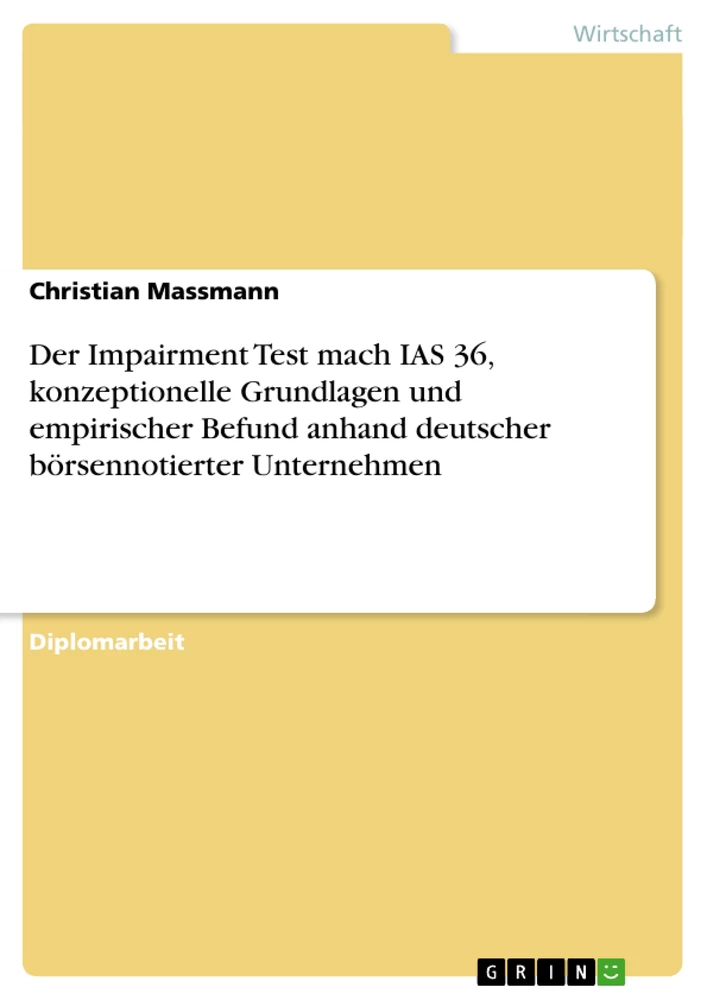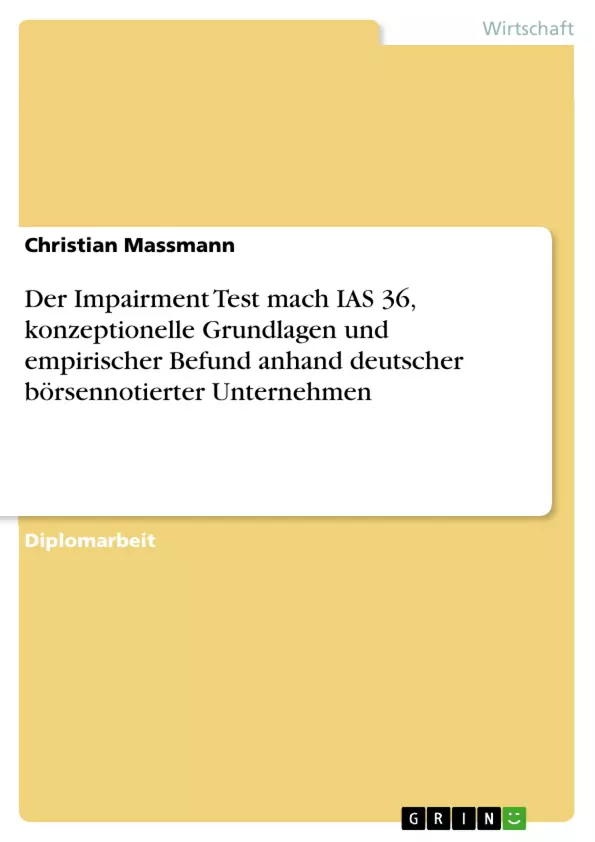Der Aufbau dieser Arbeit wurde mit der Zielsetzung gewählt, in möglichst kompakter und zweckmäßiger Form die zentralen Bestandteile der Goodwill-Bilanzierung nach den IFRS vorzustellen. Durchlaufend soll neben der Behandlung von theoretischen Erklärungen der Bezug zur Bilanzierungspraxis gewahrt werden. Im ersten Kapitel dieser Arbeit werden Hintergrund und Konzeption des IFRS 3 behandelt. Die technische Durchführung der Kaufpreisallokation (purchase price allocation) sowie die Erstbilanzierung des derivativen Goodwills bilden den Schwerpunkt des zweiten Kapitels. Ebenfalls wird die Bilanzierung der Eventualität erläutert, dass die Anschaffungskosten geringer sind als der beizulegende Zeitwert der erworbenen Vermögenswerte abzüglich der Schulden (sog. Badwill). Zusätzlich werden Spezialfälle, wie die Bilanzierung eines derivativen Goodwills im Rahmen eines sukzessiven Unternehmenserwerbs und die Folgen einer Entkonsolidierung für einen bereits vorhandenen Goodwill behandelt. Im dritten Kapitel wird die Folgebilanzierung des Goodwills dargestellt. Im Abschluss des Kapitels wird unter Berücksichtigung der diversen empirischen sowie theoretischen Untersuchungen der Impairment-only-approach kritisch gewürdigt.
Im vierten Kapitel erfolgt die empirische Untersuchung der Goodwill-Bilanzierung und des Goodwill-Impairments anhand der Untersuchung von 138 börsennotierten Unternehmen. Es erfolgt eine Feststellung des Goodwill-Bestands sowie des Umfangs der Goodwill-Impairments in dem Zeitraum 2008 bis 2011. Nach einer Beurteilung möglicher bilanzpolitischer Zusammenhänge erfolgt eine Untersuchung der Wertrelevanz ausgewählter veröffentlichter Rechnungslegungsgrößen. Anschließend werden die Ergebnisse interpretiert und die Wertrelevanz des ausgewiesenen Goodwill-Impairments beurteilt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG.........
- 1.1 ZIELSETZUNG UND AUFBAU DER ARBEIT
- 1.2 HISTORIE, ZIELSETZUNG UND ANWENDUNGSBEREICH DES IFRS 3 ....
- 1.3 EIGENSCHAFTEN DES GOODWILLS
- 2. DIE ANWENDUNG DER ERWERBSMETHODE UND DER KAUFPREISALLOKATION...
- 2.1 FESTLEGUNG DES ERWERBERS
- 2.2 BESTIMMUNG DES ERWERBSZEITPUNKTS
- 2.3 AUFDECKUNG UND VERTEILUNG DER ANSCHAFFUNGSKOSTEN..
- 2.4 GOODWILLERMITTLUNG...........
- 2.4.1 Identifizierung der erworbenen Vermögenswerte und übernommen Schulden.
- 2.4.2 Bewertung der erworbenen Vermögenswerte und übernommenen Schulden........
- 2.4.3 Bewertung von materiellen Vermögenswerten.
- 2.4.4 Bewertung von immateriellen Vermögenswerten...
- 2.4.5 Bewertung von Marken.
- 2.4.6 Bewertung von Finanzinstrumenten.......
- 2.4.7 Bewertung von Schulden
- 2.5 DIE ERSTBILANZIERUNG DES GOODWILLS: DAS GOODWILL-WAHLRECHT
- 2.6 KRITISCHE WÜRDIGUNG DES FULL-GOODWILL-WAHLRECHTS
- 2.7 BESONDERHEITEN DES UNTERNEHMENSERWERBES
- 2.7.1 Reverse Aquisition
- 2.7.2 Sukzessiver Unternehmenserwerb.
- 2.7.3 Behandlung des Goodwills bei der Entkonsolidierung...
- 2.7.4 Der Goodwill in Verbindung mit Gemeinschaftsunternehmen und Equity-Bilanzierung
- 3. DIE FOLGEBILANZIERUNG DES GOODWILLS.
- 3.1 DIE FESTSTELLUNG DES WERTBERICHTIGUNGSBEDARFS
- 3.1.1 Die Berechnung des Nettoveräußerungswerts.
- 3.1.2 Die Berechnung des Nutzungswerts.
- 3.1.3 Die Schätzung der Mittelzuflüsse für die Detailplanungsphase
- 3.1.4 Die Schätzung der Mittelzuflüsse für die Fortschreibungsphase
- 3.1.5 Die Bestimmung des Diskontierungszinssatzes
- 3.1.6 Strukturierung der Zahlungsmittelgenerierenden Einheiten und Goodwill Allokation..
- 3.2 BLIANZIELLE ERFASSUNG DES GOODWILLS-IMPAIRMENTS
- 3.3 KRITISCHE WÜRDIGUNG DER FOLGEBEWERTUNG DES GOODWILLS.......
- 4. EMPIRISCHE ANALYSE DES GOODWILLS UND DER GOODWILL-IMPAIRMENTS
- 4.1 VORGEHENSWEISE UND ZIELSETZUNG
- 4.1.1 Goodwill -Bestandsanalyse..
- 4.1.2 Goodwill -Impairment Analyse
- 4.2 DIE WERTRELEVANZ VON RECHNUNGSLEGUNGSINFORMATIONEN...
- 4.2.1 Bisherige Forschung: Das Ohlson Modell (1995)....
- 4.2.2 Kritik des Ohlson Modells
- 4.2.3 Das Feltham-Ohlson Modell (1995).
- 4.3 KRITISCHE WÜRDIGUNG DER WERTRELEVANZFORSCHUNG.
- 4.4 WERTRELEVANZANALYSE DEUTSCHER BÖRSENNOTIERTER UNTERNEHMEN..
- 4.4.1 Hypothesenbildung.....
- 4.4.2 Methodik und Erwartungen..
- 4.4.3 Ergebnisse des Wertrelevanztests.
- 4.4.4 Würdigung der Untersuchungsergebnisse
- 4.5 THESENFÖRMIGE ZUSAMMENFASssung, EinschränKUNGEN UND AUSBLICK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Bewertung von Goodwill im Rahmen der International Financial Reporting Standards (IFRS). Im Mittelpunkt steht dabei die Analyse des Werthaltigkeitstests, der gemäß IFRS 3 für den Goodwill nach der Erstbewertung durchzuführen ist. Die Arbeit untersucht sowohl die konzeptionellen Grundlagen des Werthaltigkeitstests als auch die empirischen Befunde anhand deutscher börsennotierter Unternehmen.
- Die Relevanz und Bedeutung des Werthaltigkeitstests von Goodwill im Kontext der IFRS
- Die konzeptionellen Grundlagen und methodischen Ansätze zur Durchführung des Werthaltigkeitstests
- Die empirische Analyse der Goodwill-Entwicklung und der Häufigkeit von Goodwill-Impairments bei deutschen börsennotierten Unternehmen
- Die Auswirkungen von Goodwill-Impairments auf die Finanzberichterstattung und die Kapitalmarktkommunikation
- Die Bedeutung des Werthaltigkeitstests für die Unternehmensbewertung und die Entscheidungsfindung von Investoren
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema ein und erläutert die Zielsetzung sowie den Aufbau der Arbeit. Es werden die Historie, die Zielsetzung und der Anwendungsbereich des IFRS 3 sowie die Eigenschaften von Goodwill vorgestellt. Kapitel 2 analysiert die Anwendung der Erwerbsmethode und der Kaufpreisallokation, wobei die Ermittlung des Goodwills im Mittelpunkt steht. Es werden die verschiedenen Bewertungsansätze für immaterielle Vermögenswerte, wie Marken, und die Besonderheiten des Unternehmenserwerbs, wie Reverse Aquisition und sukzessiver Unternehmenserwerb, behandelt. Kapitel 3 befasst sich mit der Folgebewertung des Goodwills, insbesondere mit dem Werthaltigkeitstest. Es werden die verschiedenen Methoden zur Bestimmung des Wertberichtigungsbedarfs sowie die praktische Umsetzung des Werthaltigkeitstests im Rahmen der Bilanzierung erläutert. Kapitel 4 analysiert empirisch die Entwicklung des Goodwills und die Häufigkeit von Goodwill-Impairments bei deutschen börsennotierten Unternehmen. Es wird die Wertrelevanz von Rechnungslegungsinformationen untersucht und die Ergebnisse des Wertrelevanztests für deutsche Unternehmen präsentiert.
Schlüsselwörter
Goodwill, IFRS 3, Werthaltigkeitstest, Impairment, Erwerbsmethode, Kaufpreisallokation, Bewertung, Unternehmensbewertung, empirische Analyse, Wertrelevanz, deutsche börsennotierte Unternehmen
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Goodwill-Impairment-Test nach IAS 36?
Es ist ein jährlicher Werthaltigkeitstest, bei dem geprüft wird, ob der Buchwert des Geschäfts- oder Firmenwerts (Goodwill) noch durch den erzielbaren Betrag gedeckt ist.
Was unterscheidet den Impairment-only-approach von der planmäßigen Abschreibung?
Nach IFRS wird der Goodwill nicht mehr planmäßig über Jahre abgeschrieben, sondern nur noch bei tatsächlicher Wertminderung (Impairment) außerplanmäßig korrigiert.
Wie wird der Nutzungswert eines Goodwills berechnet?
Er wird durch die Diskontierung künftiger Mittelzuflüsse (Cashflows) aus den zahlungsmittelgenerierenden Einheiten ermittelt.
Welche Rolle spielt die Kaufpreisallokation (PPA)?
Bei der PPA wird der Kaufpreis eines Unternehmens auf die identifizierbaren Vermögenswerte und Schulden verteilt; der Restbetrag wird als Goodwill aktiviert.
Was ergab die empirische Untersuchung deutscher Unternehmen (2008-2011)?
Die Arbeit analysiert bei 138 Unternehmen den Goodwill-Bestand und die Häufigkeit von Impairments sowie deren Relevanz für die Kapitalmarktkommunikation.
- Quote paper
- Christian Massmann (Author), 2012, Der Impairment Test mach IAS 36, konzeptionelle Grundlagen und empirischer Befund anhand deutscher börsennotierter Unternehmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/208890