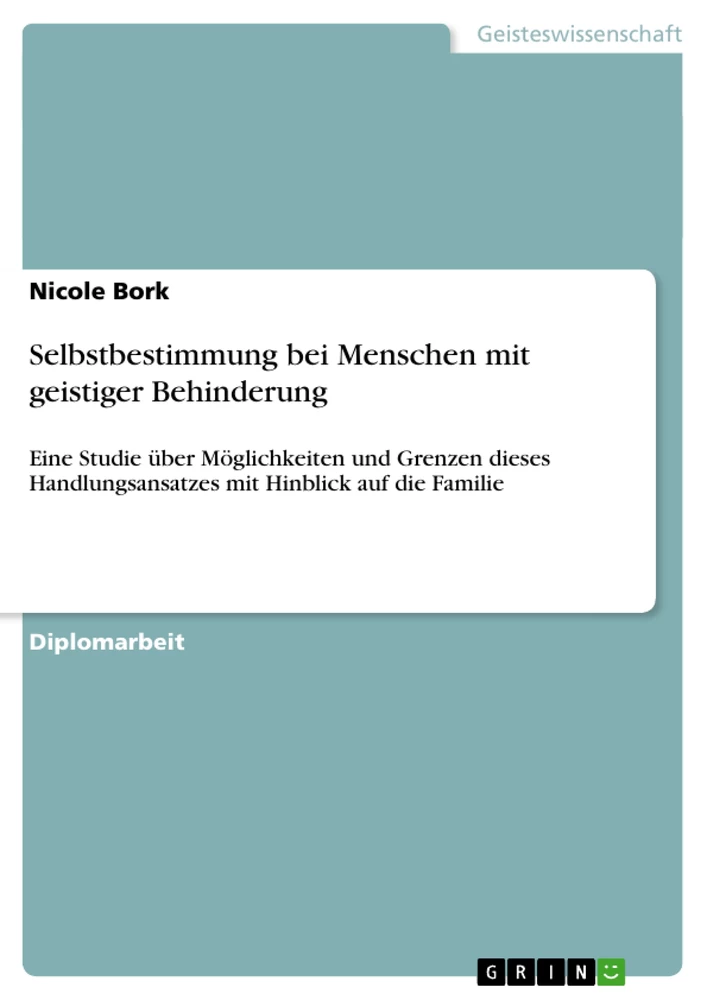In dieser Arbeit stehen Menschen im Mittelpunkt, die unmittelbar von einer sogenannten geistigen Behinderung betroffen sind. Jene Menschen bedürfen je nach Art und Schwere ihrer Beeinträchtigung entsprechend Unterstützung und Hilfe in ihrem Alltag.
Gerade dieser erhöhte Hilfe- und auch Pflegebedarf verleitet viele Menschen noch heute dazu jenen Personenkreis als unmündig und leistungsunfähig zu behandeln. Fremdbestimmung kennzeichnet vielerorts das Leben behinderter Menschen. Besonders davon betroffen sind diejenigen mit schwersten Beeinträchtigungen.
In den letzten 20 Jahren wurden behinderte Menschen selbst aktiv und forderten ihr Recht nach mehr Selbstbestimmung ein. Dieser neue Handlungsansatz gilt als ausschlaggebende Leitidee der Heilpädagogik. Ebenso der Empowerment-Ansatz, der auf dem Selbsthilfeprinzip beruht, stellt eine solche Richtlinie dar. Diese Entwicklungen in Verbindung mit der Normalisierung von Lebensumständen behinderter Menschen, fanden sowohl viele Für- allerdings auch nicht wenige Widersprecher.
Zu Beginn der Arbeit wird eine Vorstellung vermittelt, um welchen Personenkreis es sich hierbei überhaupt handelt. Deshalb wird der Begriff der „geistigen Behinderung“ zunächst näher beleuchtet.
Der Umgang mit Behinderten und auch das Menschenbild änderten sich stets im Wandel der Zeit, unter dem Einfluss gesellschaftlicher Entwicklungen. Diese geschichtlichen Prozesse tragen zur Geistigbehindertenpädagogik, wie sie heute existiert, maßgeblich bei. Auf ihre Inhalte werde ich kurz eingehen. Diese Einführung ist nach des Autors Erachtens notwendig um die Veränderungen und Entwicklungen in der jüngsten Zeit besser verstehen und nachzuvollziehen zu können.
Die Veränderungen, auf die speziell Bezug genommen werden, betreffen die Forderungen nach mehr Selbstbestimmung und Autonomie. Sie entstanden nicht plötzlich, sondern entwickelten sich aus einer unbefriedigenden Situation heraus. Zunächst nur körperbehinderte, dann aber auch Menschen mit geistiger Behinderung machten sich hierfür stark.
Welche Rahmenbedingungen für die Umsetzung dieser Verlangen nötig sind und wie förderliche Unterstützung aussehen sollte wird im Anschluss, genauso wie mögliche hinderliche Faktoren, beschrieben.
Der letzte Teil der Arbeit ist auf Familien und geistig behinderte Töchter bezogen. Hier wird ein Zusammenhang zwischen der elterlichen Erziehung sowie anderen sozialen Einflüssen und den Selbstbestimmungskompetenzen des Kindes hergestellt.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- 1. Verständnis des Begriffes „geistige Behinderung“
- 1.1 Der medizinische Aspekt
- 1.2 Die psychologische Perspektive
- 1.3 Die soziologische Perspektive
- 1.4 Die pädagogische Sichtweise
- 2. Der Umgang mit Behinderung im Geschichtsverlauf
- 2.1 Behinderung in der Antike bis zur Industrialisierung
- 2.2 Behinderung zu Zeiten des Sozialdarwinismus und des Nationalsozialismus in Deutschland
- 2.3 Entwicklungen nach 1945
- 2.4 Die heutige Geistigbehindertenpädagogik
- 2.4.1 Systemisches und konstruktivistisches Denken als Leitlinien
- 2.4.2 Der phänomenologische Ansatz
- 3. Selbstbestimmung
- 3.1 Die Selbstbestimmungs-Bewegung
- 3.1.1 Die Bedeutung von Selbstbestimmung
- 3.1.2 Selbstbestimmung contra Fremdbestimmung
- 3.1.2 Verantwortbarkeit der Selbstbestimmung auch bei Menschen mit geistigen Behinderungen
- 3.4 Konsequenzen für die Geistigbehindertenpädagogik
- 3.4.1 Normalisierung
- 3.4.2 Das Empowerment-Konzept
- 3.5 Veränderte Anforderungen an die Pädagogen
- 3.6 Die dialogische Assistenz
- 3.7 Die Umsetzung in der Praxis
- 3.7.1 Umsetzung auf gesellschaftlicher Ebene
- 3.7.2 Die Umsetzung auf sozial-politischer Ebene
- 3.1 Die Selbstbestimmungs-Bewegung
- 4. Selbstbestimmung in der Herkunftsfamilie
- 4.1 Exemplarische Interviews mit Müttern und ihren Töchtern mit geistiger Behinderung
- 4.2 Ergebnisse: Die „behinderte Familie“
- 4.3 Reaktionen auf eine Behinderung
- 4.4 Bewältigung und Umgang mit der Behinderung
- 4.5 Zusammenhänge von Selbstbestimmung bei Menschen mit geistiger Behinderung und elterlichen Verhaltensweisen
- 4.6 Pädagogische Hilfen für die Eltern und die Familie
- SCHLUSSBETRACHTUNG UND AUSBLICK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beleuchtet das Thema Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung und analysiert die Möglichkeiten und Grenzen dieses Handlungsansatzes, insbesondere im Kontext der Familie. Ziel ist es, das Verständnis für die Bedürfnisse und Perspektiven dieser Personengruppe zu verbessern und die Bedeutung von Selbstbestimmung für ein selbstbestimmtes Leben zu verdeutlichen.
- Die Definition und das Verständnis des Begriffs „geistige Behinderung“ im Wandel der Zeit
- Die Bedeutung von Selbstbestimmung und Empowerment für Menschen mit geistiger Behinderung
- Die Herausforderungen und Chancen der Selbstbestimmung in der Familie
- Der Einfluss elterlicher Verhaltensweisen auf die Selbstbestimmungskompetenzen von Kindern mit geistiger Behinderung
- Die Rolle der Geistigbehindertenpädagogik und ihre Bedeutung für die Förderung von Selbstbestimmung.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung vor und erläutert die Motivation der Autorin, sich mit diesem Thema zu befassen. Kapitel 1 beschäftigt sich mit dem Begriff der „geistigen Behinderung“ und beleuchtet unterschiedliche Perspektiven auf das Thema. Kapitel 2 untersucht die Entwicklung des Umgangs mit Behinderung im historischen Kontext, beginnend von der Antike bis zur heutigen Geistigbehindertenpädagogik.
Kapitel 3 analysiert das Konzept der Selbstbestimmung und seine Bedeutung für Menschen mit geistiger Behinderung. Hier werden die Selbstbestimmungs-Bewegung und ihre Ziele sowie die Herausforderungen und Chancen der Selbstbestimmung in der Praxis diskutiert. Kapitel 4 konzentriert sich auf die Rolle der Familie im Leben von Menschen mit geistiger Behinderung.
Die Kapitel 4.1 bis 4.6 untersuchen anhand von exemplarischen Interviews mit Müttern und ihren Töchtern mit geistiger Behinderung die Auswirkungen elterlicher Verhaltensweisen auf die Selbstbestimmungskompetenzen von Menschen mit geistiger Behinderung.
Schlüsselwörter
Selbstbestimmung, Geistige Behinderung, Familie, Empowerment, Geistigbehindertenpädagogik, Normalisierung, Fremdbestimmung, Behinderung, Inklusion, Familienhilfe, pädagogische Hilfen.
- Quote paper
- Nicole Bork (Author), 2003, Selbstbestimmung bei Menschen mit geistiger Behinderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20909