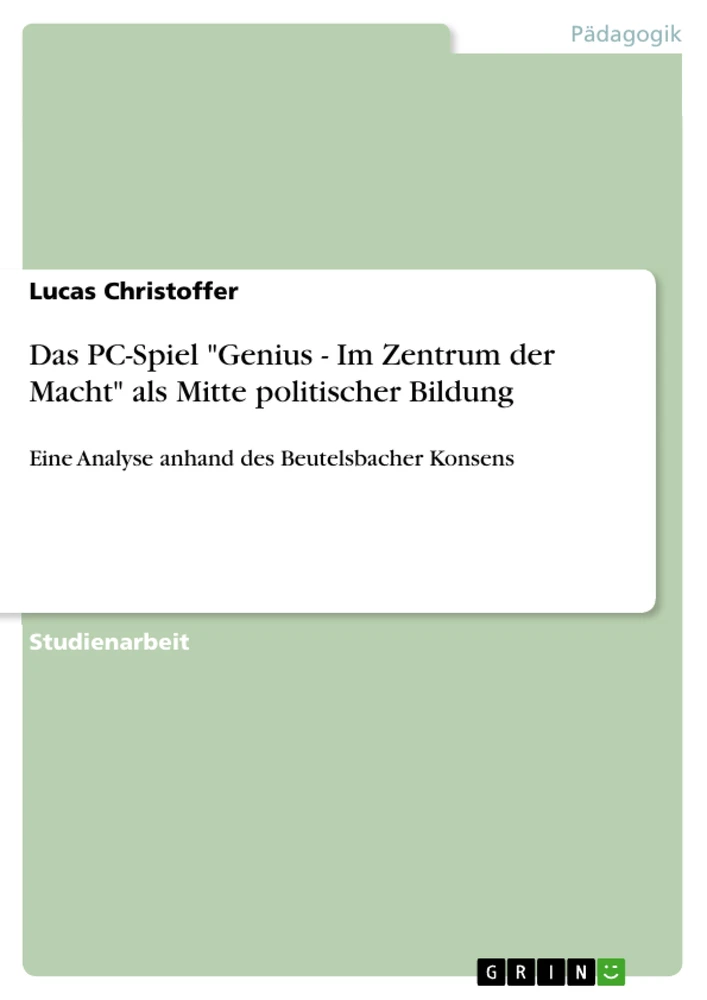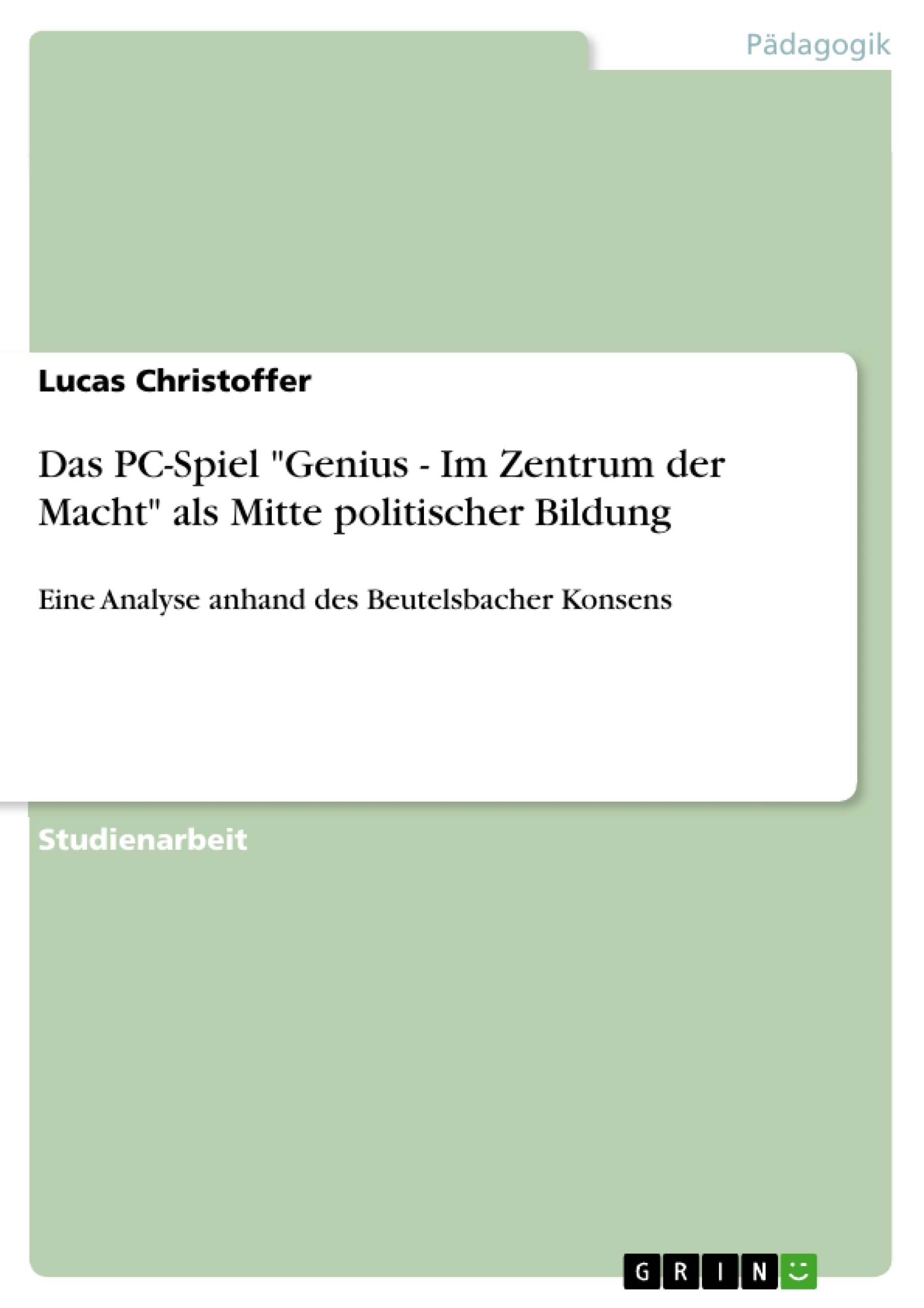In dieser Studienarbeit wird das PC-Spiel „Genius – Der Weg zur Macht“ rezensiert. Hierzu wird es mit dem Beutelsbacher Konsens vergleichen und anhand von diesem analysiert, inwieweit sich das PC-Spiel für den Zweck der politischen Bildung eignet. Aus dieser Analyse entstehen spannende neue Fragen die in der Diskussion ob Computerspiele für Bildungszwecke genutzt werden sollen von großer Bedeutung sein könnten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Eignung des Beutelsbacher Konsens für die Untersuchung des PC-Spiels
- Geschichte des Beutelsbacher Konsens
- Akzeptanz des Beutelsbacher Konsens
- Diskussionen rund um den Beutelsbacher Konsens
- Fazit
- Vergleich des PC-Spiels „Genius – der Weg zur Macht“ mit dem Beutelsbacher Konsens
- Überwältigungsverbot
- Wertevermittlung als Umgehung der Überwältigung
- Verkürzung oder Tabuisierung als Form der Überwältigung
- Gebot der Kontroversität
- Kompensatorische Funktion des Lehrenden
- Darstellung radikaler Meinungen
- Prinzip der Schülerorientierung
- Gemeinwohl in der Schülerorientierung
- Überwältigungsverbot
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert das PC-Spiel „Genius – Der Weg zur Macht“ im Hinblick auf seine Eignung für politische Bildung. Dazu wird das Spiel mit dem Beutelsbacher Konsens verglichen, um zu untersuchen, ob es die Grundsätze der politischen Bildung erfüllt.
- Die Geschichte und Akzeptanz des Beutelsbacher Konsens
- Die Anwendung der drei Grundprinzipien des Beutelsbacher Konsens im Kontext des Spiels
- Die potenziellen Herausforderungen, die das Spiel für die politische Bildung darstellt
- Die Rolle des Spiels in der Förderung von kritischem Denken und Meinungsbildung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das PC-Spiel „Genius – Der Weg zur Macht“ und die Fragestellung der Hausarbeit vor. Anschließend wird die Relevanz des Beutelsbacher Konsens als Indikator für politische Bildung beleuchtet. Dabei werden seine Geschichte, Akzeptanz und die Debatten um seine Auslegung und Erweiterung erörtert.
Das dritte Kapitel analysiert das Spiel im Hinblick auf die drei Grundprinzipien des Beutelsbacher Konsens. Dabei werden die Punkte Überwältigungsverbot, Gebot der Kontroversität und Prinzip der Schülerorientierung betrachtet.
Schlüsselwörter
Beutelsbacher Konsens, politische Bildung, PC-Spiel, „Genius – Der Weg zur Macht“, Überwältigungsverbot, Gebot der Kontroversität, Schülerorientierung, Meinungsbildung, kritisches Denken.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem PC-Spiel „Genius – Im Zentrum der Macht“?
Das Spiel ist eine Simulation, in der Spieler politische Macht erlangen und ausüben, was Fragen zur Eignung für die politische Bildung aufwirft.
Was ist der Beutelsbacher Konsens?
Er ist der Grundkonsens für politische Bildung in Deutschland und umfasst das Überwältigungsverbot, das Gebot der Kontroversität und die Schülerorientierung.
Erfüllt das Spiel das Gebot der Kontroversität?
Die Arbeit analysiert, ob das Spiel verschiedene politische Meinungen und radikale Positionen angemessen darstellt, ohne eine Sichtweise vorzugeben.
Was bedeutet das Überwältigungsverbot im Kontext von Computerspielen?
Es besagt, dass Lernende nicht im Sinne einer Meinung indoktriniert werden dürfen. Das Spiel wird daraufhin geprüft, ob es bestimmte Werte einseitig vermittelt.
Sind Computerspiele für den Politikunterricht sinnvoll?
Das Fazit der Arbeit diskutiert die Chancen und Grenzen von Spielen als Medium zur Förderung von kritischem Denken und Meinungsbildung.
- Quote paper
- Lucas Christoffer (Author), 2010, Das PC-Spiel "Genius - Im Zentrum der Macht" als Mitte politischer Bildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/209199