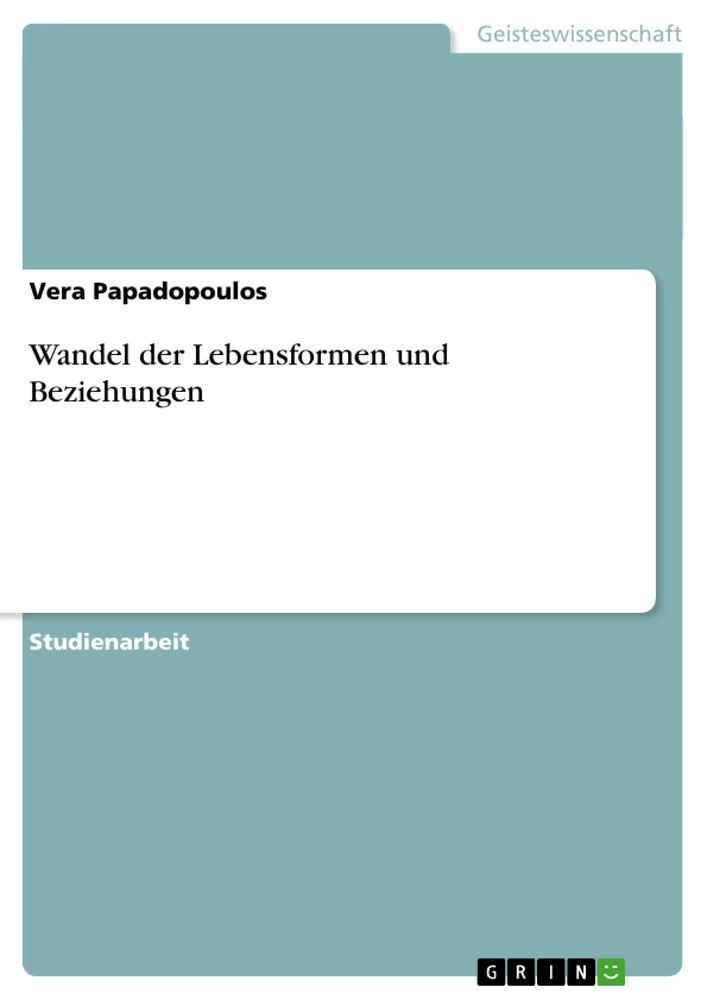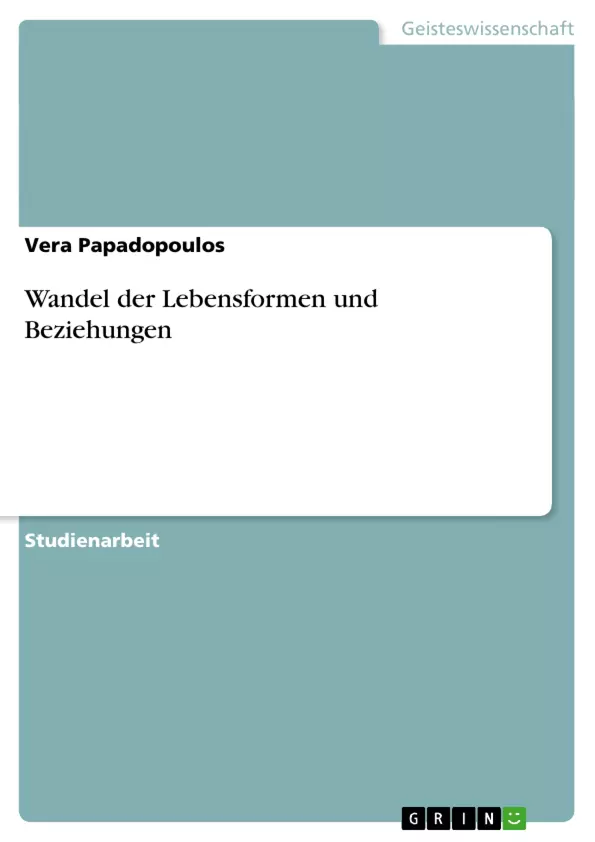„Die Ehe ist kein notwendiges Kriterium für die gesellschaftliche Institution Familie“, die alternativen Lebensformen nehmen zu.
Während bis weit in die 60er Jahre hinein die sogenannte "Normalfamilie" eine kulturelle Selbstverständlichkeit war, löst sich die traditionelle Verbindung von Partnerschaft, Ehe und Familie zunehmend auf. Die Zahl der nichtehelichen Lebensgemeinschaften, der kinderlosen Paare und der Single-Haushalte steigt.
Spannend ist dabei die Betrachtung der Bedeutung und Entwicklung der „klassischen Familie“, hin zu neuen Lebensformen. Das Verhältnis von Leben und Arbeit hat sich stark verändert, die Sozialwissenschaften sprechen von einer „Entgrenzung von Arbeit und Leben“. Dabei wird eine paradox erscheinende Arbeitsmarkt-Entwicklung sichtbar: einerseits der erhöhte Flexibilitätsanspruch und die Bereitschaft zu Mehrarbeit, andererseits die steigende Arbeitslosigkeit.
Der Lebensbereich Familie wird zunehmend durch Organisation und (Zeit-) Management geprägt. Die Wechselbeziehungen zwischen Familie, Arbeit und Lebensformen haben sich verstärkt. Allein die Tatsache, dass in Deutschland jede dritte Ehe geschieden wird macht die Dynamik der Lebensformen mit ihren Beziehungsveränderungen sichtbar.
Inhaltsverzeichnis
Grafik Lebensformen/ Statistik
Definition „Lebensformen
Geschichtlicher Wandel und Auswirkungen
Individualisierung und Pluralisierung
Grafik Wandel der Lebensformen
Systemtheoretische Betrachtung der Familie
Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: http://www.bpb.de/wissen/7UJTR7,0,0,Lebensformen_und_Haushalte_.html, Zugriff 02.10.2010
Der Begriff Lebensformen bezeichnet alle verschiedenen Varianten des Zusammenlebens von Menschen mit und ohne Kindern und wird –mittlerweile- durch eine große Vielfalt gekennzeichnet:
- Kernfamilie mit Eltern und Kind(ern)
- Familien mit alleinerziehendem Elternteil
- Stieffamilien
- Fortsetzungsfamilien
- Reproduktionsmedizinisch entstandene Elternschaft
- Familien mit gleichgeschlechtlichen Partnerinnen („Regenbogenfamilien“)
- Adoptionsfamilien
- Pflegefamilien
„Die Ehe ist kein notwendiges Kriterium für die gesellschaftliche Institution Familie“ (Marx R. 2010, S. 6), die alternativen Lebensformen nehmen zu.
Während bis weit in die 60er Jahre hinein die sogenannte "Normalfamilie" eine kulturelle Selbstverständlichkeit war, löst sich die traditionelle Verbindung von Partnerschaft, Ehe und Familie zunehmend auf. Die Zahl der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften, der kinderlosen Paare und der Single- Haushalte steigt.
Spannend ist dabei die Betrachtung der Bedeutung und Entwicklung der „klassischen Familie“, hin zu neuen Lebensformen. Das Verhältnis von Leben und Arbeit hat sich stark verändert, die Sozialwissenschaften sprechen von einer „Entgrenzung von Arbeit und Leben“ (http://www.uni-protokolle.de/nachrichten/id/33240/). Dabei wird eine paradox erscheinende Arbeitsmarkt- Entwicklung sichtbar: einerseits der erhöhte Flexibilitätsanspruch und die Bereitschaft zu Mehrarbeit, andererseits die steigende Arbeitslosigkeit.
Der Lebensbereich Familie wird zunehmend durch Organisation und (Zeit-) Management geprägt.
Die Wechselbeziehungen zwischen Familie, Arbeit und Lebensformen haben sich verstärkt.
Allein die Tatsache, dass in Deutschland jede dritte Ehe geschieden wird (Beck- Gernsheim E. 2002, S.6) macht die Dynamik der Lebensformen mit ihren Beziehungsveränderungen sichtbar.
Wird die klassische Familie zum Randphänomen oder setzt sie sich als überwiegend praktizierte Lebensform weiterhin durch? Ist die Familie im klassischen Sinn durch eine andere Lebensform ersetzbar?
Diese Fragen können nur unter Betrachtung der Entwicklung der letzten Jahrzehnte beantwortet werden.
Als Vorläufer der Familie kann die Sippe oder die große Haushaltsfamilie betrachtet werden. (Marx R. 2010, S.8).
Im Mittelalter lebten Menschen, gekennzeichnet durch ein eindeutiges Autoritäts- und Abhängigkeitsverhältnis, als leibeigene oder unfreie Bauern. Leben und Arbeit war unmittelbar miteinander verbunden. Die Ehe war nach dem Zölibat zweitrangig und sollte ausschließlich der Kinderzeugung dienen. Eine deutliche Abwertung der Frau wurde durch die Erwartung, dass sie dem Mann zu dienen und sich ihm zu unterwerfen habe, sichtbar. Für viele Frauen bedeutete die Eheschließung der Übergang der Herrschaft des Vaters in die des Ehemannes. Der Wert der Frauen richtete sich nach ihrer „Gebährfähigkeit“. Das Zusammenleben von Menschen konzentrierte sich auf Produktion und Besitzerhalt zur Sicherung der Existenz. Die Kindersterblichkeit war hoch. Zudem wurden Kinder nicht als zuwendungs- und förderungsbedürftige Individuen, sondern als Arbeitskräfte und „Garanten der Altersversorgung der Eltern gesehen“ (Textor M.R. 1991, S. 19). Ein Erziehungs- und Bildungsbedarf wurde nicht erkannt. Werte und Normen wurden durch hohe moralische Prinzipien bestimmt, Begriffe wie „persönlicher Freiraum“, „Selbstbestimmung“ und „Selbstverwirklichung“ waren nicht existent.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Durch die zunehmende Schwächung der kirchlichen Macht und der Verselbständigung der Wissenschaften (beginnend im 16. Jahrhundert) erfolgte ein bedeutender Wandel, letztendlich im 19. Jahrhundert: die mittelalterliche Ordnung löste sich auf, es erfolgte eine Trennung zwischen Haushalt und Arbeitsplatz, die Rolle der Frau änderte sich. Die Individualität und die somit verbundene Autonomie und Selbstverantwortlichkeit trat in den Vordergrund. Parallel wurde der Bedarf des Kindes an Schutz und Erziehung erkannt. Die Erziehung erfolgte zunächst noch geschlechtsspezifisch. Die Eltern- Kind- Beziehung wurde neubestimmt und es entstand eine neue Sicht auf die (aus freiem Willen bekundete) Ehe als bürgerliches Recht. Auch die Bedeutung von Bildung als Weg zu einem unabhängigen und selbstbestimmten Leben wurde erkannt (Textor M.R. 1991, S.22). Parallel zu dem Übergang der ländlich – bäuerlich geprägten Lebens- und Arbeitswelt in eine städtisch-industrielle Lebens- und Arbeitswelt änderten sich die ökonomischen Funktionen des Familienhaushalts.
Der Soziologe Ulrich Beck spricht vom Beginn einer Risikogesellschaft, da die Modernisierung durch ökologische und soziale Risiken begleitet wird (Marx R. 2010, S.10). Die Veränderungen der Ökonomie bringen Veränderungen der sozialen Strukturen mit sich: neue Lebensformen und Lebensinhalte bilden sich.
Die Ausgliederung von Verwandten, die höhere Mobilität und die Trennung von Familie und Arbeitsplatz haben einerseits zu mehr Unabhängigkeit und Autonomie der Familie geführt (Textor M.R.1991, S. 45), andererseits waren die Familien zunehmend auf sich allein gestellt, da es den Schutz und die gemeinschaftliche Arbeit durch generationenübergreifende gemeinsame Lebensformen nicht mehr gab. Die lange Zeit primär ökonomisch begründete Eheschließung wurde zunehmend die Basis für eine Familie. Dennoch ist die Scheidungsrate in den vergangenen Jahrzenten stark angestiegen. Bemerkenswert ist dabei aber auch, dass Ehen heute mehr als doppelt so lange bestehen wie vor hundert Jahren, da sie nicht wie früher durch einen frühzeitigen Tod des Partners oder wie heute durch Scheidung beendet werden. Dementsprechend gab es früher auch schon eine große Zahl an Alleinerziehenden und Stieffamilien. Weg von der patriarchalisch betonten Familie ist eine Tendenz zu partnerschaftlichen Familienbeziehungen festzustellen. „Frauen sind selbständiger, unabhängiger, emanzipierter geworden und sind häufiger erwerbstätig“ (Textor M.R. 1991, S.46). Durch diese Bewusstseins- und Rollenveränderungen ergibt sich der Bedarf innerfamilärer Absprachen und Organisation. Familienwerte und Normen sind nicht mehr ausschließlich durch äußere Bedingungen/ Strukturen (z.B. Gemeinschaft als Produktionsbetrieb) festgelegt, sondern bedürfen zunehmend der konstanten „Verhandlung“ und Vereinbarung, Prioritäten müssen für das gemeinsame Zusammenleben und Wirtschaften festgelegt werden. Neue Strategien der Lebensbewältigung müssen entwickelt werden (Familienbericht 2004, S.19).
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Wandel der Lebensformen?
Es beschreibt die Auflösung der traditionellen „Normalfamilie“ hin zu einer Vielfalt von Lebensentwürfen wie Single-Haushalten, Patchwork-Familien und kinderlosen Paaren.
Was bedeutet „Entgrenzung von Arbeit und Leben“?
Dieser Begriff aus den Sozialwissenschaften beschreibt das Verschwimmen der Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben, oft durch erhöhte Flexibilitätsansprüche.
Wie hat sich die Rolle der Frau geschichtlich verändert?
Von der Unterordnung im Mittelalter hin zu mehr Autonomie, Erwerbstätigkeit und Verhandlungsmacht innerhalb partnerschaftlicher Familienbeziehungen.
Welche neuen Familienformen werden genannt?
Genannt werden unter anderem Einelternfamilien, Stieffamilien, Regenbogenfamilien, Pflegefamilien und durch Reproduktionsmedizin entstandene Elternschaften.
Warum steigt die Scheidungsrate laut der Arbeit?
Die Dynamik resultiert aus Individualisierungsprozessen, veränderten Rollenerwartungen und der Tatsache, dass Ehen heute nicht mehr primär ökonomisch abgesichert sein müssen.
- Citar trabajo
- Vera Papadopoulos (Autor), 2010, Wandel der Lebensformen und Beziehungen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/209290