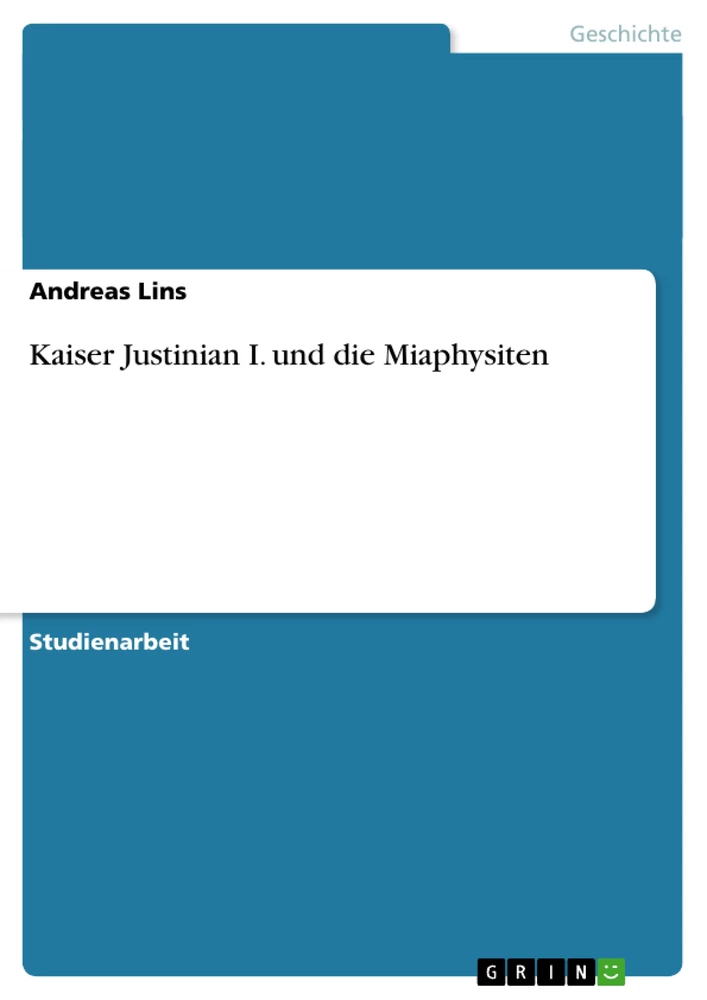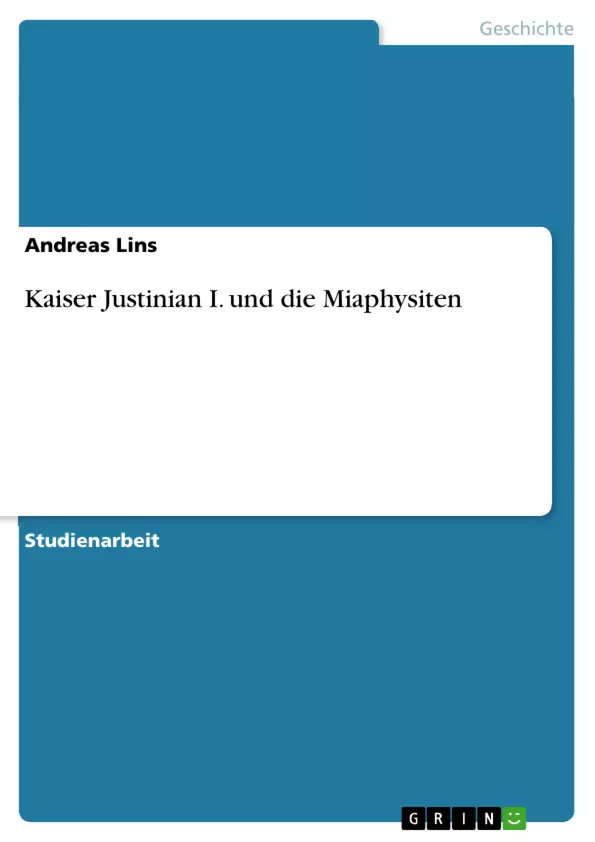Um eine Einführung in die Thematik zu geben, wird im ersten Kapitel zunächst auf den Miaphysitismus eingegangen. Seine Entstehung und seine Entwicklung in den ersten Jahren sowie grundsätzliche Denkansätze werden dabei kurz dargestellt. Im zweiten Kapitel wird anhand eines früheren Kaisers dargestellt, warum die Einigung des Christentums in dieser Zeit eine politische und keine rein religiöse Aufgabe war. Das Kapitel gibt auch einen Einblick in Kompromissmöglichkeiten, denen sich später Justinian gegenübergestellt sah. Mit dem dritten Kapitel wird in die Regierungszeit Justinians eingeführt. Sein kaiserliches Selbstverständnis, welches Voraussetzung für das Nachvollziehen seiner Regierungstätigkeit ist, steht dabei im Mittelpunkt der Untersuchung. Im vierten Kapitel wird schließlich der spezifischen Fragestellung dieser Hausarbeit nachgegangen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit kann in diesem Rahmen selbstverständlich nicht erhoben werden, doch sind die Beispiele so gewählt, dass sie der Beantwortung der Fragestellung dienlich sind. Es wurde versucht, möglichst viele Meinungen dazu in den Diskurs einzubringen. Am Schluss der Arbeit werden die Erkenntnisse zusammengefasst und es wird versucht, anhand der vorangegangenen Argumentation die Fragestellung abschließend zu beantworten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Herausbildung des Miaphysitismus
- Definition
- Die Ursprünge
- Vorgeschichte und Folgen des Konzils von Chalkedon
- Erste Kompromissversuche vor Justinian: Zenon und das Henotikon
- Vorbemerkungen zu Kaiser Justinian
- Herrschaftsauffassung in der Tradition des spätantiken Kaisertums
- Spezifika bei Justinian
- Bemerkungen zur Rolle der Kaisergattin Theodora
- Justinians Eingriffe in die Orthodoxie
- Diskursbereitschaft bis in die 530er-Jahre
- Die Anfänge unter Justin
- Die theopaschitische Formel
- Die Einsetzung miaphysitischer Patriarchen
- Die Spätphase der Regierungszeit Justinians
- Verstärkte theologische Tätigkeit
- Das zweite Konzil von Konstantinopel
- Diskursbereitschaft bis in die 530er-Jahre
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Religionspolitik Kaiser Justinians I. gegenüber den Miaphysiten zwischen 527 und 536 n. Chr. Ziel ist es, herauszufinden, ob Justinian eine kontinuierliche Politik verfolgte oder ob es Phasen und Brüche gab. Die Arbeit konzentriert sich auf die Interaktion zwischen Justinians Herrschaftsverständnis und seinen Eingriffen in den theologischen Diskurs um den Miaphysitismus.
- Justinians Herrschaftsverständnis und seine religiöse Politik
- Die Entstehung und Entwicklung des Miaphysitismus
- Kompromissversuche vor und während Justinians Regierungszeit
- Justinians Eingriffe in die theologischen Debatten
- Analyse der Politik Justinians gegenüber den Miaphysiten in der Periode 527-536
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Fokus der Arbeit: die Religionspolitik Kaiser Justinians I. gegenüber den Miaphysiten. Sie betont die Komplexität des Themas und die Notwendigkeit, Vereinfachungen vorzunehmen, um die dogmatischen Feinheiten der Spätantike für den historischen Kontext verständlich zu machen. Der Fokus liegt auf der Frage nach der Kontinuität oder Brüchen in Justinians Politik gegenüber den Miaphysiten, insbesondere zwischen 527 und 536 n. Chr. Die methodischen Grenzen der Arbeit aufgrund der komplexen theologischen Hintergründe werden ebenfalls dargelegt.
Die Herausbildung des Miaphysitismus: Dieses Kapitel bietet eine Einführung in den Miaphysitismus. Es definiert den Begriff „Miaphysitismus“ im Gegensatz zu „Monophysitismus“ und „Dyophysitismus“, klärt die Terminologie und beschreibt die Ursprünge und die Entwicklung dieser christlichen Richtung in den ersten Jahren nach dem Konzil von Chalkedon. Es werden die grundlegenden theologischen Ansätze der Miaphysiten erläutert und der Kontext ihrer Entstehung im Hinblick auf das Konzil von Chalkedon beleuchtet. Die Darstellung konzentriert sich auf die wesentlichen Merkmale der Lehre und deren Abgrenzung von anderen christlichen Strömungen.
Erste Kompromissversuche vor Justinian: Zenon und das Henotikon: Dieses Kapitel analysiert frühere Versuche, den Konflikt innerhalb des Christentums beizulegen, insbesondere die Politik Kaiser Zenons und das Henotikon. Es verdeutlicht, dass die Einigung des Christentums zu dieser Zeit nicht nur eine religiöse, sondern auch eine politische Aufgabe darstellte. Das Kapitel zeigt die Kompromissversuche auf, die Justinian später ablehnte, und liefert somit einen wichtigen Hintergrund für das Verständnis seiner eigenen Politik. Die Darstellung analysiert die Strategien und die Folgen dieser Kompromissversuche.
Vorbemerkungen zu Kaiser Justinian: Dieses Kapitel dient als Einleitung in die Regierungszeit Justinians. Es untersucht sein kaiserliches Selbstverständnis und seine Herrschaftsauffassung, die fundamental für das Verständnis seiner Regierungspolitik sind. Es wird Justinians Verständnis vom Verhältnis von Kaiser und Kirche beleuchtet, ebenso wie der Einfluss seiner Frau Theodora. Dieses Kapitel betont die Bedeutung des kaiserlichen Selbstverständnisses für die Gestaltung seiner Politik gegenüber den Miaphysiten.
Schlüsselwörter
Kaiser Justinian I., Miaphysiten, Monophysitismus, Konzil von Chalkedon, Henotikon, Religionspolitik, Spätantike, Christologie, Orthodoxie, Herrschaftsverständnis, Theodora.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Kaiser Justinians Religionspolitik gegenüber den Miaphysiten (527-536 n. Chr.)
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Religionspolitik Kaiser Justinians I. gegenüber den Miaphysiten zwischen 527 und 536 n. Chr. Das zentrale Thema ist die Frage nach der Kontinuität oder den Brüchen in Justinians Vorgehen und wie sein Herrschaftsverständnis seine Eingriffe in den theologischen Diskurs um den Miaphysitismus beeinflusste.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Justinians Herrschaftsverständnis und seine religiöse Politik, die Entstehung und Entwicklung des Miaphysitismus, Kompromissversuche vor und während Justinians Regierungszeit, Justinians Eingriffe in die theologischen Debatten und eine Analyse seiner Politik gegenüber den Miaphysiten in der Periode 527-536 n. Chr. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Einfluss Kaiserin Theodoras gewidmet.
Wie ist die Hausarbeit aufgebaut?
Die Hausarbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung, Die Herausbildung des Miaphysitismus, Erste Kompromissversuche vor Justinian: Zenon und das Henotikon, Vorbemerkungen zu Kaiser Justinian, Justinians Eingriffe in die Orthodoxie und Zusammenfassung. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Thematik und liefert wichtige Hintergrundinformationen.
Was versteht man unter Miaphysitismus?
Das Kapitel „Die Herausbildung des Miaphysitismus“ definiert den Begriff und differenziert ihn von Monophysitismus und Dyophysitismus. Es beleuchtet die Ursprünge und die Entwicklung dieser christlichen Richtung, ihre theologischen Ansätze und den Kontext ihrer Entstehung im Hinblick auf das Konzil von Chalkedon.
Welche Rolle spielte das Konzil von Chalkedon?
Das Konzil von Chalkedon (451 n. Chr.) spielt eine zentrale Rolle, da es den Hintergrund für die Entstehung und Entwicklung des Miaphysitismus bildet. Die Hausarbeit untersucht die Vorgeschichte und die Folgen dieses Konzils für die weitere Entwicklung des christlichen Glaubens und den Konflikt zwischen Miaphysiten und Orthodoxen.
Welche Kompromissversuche gab es vor Justinian?
Das Kapitel über die Kompromissversuche vor Justinian analysiert die Politik Kaiser Zenons und das Henotikon als Versuche, den Konflikt innerhalb des Christentums beizulegen. Es zeigt, dass die Einigung des Christentums zu dieser Zeit sowohl religiöse als auch politische Implikationen hatte.
Wie wird Justinians Herrschaftsverständnis dargestellt?
Die Hausarbeit untersucht Justinians Herrschaftsauffassung und sein kaiserliches Selbstverständnis, um seine Politik gegenüber den Miaphysiten besser zu verstehen. Es wird sein Verhältnis zur Kirche und der Einfluss seiner Frau Theodora beleuchtet.
Welche methodischen Grenzen werden in der Hausarbeit erwähnt?
Die Einleitung der Arbeit weist auf die methodischen Grenzen hin, die sich aus der Komplexität der theologischen Hintergründe und der Notwendigkeit, die dogmatischen Feinheiten der Spätantike für den historischen Kontext verständlich zu machen, ergeben. Vereinfachungen waren notwendig, um die Thematik angemessen zu behandeln.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Hausarbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Kaiser Justinian I., Miaphysiten, Monophysitismus, Konzil von Chalkedon, Henotikon, Religionspolitik, Spätantike, Christologie, Orthodoxie, Herrschaftsverständnis, Theodora.
- Quote paper
- Andreas Lins (Author), 2011, Kaiser Justinian I. und die Miaphysiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/209313