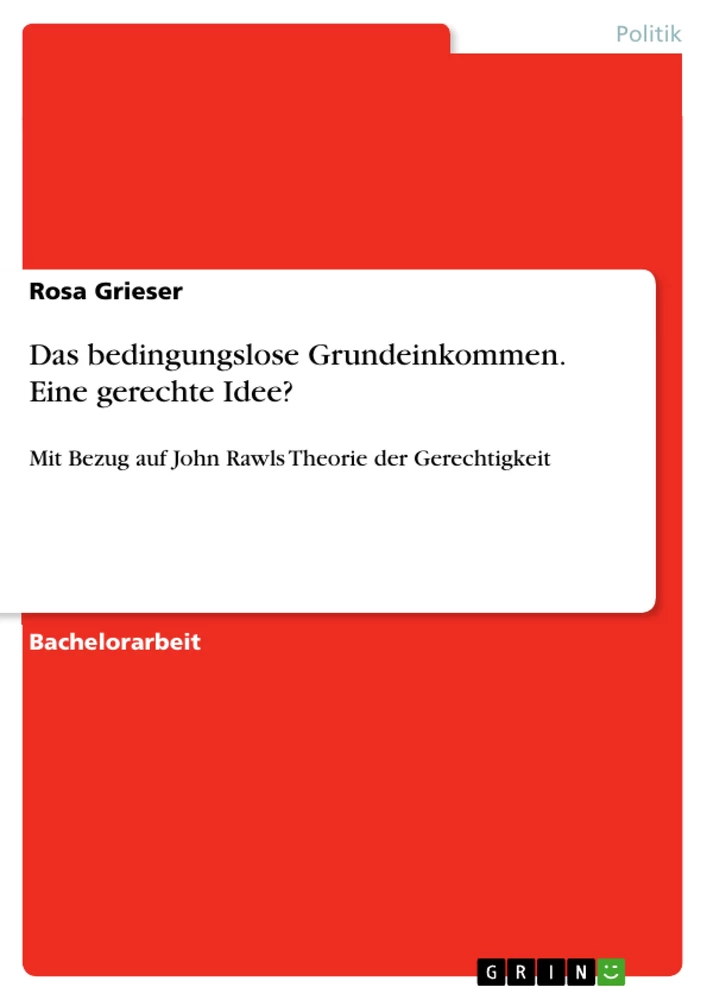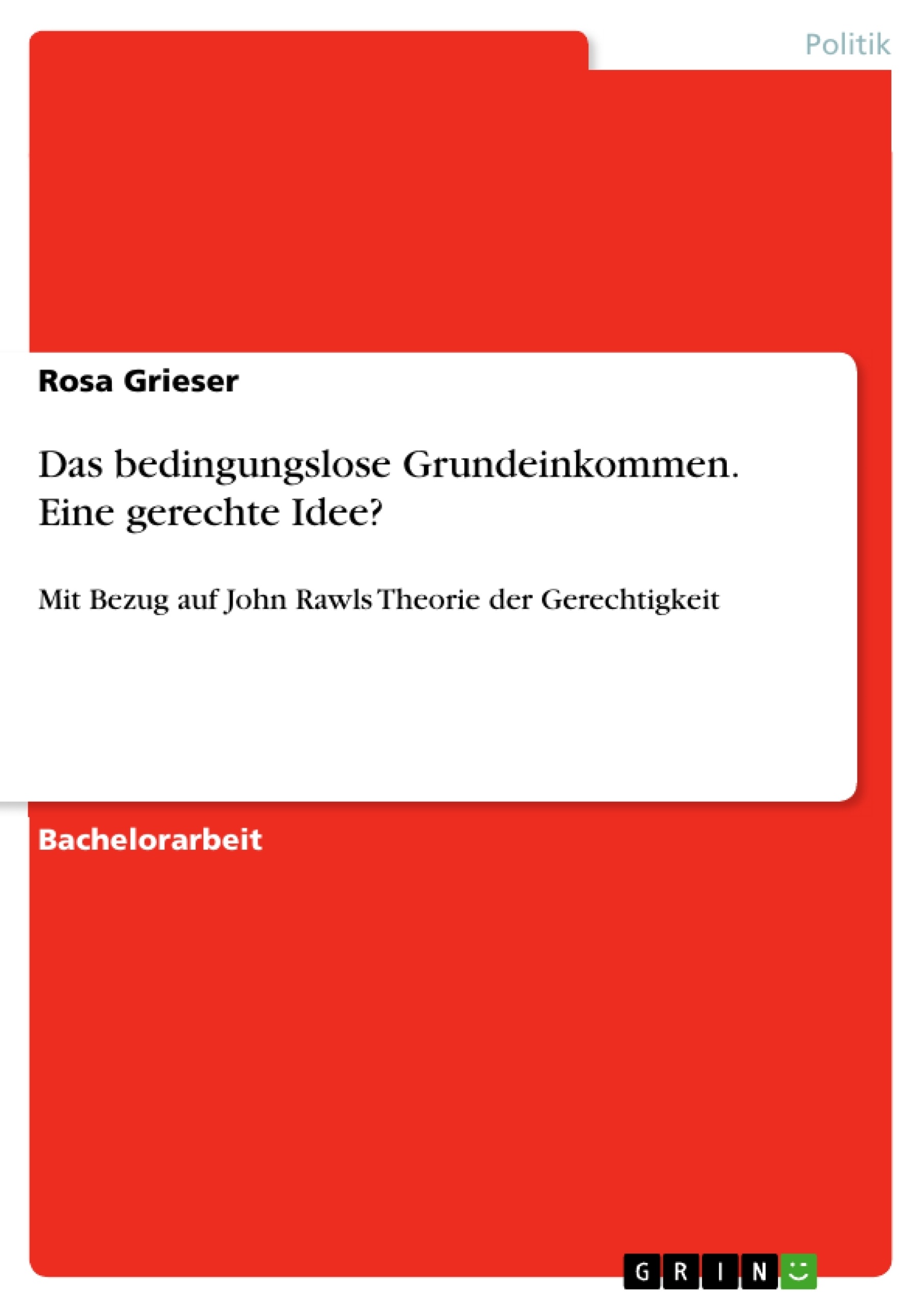Die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) findet zunehmend mehr Gehör in der breiten Öffentlichkeit. Grund dafür seien die neuen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen durch eine veränderte Wirtschaftsweise, die den Sozialstaat in eine Krise gestürzt habe. Durch den Wandel von einer Selbstversorgungs zu einer Fremdversorgungsgesellschaft haben die Fortschritte in der Arbeitsteilung, in der Standardisierung und der Automatisierung von Arbeitsabläufen zu einer höheren Produktivität und zu einer Erleichterung des Arbeitsprozesses geführt. Diese Entwicklung bedeutet aber gleichzeitig eine zunehmende und voraussichtlich auch langfristige Arbeitslosigkeit, da menschliche Produktivkräfte immer weiter durch maschinelle ersetzt werden. Als eine weitere Folge der veränderten Wirtschaftsweise kann der Anstieg der Einkommens- und Vermögensungleichheiten betrachtet werden. Während die oberen zehn Prozent der Einkommensbezieher immer mehr verdienen, können die unteren zehn Prozent von ihrem Einkommen nicht einmal mehr ihren Lebensunterhalt decken. Für die Fürsprecher des BGE bedeutet diese Entwicklung eine zunehmende soziale Ungerechtigkeit, die in der Ungerechtigkeit des Steuersystem, der Bildungschancen, der Möglichkeiten der gesellschaftlichen Partizipation etc. zu erkennen sei. Der Sozialstaat könne daher der neuen Herausforderung durch die veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nur begegnen, wenn er neu strukturiert werden würde. Eine Idee dafür wäre die Einführung des BGE, welches jedem bedingungslos ein Einkommen garantiert und dadurch die soziale Ungerechtigkeit minderte.
Wenn das BGE die soziale Ungerechtigkeit mindern würde, impliziert das, dass es soziale Gerechtigkeit schaffte und somit nicht nur eine gerechtfertigte, sondern auch eine gerechte Idee wäre?
Ziel dieser Arbeit ist es vielmehr anhand von Rawls Theorie der Gerechtigkeit" darzustellen, ob es gerecht wäre, Menschen ein Einkommen einzugestehen, ohne dass sie erwerbstätig sind oder anderen Auflagen unterliegen. Die Frage, welcher diese Arbeit nachgeht, ist daher: Entspricht die Idee des BGE Rawls Vorstellung einer gerechten Verteilung?
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das bedingungslose Grundeinkommen
3. Die Begründung der Gerechtigkeitsprinzipien
3.1 Der Urzustand
3.2 Die Gerechtigkeitsgrundsätze
3.3 Die lexikalische Ordnung der Gerechtigkeitsgrundsätze
3.4 Unterscheidungsprinzip
4. Die Verteilungsgerechtigkeit
4.1 Regierungsabteilungen
5. Rawls und das bedingungslose Grundeinkommen
6. Fazit
7. Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieser Arbeit zum bedingungslosen Grundeinkommen (BGE)?
Das Ziel ist es, mithilfe von John Rawls' "Theorie der Gerechtigkeit" zu prüfen, ob die Idee eines BGE als gerecht im Sinne einer fairen Verteilung angesehen werden kann.
Warum wird das BGE aktuell so intensiv diskutiert?
Gründe sind der Wandel der Wirtschaft durch Automatisierung und Digitalisierung, die zunehmende Arbeitslosigkeit und die wachsende Einkommensungleichheit in der Gesellschaft.
Welche Rolle spielt John Rawls in dieser Untersuchung?
Rawls liefert mit seinen Gerechtigkeitsprinzipien und dem Konzept des "Urzustands" den theoretischen Rahmen, um zu beurteilen, ob ein Einkommen ohne Erwerbspflicht gerechtfertigt ist.
Was versteht man unter dem "Unterscheidungsprinzip" bei Rawls?
Es ist ein Grundsatz, nach dem soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten so gestaltet sein müssen, dass sie den am wenigsten Begünstigten den größten Vorteil bringen.
Kann das BGE soziale Ungerechtigkeit mindern?
Fürsprecher argumentieren, dass es durch die garantierte Existenzsicherung Teilhabechancen verbessert und die Abhängigkeit von prekären Arbeitsverhältnissen verringert.
- Quote paper
- Rosa Grieser (Author), 2010, Das bedingungslose Grundeinkommen. Eine gerechte Idee?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/209368