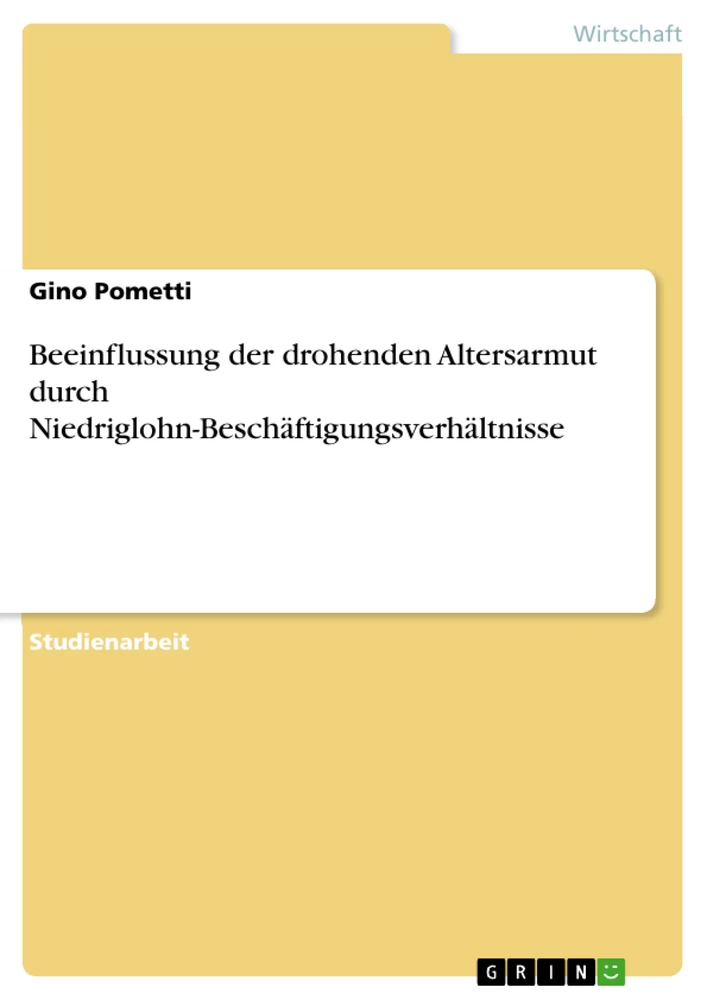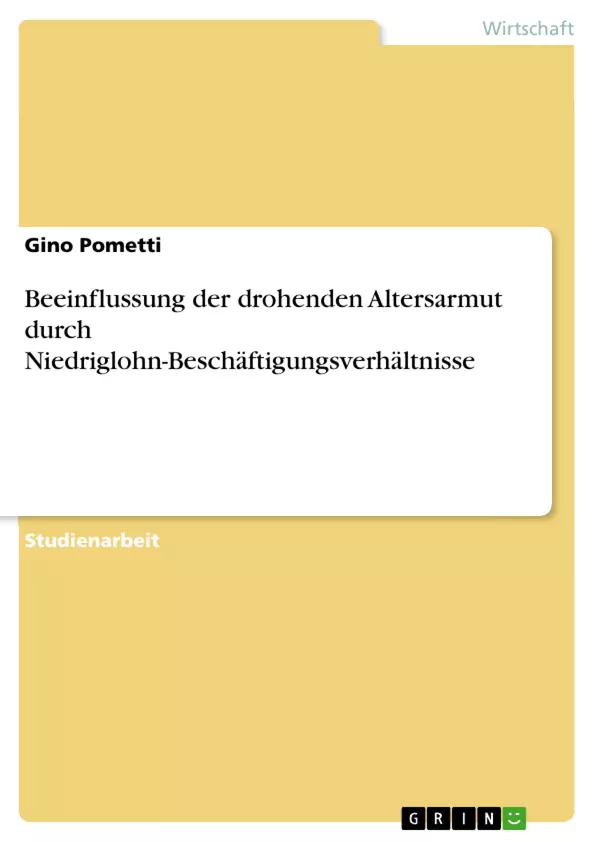In der letzten Dekade wurden der Sozialstaat und der Arbeitsmarkt der Bundesrepublik stark reformiert. Besonders die in der Regierung von Bundeskanzler Schröder (1998-2005) umgesetzte Agenda 2010, die das Ziel hatte, günstige Rahmenbedingungen für Wachstum und Beschäftigung zu schaffen, war die Grundlage des Umbaus des Sozialstaates und des Arbeitsmarkts. Der Arbeitsmarkt und das Sozialsystem mit der gesetzlichen Rentenversicherung wurden aus mehreren Gründen geändert:
- Der gestiegene Druck auf den Arbeitsmarkt durch die Globalisierung,
- das damit einhergehende Sinken der Sozialversicherungsbeiträge im Sozialsystem,
- der demographische Wandel sowie
- die Ziele der Europäischen Union (im Folgenden EU genannt), mit der Lissabon-Strategie die Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität im europäischen Wirtschaftsraum zu erhöhen.
In der politischen Debatte stehen der Agenda 2010 u. a. Gewerkschaften und Sozialverbände kritisch gegenüber, da sie statt eines Umbaus des Sozialsystems eher einen Abbau desselben und eine Spaltung der Gesellschaft befürchten. Besonders die Deregulierung und Flexibilisierung des Arbeitsmarkts bewirkten, dass der Anteil atypischer Beschäftigungsformen wie Teilzeitarbeit oder Leiharbeit zu Lasten von Normalarbeitsverhältnissen stieg. Mit atypischen Beschäftigungsformen geht oft das Fehlen eines existenzsichernden Einkommens, sozialer Absicherung, sowie betrieblicher Sozialleistungen einher. Mit der Zunahme dieser atypischen Beschäftigung ging auch ein deutlicher Anstieg der Beschäftigten mit Niedriglohn einher.
Bei der Berechnung der Rentenhöhe gilt in der Bundesrepublik das Äquivalenzprinzip: Die Rente ist eine beitragsbezogene Leistung, die sich aus der Dauer und der Höhe der entrichteten Rentenversicherungsbeiträge während der Erwerbstätigkeit ergibt. Da die Höhe der Rentenversicherungsbeiträge vom jeweiligen Lohn des Erwerbstätigen abhängt, ist der Lohn mittelbar mit der Rentenhöhe verknüpft. Daher geht mit einem niedrigen Lohn auch eine niedrige Rente einher, die für den Betroffenen Armut im Alter bedeuten kann.
I. Inhaltsverzeichnis
II. Abkürzungsverzeichnis
III. Abbildungsverzeichnis
IV. Formelverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Problemstellung
1.2. Ziel und Gang der Arbeit
2. Bestandsaufnahme des Arbeitsmarkts hinsichtlich des Niedriglohns in Deutschland
2.1. Arten der Erwerbsformen auf dem Arbeitsmarkt
2.2. Anteil der Erwerbsformen auf dem Arbeitsmarkt
2.3. Bedeutung der Normalarbeitsverhältnisse und der atypischen Arbeitsverhältnisse für den Niedriglohnsektor
3. Gesetzliche Rentenversicherung
3.1. Einführung
3.2. Faktoren zur Berechnung der Regelaltersrente
3.3. Standardrente als charakteristische Kennzahl
3.4. Rentenerwartung nach Beschäftigung im Niedriglohn-sektor
3.5. Ergebniskritik an der Rentenerwartung nach Beschäftigung im Niedriglohnsektor
4. Rentenerwartung und Altersarmut
4.1. Kennzahlen nach Definition der Europäischen Union
4.2. Kennzahl nach Grundsicherungsbedarf
4.3. Bewertung der Rentenerwartung
5. Zusammenfassung
5.1. Wichtige Ergebnisse
5.2. Ausblick
Quellenverzeichnis
Literaturquellen
Elektronische Quellen
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Niedriglohn und Altersarmut zusammen?
Da die gesetzliche Rente in Deutschland dem Äquivalenzprinzip folgt, führen niedrige Löhne zu geringen Rentenversicherungsbeiträgen und somit zu einer niedrigen Rente, die oft nicht armutsfest ist.
Welche Rolle spielte die Agenda 2010 für den Arbeitsmarkt?
Die Agenda 2010 förderte die Deregulierung und Flexibilisierung des Arbeitsmarkts, was zu einem Anstieg atypischer Beschäftigungsverhältnisse wie Leiharbeit und Teilzeit führte.
Was versteht man unter "atypischen Beschäftigungsformen"?
Dazu zählen Arbeitsverhältnisse, die vom Normalarbeitsverhältnis abweichen, wie Befristungen, Zeitarbeit, geringfügige Beschäftigung oder Teilzeit unter 20 Stunden.
Was ist das Äquivalenzprinzip in der Rentenversicherung?
Es besagt, dass die Höhe der späteren Rente direkt proportional zur Höhe und Dauer der eingezahlten Beiträge während des Erwerbslebens ist.
Wie definiert die EU Armutsgefährdung?
Die EU nutzt Kennzahlen wie die Armutsgefährdungsschwelle, die meist bei 60 % des mittleren Medianeinkommens der Bevölkerung liegt.
- Quote paper
- Gino Pometti (Author), 2013, Beeinflussung der drohenden Altersarmut durch Niedriglohn-Beschäftigungsverhältnisse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/209430