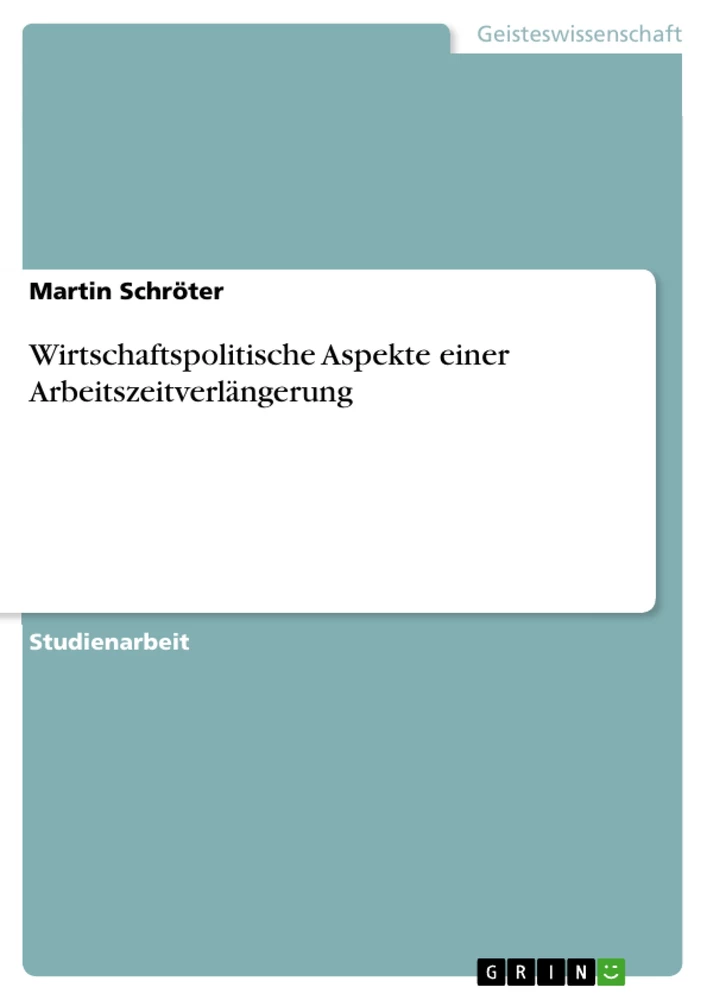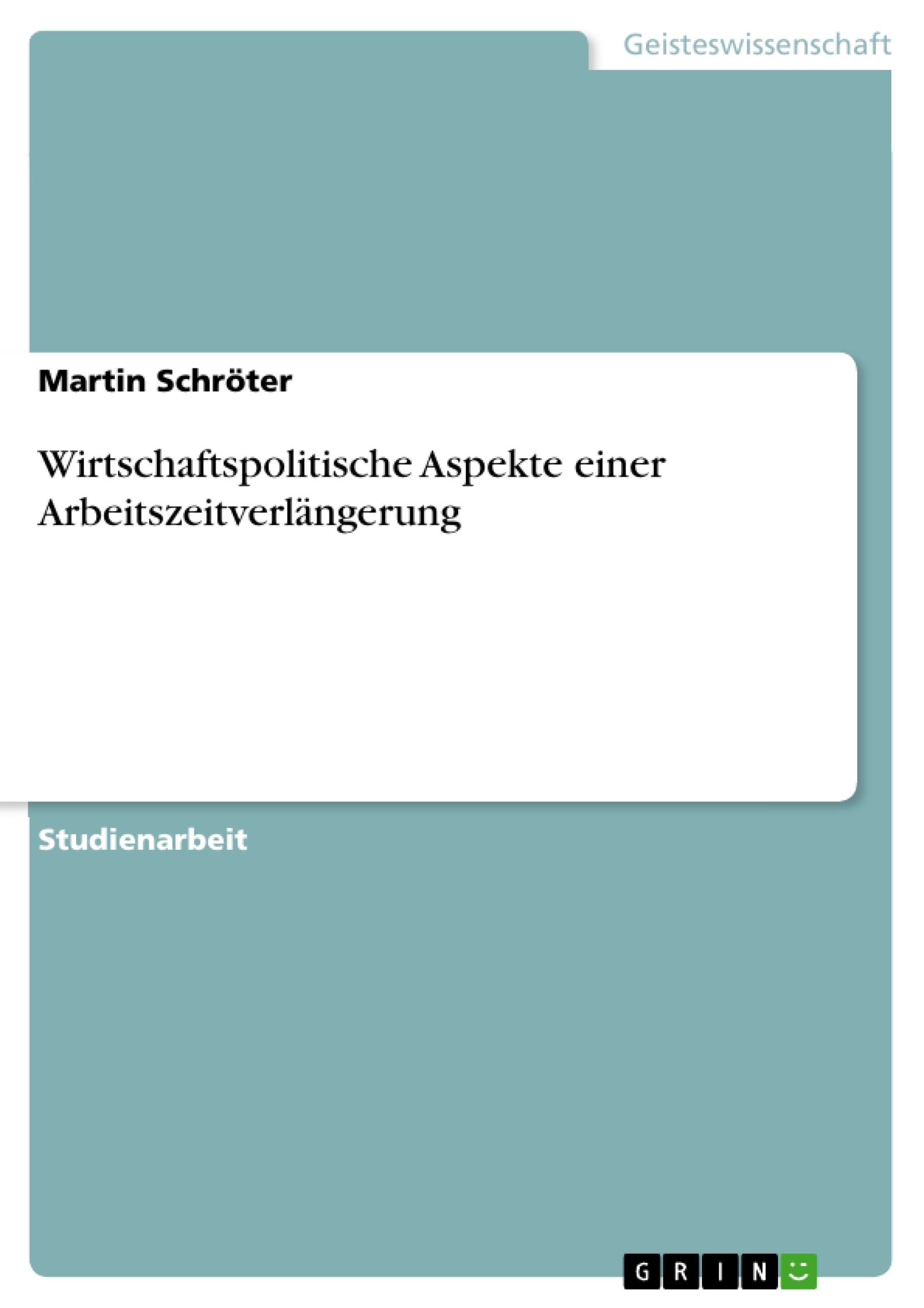Seit einigen Jahren ist in Deutschland eine neue Tendenz in der Arbeitsmarktdebatte zu beobachten. Nach einem jahrzehntelangen Trend hin zu einer Arbeitszeitverkürzung bis in die späten 1990er Jahre fordern Wirtschaftsvertreter und Arbeitgeber nun eine generelle Arbeitszeitverlängerung, um alten und neuen Herausforderungen entgegenzutreten. In der Wissenschaft wird inzwischen von einer „Kehrtwende in der Arbeitszeitpolitik“ gesprochen. Die permanent hohe Arbeitslosenquote und der zunehmend internationale Wettbewerbsdruck, vor Allem durch Konkurrenzmärkte aus osteuropäischen Staaten, seien die entscheidenden Gründe, warum es nötig sei, den Arbeitnehmern wieder mehr zuzumuten. Beispiele aus jüngster Vergangenheit scheinen diesen Trend zu bestätigen: Unternehmen wie Siemens und Daimler-Chrysler haben in ihren Tarifverhandlungen eine 40-Stunden- Woche durchgesetzt, der Staat Bayern Arbeitszeitverlängerung im öffentlichen Dienst eingeführt. Als Gegenleistung bekamen die Arbeitnehmer bei Siemens und Daimler-Chrysler den Erhalt ihrer Arbeitsplätze zugesichert sowie die Garantie, die Produktion nicht ins Ausland zu verlagern.
Die folgende Arbeit soll die Chancen und Probleme einer generellen Arbeitszeitverlängerung aufzeigen und die Frage beantworten, in wie weit Arbeitszeitverlängerung als wirtschaftspolitische Lösung in Betracht zu ziehen ist. Es soll die Frage beantwortet werden, ob so Arbeitsplätze erhalten und neue geschaffen werden können, um somit den Standort Deutschland, insbesondere in Hinblick auf aktuelle Mechanismen in der Wirtschaft („Outsourcing“), zu stärken.
Um die Argumentation der Arbeitgeberverbände sowie die Kritiken an der Arbeitszeitverlängerung nachvollziehen zu können, bedarf es zunächst einer Erläuterung wie sich die Arbeitszeiten in Deutschland entwickelt haben und wie sie sich aktuell darstellen. Im Hauptteil der Arbeit werden die Argumente, die für und gegen eine Arbeitszeitverlängerung von verschiedenen Seiten angeführt werden, ausführlich aufgezeigt. Im Fazit sollen die Ergebnisse zusammengefasst sowie bewertet und mögliche Alternativen aufgezeigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Arbeitszeiten
- 2.1 Historische Entwicklung der Arbeitszeiten in Deutschland
- 2.2 Heutige Arbeitszeiten in Deutschland
- 3. Argumente für eine Arbeitszeitverlängerung
- 4. Argumente gegen eine Arbeitszeitverlängerung
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Vor- und Nachteile einer generellen Arbeitszeitverlängerung in Deutschland. Sie analysiert die historische Entwicklung der Arbeitszeiten und die aktuelle Situation, um die Frage zu beantworten, ob eine Arbeitszeitverlängerung eine wirksame wirtschaftspolitische Lösung zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit darstellt.
- Historische Entwicklung der Arbeitszeiten in Deutschland
- Aktuelle Arbeitszeitstrukturen in Deutschland
- Argumente für eine Arbeitszeitverlängerung
- Argumente gegen eine Arbeitszeitverlängerung
- Wirtschaftspolitische Implikationen einer Arbeitszeitverlängerung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die aktuelle Debatte um die Arbeitszeitverlängerung in Deutschland ein. Sie beschreibt den Wandel von der jahrzehntelangen Tendenz zur Arbeitszeitverkürzung hin zur aktuellen Forderung nach einer Verlängerung, getrieben von hoher Arbeitslosigkeit und internationalem Wettbewerbsdruck. Die Arbeit skizziert ihre Zielsetzung: die Chancen und Risiken einer generellen Arbeitszeitverlängerung zu beleuchten und deren Eignung als wirtschaftspolitische Lösung zu bewerten, insbesondere im Hinblick auf Arbeitsplatzsicherung und die Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland.
2. Arbeitszeiten: Dieses Kapitel unterteilt sich in zwei Abschnitte. Zuerst wird die historische Entwicklung der Arbeitszeiten in Deutschland dargelegt, beginnend mit dem Kampf der Gewerkschaften für Arbeitnehmerrechte im 19. Jahrhundert. Es wird die zunehmende Akzeptanz der Arbeitszeitverkürzung als Mittel zur Arbeitsplatzsicherung im 20. Jahrhundert beschrieben, mit Beispielen wie der Durchsetzung der 35-Stunden-Woche durch die IG Metall. Der Abschnitt beleuchtet auch die parallel verlaufende Flexibilisierung der Arbeitszeiten. Der zweite Abschnitt konzentriert sich auf die aktuellen Arbeitszeiten. Er vergleicht tarifvertragliche Arbeitszeiten mit der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit und zeigt eine wachsende Diskrepanz auf, die den Trend zur Arbeitszeitverlängerung unterstreicht. Der Vergleich mit dem EU-Durchschnitt wird ebenfalls präsentiert.
3. Argumente für eine Arbeitszeitverlängerung: Dieser Abschnitt präsentiert die Argumente der Arbeitgeberverbände und Wirtschaftsinstitute, die eine Arbeitszeitverlängerung befürworten. Die Kritik an der bisherigen Arbeitszeitverkürzung wird dargestellt, die im Kontext des schwachen Wirtschaftswachstums, hoher Arbeitslosigkeit und starken internationalen Wettbewerbsdrucks als nicht mehr zeitgemäß gesehen wird. Es wird argumentiert, dass eine Verlängerung der Arbeitszeit die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands stärken und Arbeitsplätze sichern könne. Die Argumentation wird im Kontext der gesunkenen Produktivitätssteigerungen präsentiert.
4. Argumente gegen eine Arbeitszeitverlängerung: Dieser Abschnitt befasst sich mit der Gegenposition zur Arbeitszeitverlängerung. Er präsentiert kritische Argumente und Einwände gegen die von den Arbeitgeberverbänden vertretenen Positionen, und bietet somit eine differenzierte Perspektive auf die Problematik.
Schlüsselwörter
Arbeitszeitverlängerung, Arbeitszeitverkürzung, Arbeitsmarkt, Wirtschaftspolitik, Wettbewerbsfähigkeit, Arbeitslosigkeit, Deutschland, Gewerkschaften, Tarifverhandlungen, Outsourcing, Produktivität, Flexibilisierung.
FAQ: Arbeitszeitverlängerung in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Vor- und Nachteile einer generellen Arbeitszeitverlängerung in Deutschland. Sie analysiert die historische Entwicklung der Arbeitszeiten und die aktuelle Situation, um die Frage zu beantworten, ob eine Arbeitszeitverlängerung eine wirksame wirtschaftspolitische Lösung zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit darstellt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung der Arbeitszeiten in Deutschland, aktuelle Arbeitszeitstrukturen, Argumente für und gegen eine Arbeitszeitverlängerung sowie die wirtschaftspolitischen Implikationen einer solchen Maßnahme.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über die historische Entwicklung und die aktuelle Situation der Arbeitszeiten in Deutschland, ein Kapitel mit Argumenten für eine Arbeitszeitverlängerung, ein Kapitel mit Argumenten dagegen und ein Fazit. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche historischen Entwicklungen der Arbeitszeiten werden beleuchtet?
Das Kapitel über die Arbeitszeiten beschreibt den Kampf der Gewerkschaften für Arbeitnehmerrechte im 19. Jahrhundert, die zunehmende Akzeptanz der Arbeitszeitverkürzung im 20. Jahrhundert (z.B. die Durchsetzung der 35-Stunden-Woche) und die parallel verlaufende Flexibilisierung der Arbeitszeiten.
Wie wird die aktuelle Situation der Arbeitszeiten dargestellt?
Die Arbeit vergleicht tarifvertragliche Arbeitszeiten mit der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit und zeigt eine wachsende Diskrepanz auf, die den Trend zur Arbeitszeitverlängerung unterstreicht. Ein Vergleich mit dem EU-Durchschnitt wird ebenfalls präsentiert.
Welche Argumente werden für eine Arbeitszeitverlängerung angeführt?
Die Argumente der Arbeitgeberverbände und Wirtschaftsinstitute werden dargestellt. Es wird argumentiert, dass eine Verlängerung der Arbeitszeit die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands stärken und Arbeitsplätze sichern könne, insbesondere im Kontext des schwachen Wirtschaftswachstums, hoher Arbeitslosigkeit und starken internationalen Wettbewerbsdrucks sowie gesunkener Produktivitätssteigerungen.
Welche Gegenargumente werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert kritische Argumente und Einwände gegen die von den Arbeitgeberverbänden vertretenen Positionen, um eine differenzierte Perspektive auf die Problematik zu bieten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Arbeitszeitverlängerung, Arbeitszeitverkürzung, Arbeitsmarkt, Wirtschaftspolitik, Wettbewerbsfähigkeit, Arbeitslosigkeit, Deutschland, Gewerkschaften, Tarifverhandlungen, Outsourcing, Produktivität, Flexibilisierung.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit (im Fazit)?
Das Fazit der Arbeit wird im bereitgestellten Text nicht explizit genannt. Die Arbeit konzentriert sich auf die Darstellung der verschiedenen Argumente und Perspektiven zu diesem Thema.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Die Arbeit richtet sich an Personen, die sich akademisch mit dem Thema Arbeitszeitverlängerung in Deutschland auseinandersetzen möchten. Sie bietet einen umfassenden Überblick über die Debatte und die relevanten Aspekte.
- Citar trabajo
- Martin Schröter (Autor), 2009, Wirtschaftspolitische Aspekte einer Arbeitszeitverlängerung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/209602