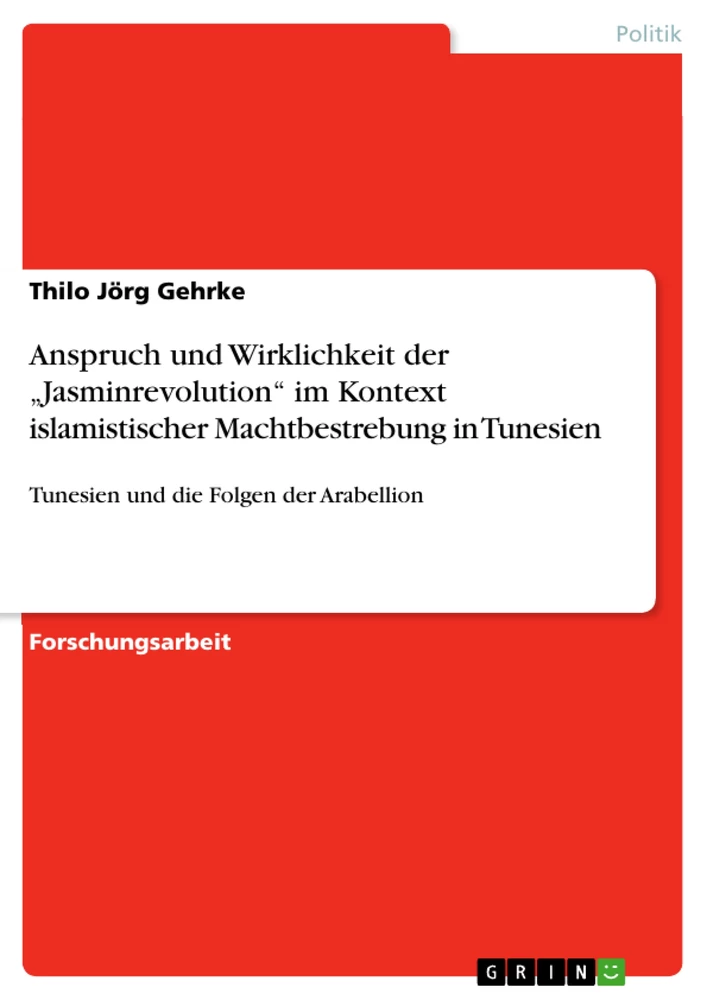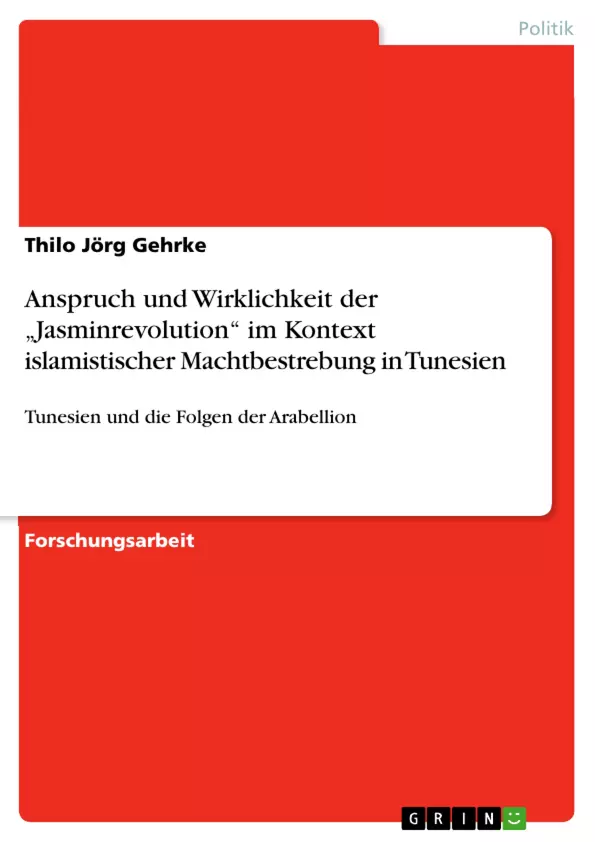Die autoritär regierten Staaten Nordafrikas und des Nahen Ostens galten bis 2010 als
nahezu „demokratieresistent“. Mit dem Verzweiflungsakt eines jungen tunesischen Arbeitslosen, der sich am 17. Dezember 2010 selbst verbrannte, wurden jene politische Umbrüche eingeleitet, die vor allem deshalb als „arabischer Frühling“ bezeichnet wurden, weil sie Hoffnung auf einen demokratischen Wandel weckten. Die in freien Wahlen siegreiche islamistische Ennahda-Partei befindet seit Oktober 2011 über den Aufbau der politischprogrammatischen Grundlagen des zukünftigen tunesischen Staates.
Der Autor hat im Jahr 2012 in tunesischen Großstädten recherchiert und Zeitzeugen befragt.
Im nachfolgenden wird dargelegt, wie sich Anspruch und Wirklichkeit der „Yasminrevolution“ in Tunesien im Kontext zu Demokratie und Freiheit darstellt.
Die Islamisten, jahrzehntelang unter dem autoritär regierenden ersten Präsidenten der unabhängigen Republik Tunesien Habib Bourguiba und seinem Nachfolger Ben Ali unterdrückt, versuchen den Wunsch der Bürger nach Demokratie und Freiheit für sich zu nutzen. Die sich anfangs gemäßigt gebende islamistische Regierungspartei versprach umfassende Reformen und ein Wirtschaftswunder in Form von 600000 neuen Arbeitsplätzen im wirtschaftlich am Boden liegenden Tunesien. Im Alltag versuchen jedoch islamistische Eiferer auf vielfältige Weise ihre Vorstellungen von einem „Gottesstaat“ in der Gesellschaft durchzusetzen. Die tödlichen Schüsse auf einen Oppositionspolitiker im Februar 2013 haben Tunesien endgültig in eine schwere politische Krise gestürzt.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Die Rückkehr der Islamisten in Tunesien
- Die „Jasminrevolution“ in Tunesien als Wegbereiter des „Arabischen Frühlings“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die „Jasminrevolution“ in Tunesien und deren Auswirkungen im Kontext islamistischer Machtbestrebungen. Sie analysiert die Diskrepanz zwischen dem Anspruch der Revolution auf Demokratie und Freiheit und der tatsächlichen Entwicklung im Land. Der Fokus liegt auf der Rolle der Islamisten, der sozialen und politischen Folgen des Umbruchs und den Herausforderungen für den Aufbau eines demokratischen Staates.
- Die Rolle der Islamisten nach der Revolution
- Der Vergleich zwischen Anspruch und Wirklichkeit der „Jasminrevolution“
- Die sozioökonomischen Ursachen der Proteste
- Die Folgen der Revolution für die politische Stabilität Tunesiens
- Die Herausforderungen des demokratischen Wandels in Tunesien
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Der Text untersucht die „Jasminrevolution“ in Tunesien und deren Folgen. Er analysiert die Rückkehr der Islamisten und die Diskrepanz zwischen dem Anspruch auf Demokratie und Freiheit und der Realität. Die Forschung basiert auf Recherchen und Interviews aus dem Jahr 2012. Die Arbeit fokussiert auf die Herausforderungen des demokratischen Übergangs in Tunesien im Kontext islamistischer Machtansprüche und der daraus resultierenden politischen und sozialen Krise.
Die Rückkehr der Islamisten in Tunesien: Dieses Kapitel beschreibt die Rückkehr der Islamisten nach Jahrzehnten der Unterdrückung unter Bourguiba und Ben Ali. Es schildert, wie die Islamisten den Wunsch nach Demokratie und Freiheit für ihre Zwecke zu nutzen versuchen, indem sie umfassende Reformen und Wirtschaftswachstum versprechen. Gleichzeitig wird die Bemühung islamistischer Eiferer gezeigt, ihre Vorstellungen eines „Gottesstaates“ durchzusetzen, was zu Konflikten und letztendlich zu einer schweren politischen Krise führt, beispielhaft dargestellt durch die Ermordung eines Oppositionspolitikers im Februar 2013. Der Kontrast zwischen den Versprechungen der Ennahda-Partei und dem Alltagserleben der Bevölkerung wird deutlich.
Die „Jasminrevolution“ in Tunesien als Wegbereiter des „Arabischen Frühlings“: Dieses Kapitel beleuchtet den Kontext der „Jasminrevolution“. Es beschreibt die autoritären Regime Nordafrikas und des Nahen Ostens und deren relative politische Stabilität trotz mangelnder Demokratie. Der Selbstmord eines jungen Tunesiers wird als Auslöser der Revolution dargestellt, die Hoffnung auf demokratischen Wandel weckte und andere arabische Staaten beeinflusste. Der Text analysiert die unterschiedlichen Folgen der Proteste in verschiedenen Ländern und betont die anhaltende soziale und politische Instabilität in Tunesien, trotz des Machtwechsels, die durch die hohen Arbeitslosenzahlen und die Auflösung staatlicher Strukturen verschärft wird. Die Ermordung des Oppositionspolitikers Chokri Belaid im Februar 2013 wird als Höhepunkt der sich zuspitzenden Krise dargestellt, welche die fragile Situation des neuen Staats unterstreicht.
Schlüsselwörter
Jasminrevolution, Arabischer Frühling, Tunesien, Islamisten, Ennahda-Partei, Demokratie, Freiheit, Scharia, soziale Ungerechtigkeit, politische Krise, Machtwechsel, sozioökonomische Probleme, Gewalt, Opposition.
Häufig gestellte Fragen zur Studie: Die Jasminrevolution in Tunesien
Was ist der Gegenstand dieser Studie?
Die Studie untersucht die Jasminrevolution in Tunesien und ihre Folgen, insbesondere im Hinblick auf die Rolle der Islamisten und die Herausforderungen beim Aufbau eines demokratischen Staates. Sie analysiert die Diskrepanz zwischen den Zielen der Revolution (Demokratie und Freiheit) und der tatsächlichen Entwicklung des Landes.
Welche Themen werden in der Studie behandelt?
Die Studie behandelt die Rückkehr der Islamisten nach der Revolution, den Vergleich zwischen Anspruch und Wirklichkeit der Jasminrevolution, die sozioökonomischen Ursachen der Proteste, die Folgen der Revolution für die politische Stabilität Tunesiens und die Herausforderungen des demokratischen Wandels im Land. Ein besonderer Fokus liegt auf der Rolle der Ennahda-Partei.
Welche Kapitel umfasst die Studie?
Die Studie gliedert sich in drei Kapitel: Eine Einführung, ein Kapitel zur Rückkehr der Islamisten nach Tunesien und ein Kapitel, das die Jasminrevolution als Wegbereiter des Arabischen Frühlings analysiert. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Betrachtung der jeweiligen Thematik.
Welche Rolle spielen die Islamisten in der Studie?
Die Rolle der Islamisten ist ein zentraler Aspekt der Studie. Sie analysiert, wie die Islamisten den Wunsch nach Demokratie und Freiheit für ihre Zwecke zu nutzen versuchten, ihre Bemühungen zur Durchsetzung ihrer Vorstellungen eines „Gottesstaates“ und die daraus resultierenden Konflikte, beispielhaft dargestellt am Mord an einem Oppositionspolitiker. Der Vergleich zwischen den Versprechungen der Ennahda-Partei und der Realität wird ebenfalls beleuchtet.
Wie wird die Jasminrevolution im Kontext des Arabischen Frühlings betrachtet?
Die Studie betrachtet die Jasminrevolution als Teil des Arabischen Frühlings und analysiert den Kontext autoritärer Regime in Nordafrika und dem Nahen Osten. Sie beleuchtet den Selbstmord eines jungen Tunesiers als Auslöser der Revolution und die unterschiedlichen Folgen der Proteste in verschiedenen Ländern. Die anhaltende soziale und politische Instabilität in Tunesien wird im Kontext von hoher Arbeitslosigkeit und dem Zerfall staatlicher Strukturen analysiert.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Studie?
Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die Jasminrevolution, trotz des anfänglichen Hoffnungsoptimismus auf demokratischen Wandel, zu einer komplexen und anhaltenden politischen und sozialen Krise in Tunesien geführt hat, die stark von der Rolle der Islamisten und sozioökonomischen Problemen geprägt ist. Die Ermordung des Oppositionspolitikers Chokri Belaid symbolisiert den Höhepunkt dieser Krise.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Studie?
Schlüsselwörter der Studie sind: Jasminrevolution, Arabischer Frühling, Tunesien, Islamisten, Ennahda-Partei, Demokratie, Freiheit, Scharia, soziale Ungerechtigkeit, politische Krise, Machtwechsel, sozioökonomische Probleme, Gewalt, Opposition.
Wann wurden die Recherchen für diese Studie durchgeführt?
Die Recherchen für diese Studie basieren auf Daten aus dem Jahr 2012.
- Quote paper
- Thilo Jörg Gehrke (Author), 2013, Anspruch und Wirklichkeit der „Jasminrevolution“ im Kontext islamistischer Machtbestrebung in Tunesien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/209736