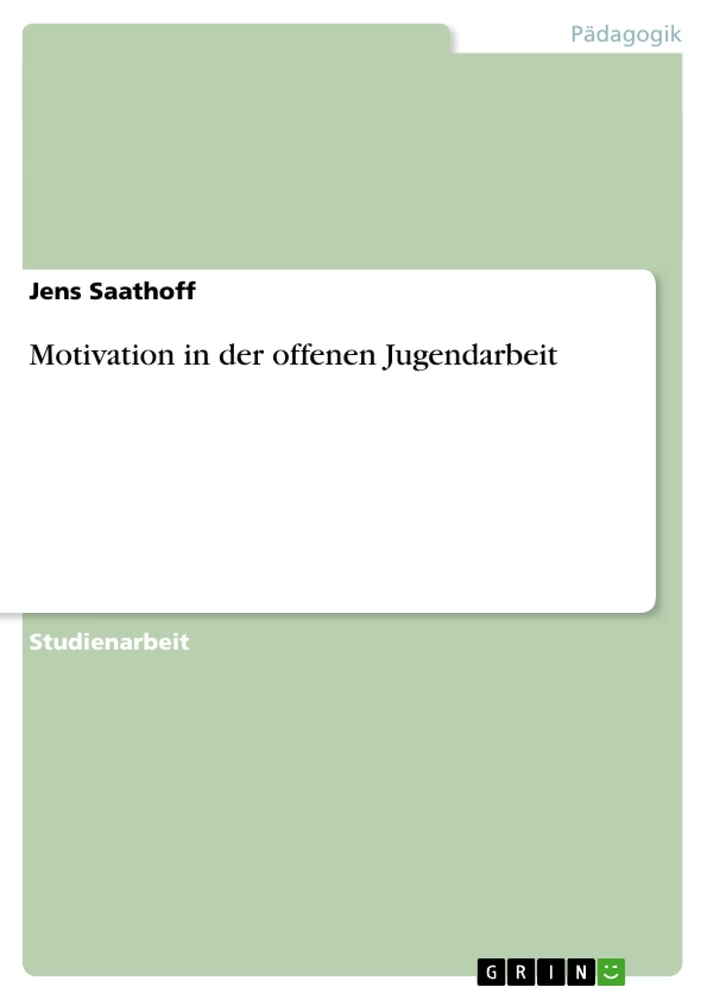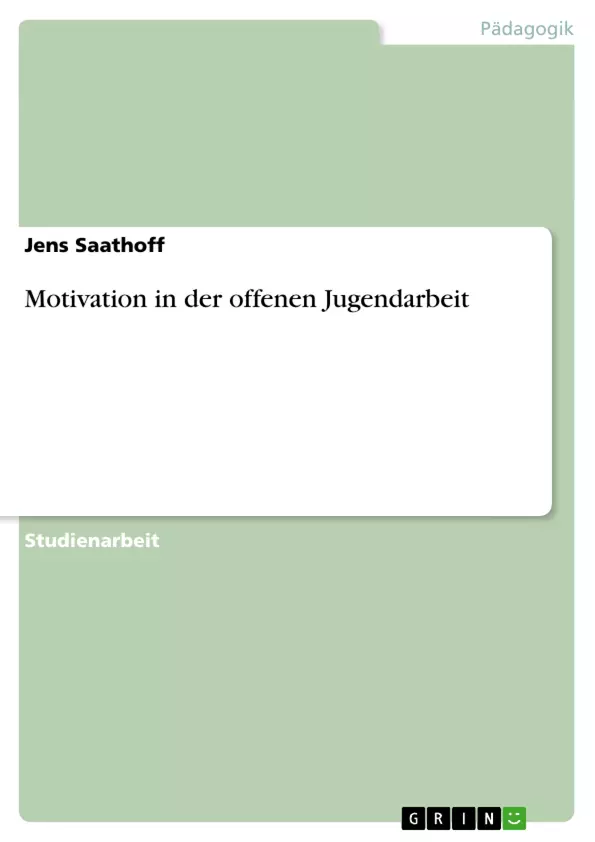Offene Jugendarbeit ist im Unterschied zur verbandlichen mit der Problematik konfrontiert, daß der Besuch ihrer Freizeitstätten zwar einen hohen Grad an Freiwilligkeit aufweist, jedoch die Aktivierung von Eigentätigkeit, die für pädagogische Arbeit notwendig ist, durch die gegebene Unverbindlichkeit erschwert wird.
Die Frage, ob in der offenen Jugendarbeit Bedingungen für die Motivation Jugendlicher geschaffen werden und somit auch Sozialisationsprozesse in Gang gesetzt werden können, ist mitentscheidend für die politische Bewertung. Eine Förderung der entsprechenden Einrichtungen oder ihre Verlagerung in den verbandlichen Bereich sind von einer solchen Bewertung abhängig.
Ziel dieser Arbeit ist es, zum einen Schwierigkeiten bei der Motivation Jugendlicher aufzuzeigen und zum anderen Bedingungen und Verfahren zu untersuchen, die eine Motivierung ermöglichen.
Inhalt
1. Einführung in das Thema
2. Merkmale offener Jugendarbeit
2.1 Aspekte der pädagogischen Arbeit
2.2 Unverbindlichkeit im Freizeitheim
2.3 Ausgangssituation und Erwartungshaltung der Besucher
3. Motivierung
3.1 Überbrückung von Unverbindlichkeit
3.2 Interessenorientierung der Angebote
3.3 Interessenverstärkung bis zur Eigentätigkeit
4. Bewertung
Literaturverzeichnis
1. Einführung in das Thema
Der Beweggrund für diese Arbeit besteht in der öffentlichen Diskussion um die Aufgabenbereiche der offenen Jugendarbeit in der BRD und ihre Möglichkeiten, diese wahrzunehmen. Strittig ist, ob und inwieweit städtische Freizeitheime mit einer prinzipiellen Einhaltung von Offenheit in der Lage sind, pädagogischen Einfluß auf Jugendliche auszuüben, oder ob sie nur die Funktion der sinnvollen Freizeitgestaltung erfüllen können. Besitzt diese Form der Jugendarbeit also erzieherische und sozialisatorische Wirkung, oder dient sie nur dazu, durch ein großes Freizeitangebot die Aktivitäten Jugendlicher von „der Straße“ in städtische Räume und unter die Aufsicht von Pädagogen zu verlagern? Letztere Funktion wird angesichts steigender Jugendkriminalität häufig von Eltern genannt; eine Einschätzung, die jedoch wohl eher der Angst vor negativen, außerhäuslichen Einflüssen auf die Kinder entspringt und nicht dazu angetan ist, das Engagement der Kinder in Jugendeinrichtungen zu unterstützen.[1]
Offene Jugendarbeit ist im Unterschied zur verbandlichen mit der Problematik konfrontiert, daß der Besuch ihrer Freizeitstätten zwar einen hohen Grad an Freiwilligkeit aufweist, jedoch die Aktivierung von Eigentätigkeit, die für pädagogische Arbeit notwendig ist, durch die gegebene Unverbindlichkeit erschwert wird.
Die Frage, ob in der offenen Jugendarbeit Bedingungen für die Motivation Jugendlicher geschaffen werden, und somit auch Sozialisationsprozesse in Gang gesetzt werden können, ist mitentscheidend für die politische Bewertung. Eine Förderung der entsprechenden Einrichtungen oder ihre Verlagerung in den verbandlichen Bereich sind von einer solchen Bewertung abhängig.
Ziel dieser Arbeit ist es, zum einen Schwierigkeiten bei der Motivation Jugendlicher aufzuzeigen und zum anderen Bedingungen und Verfahren zu untersuchen, die eine Motivierung ermöglichen. Dabei soll bedacht werden, daß Unverbindlichkeit überwunden und Eigentätigkeit aktiviert werden muß, um pädagogische Einflußnahme zu erreichen. Hierzu sollen zunächst einige Überlegungen zu pädagogischer Arbeit und ihren Aufgaben angestellt werden, denen eine Definition von Jugendarbeit zugrunde liegt. Anschließend werden Probleme bei der Motivierung dargestellt, die sich aus der Ausgangssituation im Freizeitheim und der Erwartungshaltung der Jugendlichen ergeben. Danach steht im Hauptteil der Versuch an, Ansätze zur Lösung des Motivierungsproblems zu beschreiben, was die Beschäftigung mit der Frage beinhaltet, wie Verbindlichkeit geschaffen werden kann. Eine zusammenfassende Bewertung der Ergebnisse bildet den Abschluß.
Die Arbeit stützt sich überwiegend auf Ausführungen Klemens Peterhoffs,[2] die dank seiner mehrjährigen Tätigkeit in der Münchner Jugendarbeit einen fundierten Bezug zur Praxis zu besitzen scheinen.[3]
2. Merkmale offener Jugendarbeit
2.1 Aspekte der pädagogischen Arbeit
Nach einer Definition, die in dem dieser Arbeit vorausgegangenen Seminar gegeben wurde, ist „Jugendarbeit Freiwilligkeit und Eigentätigkeit in Auseinandersetzung mit der Gesellschaft“.[4]
Die Auseinandersetzung mit der Gesellschaft bezieht sich auf zwei für die Entwicklung des Heranwachsenden grundlegende Komponenten. Zum ersten auf die Erziehung des Jugendlichen als ein „Hineinziehen“ in die konventionellen gesellschaftlichen Strukturen, und zweitens auf die Abgrenzung des Jugendlichen von diesen Strukturen als eine Form der Neuorientierung. Beide Aspekte sind bei der Entwicklung wichtig und haben einander zu ergänzen: Eine gewisse Anpassung junger Generationen an gegebene Werte und Normen ist erforderlich, um einen Erhalt der Gesellschaft zu gewährleisten. Ohne Neuorientierung verkäme Gesellschaft jedoch zu einem starren Schematismus und würde nicht die Möglichkeit zu erneuernden, eventuell verbessernden Prozessen in sich tragen.
Um sich gemäß dieser Komponenten zu entwickeln, sind bestimmte Lernprozesse der Jugendlichen notwendig.[5] Lernprozesse, die ihnen Klarheit über sich selbst und ihre Vorstellungswelt mit ihren Werten und Interessen verschaffen. Aber auch Lernprozesse hinsichtlich der Erwartungen, die andere an sie herantragen, und der Vorstellungen, wie eigene und Erwartungen von außen miteinander in Einklang gebracht werden können. Kommunikation und Erfahrungen mit anderen können entscheidende Hilfen für eine Identifikation mit bestimmten Vorstellungen - und somit für das Erlangen von Identität - bieten. Der Pädagoge hat die Aufgabe, die Jugendlichen dabei zu unterstützen, sich ihrer eigenen Interessen und Bedürfnisse klar zu werden. Weiterhin muß er sie gezielt motivieren, ihre den pädagogischen Zielsetzungen entgegenkommenden Interessen in eigentätige Aktivitäten umzusetzen, damit die geforderten Lernprozesse ermöglicht werden. Eigenständigkeit und Mündigkeit bilden letztlich das Ziel pädagogischer Arbeit.
[...]
[1] Vgl. Peterhoff: Motivationale Lernprozesse. S. 8
[2] Vgl. Peterhoff: Motivationale Lernprozesse.
[3] Ebd. S. 1-2.
[4] Proseminar: Methoden und Formen außerschulischer Jugendarbeit. Leitung: Dr. Albert Wunsch. Universität Düsseldorf. WS 1990/91.
[5] Vgl. Peterhoff: Motivationale Lernprozesse. S.27.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptproblem der Motivation in der offenen Jugendarbeit?
Das Hauptproblem ist die Unverbindlichkeit: Da der Besuch freiwillig ist, fällt es schwer, Jugendliche zu dauerhafter Eigentätigkeit zu motivieren.
Wie unterscheidet sich offene von verbandlicher Jugendarbeit?
Offene Jugendarbeit (z.B. Freizeitheime) ist niederschwelliger und weniger strukturiert als die Arbeit in festen Verbänden oder Vereinen.
Welche Rolle spielt der Pädagoge bei der Motivierung?
Der Pädagoge muss Interessen der Jugendlichen erkennen und sie dabei unterstützen, diese in eigenständige Lernprozesse und Aktivitäten umzusetzen.
Dient offene Jugendarbeit nur der Freizeitgestaltung?
Die Arbeit diskutiert, ob sie lediglich der Aufsicht dient oder tatsächlich sozialisatorische und erzieherische Wirkungen entfaltet.
Wie kann „Unverbindlichkeit“ überwunden werden?
Durch interessenorientierte Angebote und den schrittweisen Aufbau von Verbindlichkeit soll die Eigentätigkeit der Jugendlichen aktiviert werden.
- Citation du texte
- Dr. Jens Saathoff (Auteur), 1991, Motivation in der offenen Jugendarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/209846