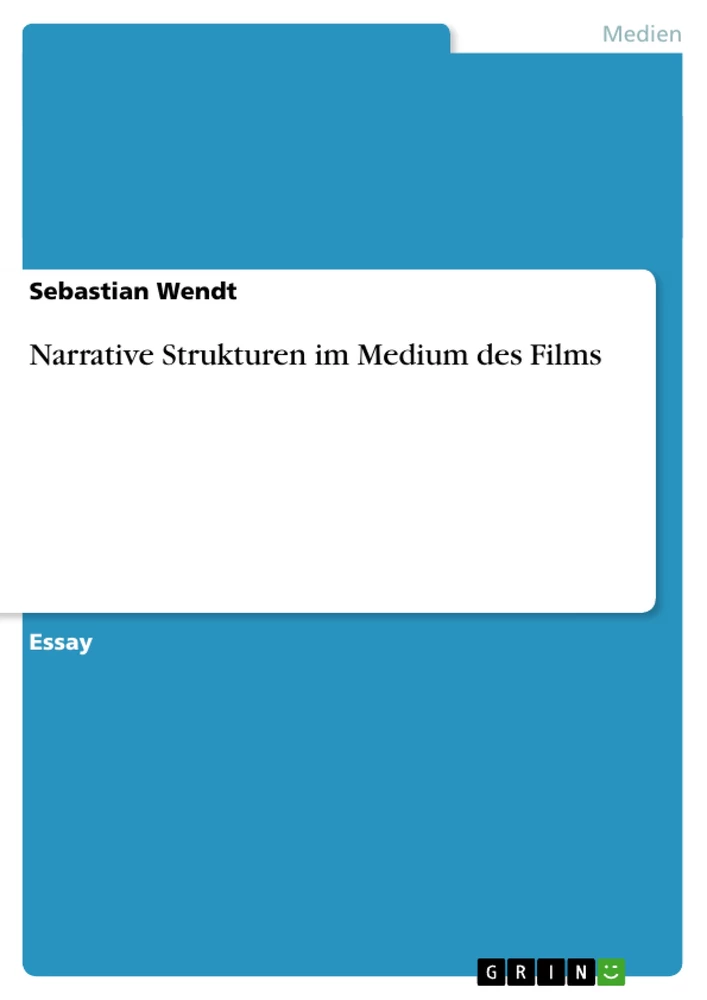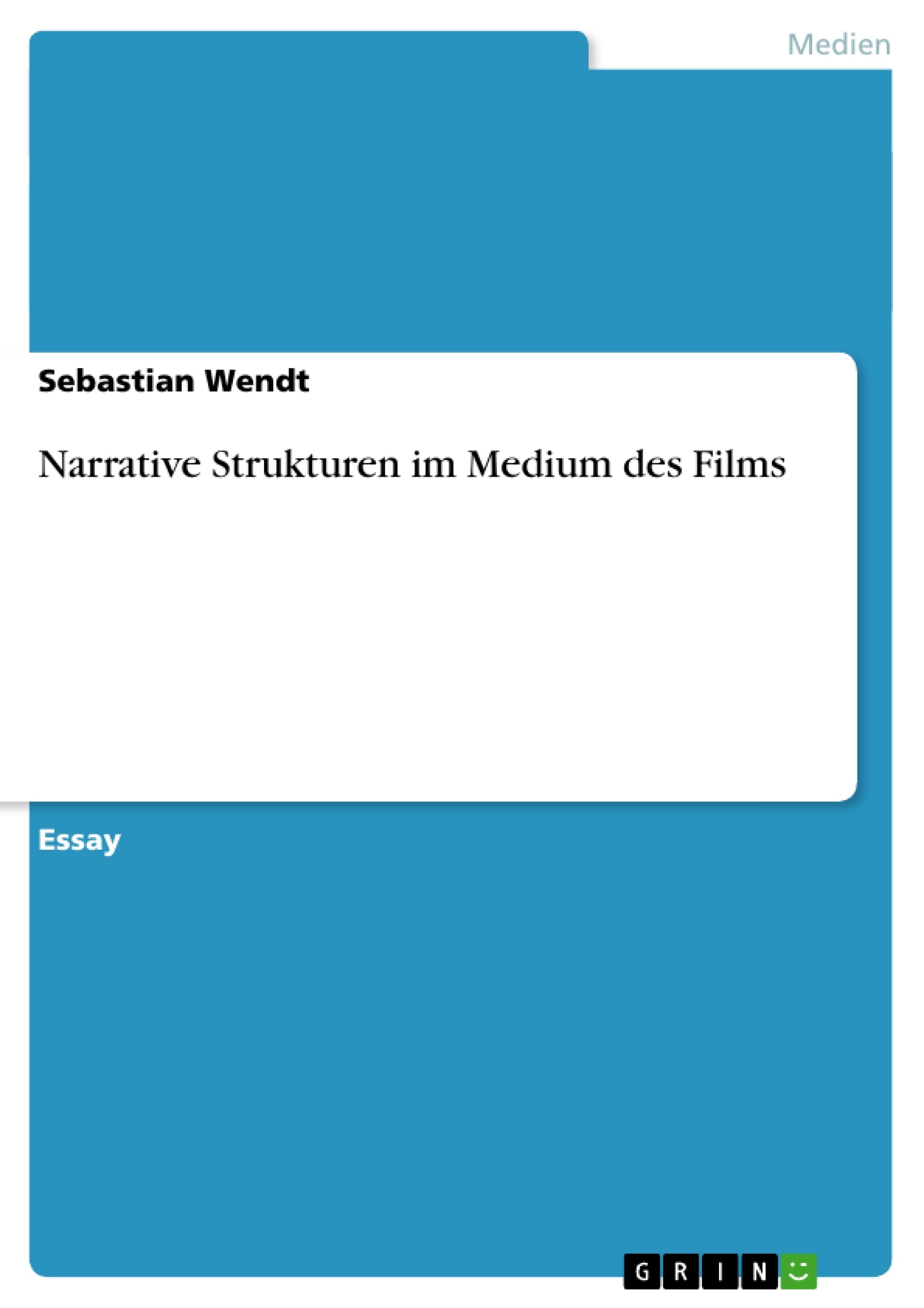Seit Jahrtausenden gehört das Erzählen zur menschlichen Kultur. Diese Form der Kommunikation hat sich mittlerweile so fest in unsere Lebenswelt eingebrannt, dass die zahlreichen erzählerischen Aspekte im Alltag und die große Reichweite von Erzähltechniken lange Zeit übersehen worden sind. Aktuell vollzieht sich jedoch in den Kulturwissenschaften ein 'narrative turn'. Der narratologische Paradigmenwechsel zeichnet sich besonders durch die Betonung einer erzählerischen Intermedialität aus. Die bedeutendste mediale Darstellungsform des 21. Jahrhunderts ist zweifelsohne der Film.
In diesem Essay wird das Filmmedium unter dem Aspekt einer audiovisuellen Erzählung betrachtet. Hierbei werden die narratologischen Konzepte, die ehemals für Erzähltexte gedacht waren, ihrem neuen Gegenstand zugeordnet, um filmische Erzählstrukturen transparent zu machen. Inwiefern konstituiert sich ein Film als Erzählung? Wer erzählt wem im Film etwas, wie und was erzählt der Film?
Kinematografischer Erzähler? - Narrative Strukuren im Medium des Films Sebastian Wendt
Seit Jahrtausenden gehört das Erzählen zur menschlichen Kultur. Spätestens die großen epischen Schöpfungsmythen, wie das Gilgamesch-Epos aus dem 2. Jahrtausend v. Chr., zeugen von der eigenartigen Kunst des „symbolische[n] Vergegenwärtigen des Abwesenden“[1]. Das Erzählen ist als gebräuchliche Form der Kommunikation mittlerweile so fest in unsere Lebenswelt eingebrannt, dass die erzählerischen Aspekte und die große Reichweite von Erzähltechniken schlechthin übersehen werden. Wie so oft im Leben hat auch hier die Gewöhnung an ein Phänomen die Verzerrung unserer Wahrnehmung zur Folge: Man übersieht, sprichwörtlich, den Wald seiner Bäume wegen. Trotz der langen Historie der menschlichen Erzähltradition, ist die Narratologie[2] als „Wissenschaft vom Erzählen“ also noch eine sehr junge Disziplin: Gerade einmal 100 Jahre zählt ihre Geschichte. Friedrich Spielhagen differenzierte in seinem Essay „Der IchRoman“ von 1883 als erster zwischen der Ich- und Er-Erzählform sowie zwischen dem realen Autor und einer konstruierten Erzählinstanz. Dieses Konzept wurde wenig später von Käte Friedemann weiterentwickelt, die sich in ihrer Dissertation „Die Rolle des Erzählers in der Epik“ (1910) ausführlich mit dem Vermittler der Erzählung befasste. Die Narratologie als „akademische“ Disziplin geht in ihrer heutigen Terminologie aber ganz wesentlich auf die Arbeiten von Franz K. Stanzel[3] und Gérard Genette[4] zurück. Ihre Systematisierungen trugen dazu bei, dass die Narratologie ein formales Analyseverfahren wurde, das die hermeneutische Deutung von Erzähltexten seit Jahrzehnten unterstützt. Diese auf das Medium von poetischen Texten begrenzte Auffassung von Erzählungen erfährt seit einigen Jahren eine Ausweitung. Die Narratologen Silke Lahn und Jan Christoph Meister sprechen in ihrem Standardwerk „Einführung in die Erzähltextanalyse“ (2008) sogar von einem narrative turn:
Seit dem narrative turn hingegen gilt: Nicht nur Dichter, sondern (fast) alle erzählen, sei es im Alltag, sei es in der Wissenschaft. Unfallberichte, Wetterprognosen, Wegbeschreibungen, Krankengeschichten, Laborberichte von physikalischen Experimenten und in einem abstrakten Sinne selbst mathematische Formeln besitzen in vielen Fällen eine mehr oder weniger ausgeprägte narrative Struktur.[5]
Der narratologische Paradigmenwechsel, der sich momentan in den Kulturwissenschaften etabliert, zeichnet sich durch die Betonung einer erzählerischen Intermedialität aus. „Die Funktion der Ereignisrepräsentation ist im Prinzip nicht vom Medium abhängig, sondern von der Form, in der etwas repräsentiert wird.“[6] So kann eine Geschichte auf vielfältige Art und Weise „erzählt“ werden. Denken wir zum Beispiel an Dostojewskis Roman „Der Idiot“. Diesen gibt es als lesbares Buch und auch als hörbare Audio-CD beim Audio-Verlag (2011) zu kaufen. Man kann die Story aber ebenfalls als Theaterstück (Schauspiel Köln 2012, Karin Henkel), als DVD (Rolf von Sydow 1968 [2010]) und bald auch als Oper (Nationaltheater Mannheim 2013, Mieczyslaw Weinberg) audiovisuell erleben.
Die bedeutendste mediale Darstellungsform des 21. jahrhunderts ist zweifelsohne der Film. Ob im klassichen Kinosaal, im HD-TV-Flatscreen zu Hause, auf youtube im Internet oder auf dem iPhone - audiovisuelle Repräsentationen gehören ganz fest zu unserem Alltag.[7] Monomediale Medien, wie Bücher, verlieren dagegen zunehmend ihre einstige Bedeutung. Die pessimistische These vom „Ende der [...] Erzählungen“[8] in der Postmoderne lässt sich auch umkehren, nämlich in die Richtung, „daß uns das neue Kino, weit davon entfernt, die Erzählung zu verlassen, verschiedene verzweigtere, komplexere Erzählungen beschert hat.“[9] Damit kann man das audiovisuelle Medium ,Film‘ auf der einen Seite als die gegenwärtig einflussreichste Erzählform charakterisieren, auf der anderen Seite aber auch als die bisher am wenigsten als Erzählung untersuchte Darstellungsart. Dabei hat die filmische Narration viele Gemeinsamkeiten mit der literalen (!) und theatralen Erzählung; aber sie hat auch einige medienspezifische Besonderheiten, die beim Rezipienten andere („neue“) interessante Reaktionen auszulösen vermag.
In diesem Essay wird das Filmmedium daher unter dem Aspekt einer audiovisuellen Erzählung betrachtet. Hierbei werden die narratologischen Konzepte, die ehemals für Erzähltexte gedacht waren, ihrem neuen Gegenstand zugeordnet, um filmische Erzählstrukturen transparent zu machen. Inwiefern konstituiert sich ein Film als Erzählung? Es geht explizit um die „vier großen narratologischen Fragen“: Wer erzählt wem im Film etwas, wie und was erzählt der Film?
wenn man das Erzählen als ubiquitäres Kommunikationsmittel nicht auf ein einzelnes Medium reduzieren kann, so muss man sich eine Definition überlegen, die alle o.g. Medien einschließt, ohne aber zu weitreichend zu sein und damit unbrauchbar zu werden: Alle Erzählungen haben zunächst einmal gemeinsam, dass sie bestimmte Informationen („Daten“) enthalten. Ein mathematisches Tafelwerk enthält auch eine Menge x von ,Da- ten‘ - der Unterschied zwischen der tabellarischen Formelsammlung und unserer Bestimmung vom Erzählen liegt in der Art und Weise wie die Informationen dem Rezipienten jeweils präsentiert werden. Nur eine Erzählung zeichnet sich dadurch aus, dass sie ihre nüchternen Daten in individueller Weise zeitlich verknüpft und inhaltlich anordnet, sodass eine unverwechselbar gestaltete Geschichte entsteht, die nacherzählbar und interpretierbar („sinnhaft“) ist. Nach Lahn und Meister ist diese Fähigkeit eine genuin „anthropologische Universalie“[10]. Auch die audiovisuelle Narration ist eine komplex verkettete Abfolge von einzelnen Bild- und Tonsequenzen, die thematisch aufeinander bezogen sind und nach einem festen Schema (z.B. Drehbuch) ablaufen. ,Erzählen‘ ist daher zunächst ein Prozess, der von drei verschiedenen Instanzen getragen wird: i) Jemand ist Autor, d.h. ideeller Urheber einer Erzählung, indem er den Verknüpfungsprozess nach seiner Maßgabe gestaltet. Beim klassischen Hollywood-Blockbuster muss man gar von einer kollektiven Autorschaft sprechen, denn an der Produktion ist in der Regel keine Einzelperson, sondern ein ganzes Filmteam mit mehreren hundert Personen beteiligt. ii) Im Erzählprozess gibt es immer mindestens einen Rezipienten[11], dessen sensorische Systeme die verketteten Informationen aufnehmen und verarbeiten. Erst durch das Publikum konstituiert sich der reine Daten-Input als (sinnvolle) Erzählung: die Geschichte wird im „Kopfkino“ mental repräsentiert. Jede Erzählung hat das Potential zur symbolischen Repräsentation und „Vergegenwärtigung des Abwesenden“[12]. Strukturalistisch gesehen ist die Narration daher ein Konglomerat von Zeichen, die auf etwas Externes verweisen. iii) In vielen Fällen können wir aber auch die Rolle eines narratologischen Agenten annehmen, indem wir eine bereits „vorhandene“ Geschichte, d.h. eine bereits geordnete Informationskette, weitervermitteln - z.B. wenn wir den Inhalt eines Kinofilms nacherzählen. Darüber hinaus ist jede Erzählung unter medialem Gesichtspunkt ein Produkt. Die Amerikanische Literaturwissenschaftlerin Susan Son- tag brachte den Produktcharakter mit der Unterscheidung von story versus information auf den Punkt[13]: Wie ein ,Produkt‘ zeichnet sich die erzählte story dadurch aus, dass sie abgeschlossen und „fertig“ ist. Im Gegensatz dazu ist die information nur ein fragmentarisches Datenbündel ohne Anfang, Mitte und Ende.
Der Erzählcharakter der Medien ist von Fall zu Fall mehr oder weniger offensichtlich zu erkennen. Eine explizite Erzählung liegt beispielsweise dann vor, wenn im Roman eine Person eine Geschichte aus ihrer eigenen Perspektive schildert (,Ich-Erzähler‘) oder wenn aus der Sicht einer Figur erzählt wird (‚Er-Erzähler‘). Diesen literarischen „Goldstandard“ gibt es auch im Film – wenngleich nur sehr selten. Ein Beispiel ist die Comedy-Serie „How I Met Your Mother“ (US 2005, PAMELA FRYMAN). Hierin erzählt ein Vater im Jahre 2030 seinen Kindern aus der Retroperspektive, wie er seine Frau – die Mutter der Kinder – kennenlernte. Der Zuschauer nimmt den Erzählcharakter gleich am Anfang einer jeden Sendung wahr, da der Vater als expliziter Erzähler auftritt und die Kinder die Funktion von Zuhörern haben. In diesem Fall liegt ein sogenannter overt narrator vor. Doch der Großteil der Filme hat scheinbar keinen solchen offenkundigen Erzähler; ja man hat oft den Eindruck, dass sich die meisten Filme irgendwie „selbst erzählen“. Diese häufige Machart audiovisueller Medien soll im Folgenden nun näher untersucht werden. Wie schafft es ein Film, eine Geschichte implizit zu vermitteln, d.h. ohne auf die „Stimme“ eines overt narrator angewiesen zu sein? Betrachten wir dazu zunächst einige medienspezifische Besonderheiten:
[...]
[1] Lahn/Meister (2008), S. 7.
[2] Der Begriff ,Narratologie‘ wurde sogar erst 1969 vom Strukturalisten Tzvetan Todorov als Wissen schaft von der formalen Analyse von Erzähltexten entwickelt. Siehe hierzu: Todorov (1969).
[3] Vgl. Stanzel (1964).
[4] Vgl. Genette (1972).
[5] Lahn/Meister (2008), S. 1.
[6] Ebd., S. 5.
[7] Vgl. die Studie „Television 2012 - International Key Facts“ [IP/RTL Group 2012]: Demnach verbrach ten die Deutschen im Jahre 2011 durchschnittlich 230 Minuten pro Tag vor dem Fernseher - mit steigender Tendenz. Gleichzeitig nahm auch der Internetkonsum zu.
[8] Lyotard (1989), S. 226.
[9] Metz (1966) zit. n. Schweinitz (1999), S. 84.
[10] Lahn/Meister (2008), S. 2.
[11] Hier sei angemerkt, dass Autor und Rezipient natürlich auch identisch sein können: Ein anschauliches Beispiel ist eine Person, die ein Tagebuch führt. In diesem Narrationsmedium erzählt der Autor eine Geschichte, wobei er gleichzeitig der primäre Adressat ist. Ein anderes Beispiel ist das Selbstgespräch.
[12] Lahn/Meister (2008), S. 7.
[13] Vgl. Sontag (2007).
- Quote paper
- Sebastian Wendt (Author), 2013, Narrative Strukturen im Medium des Films, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/209965