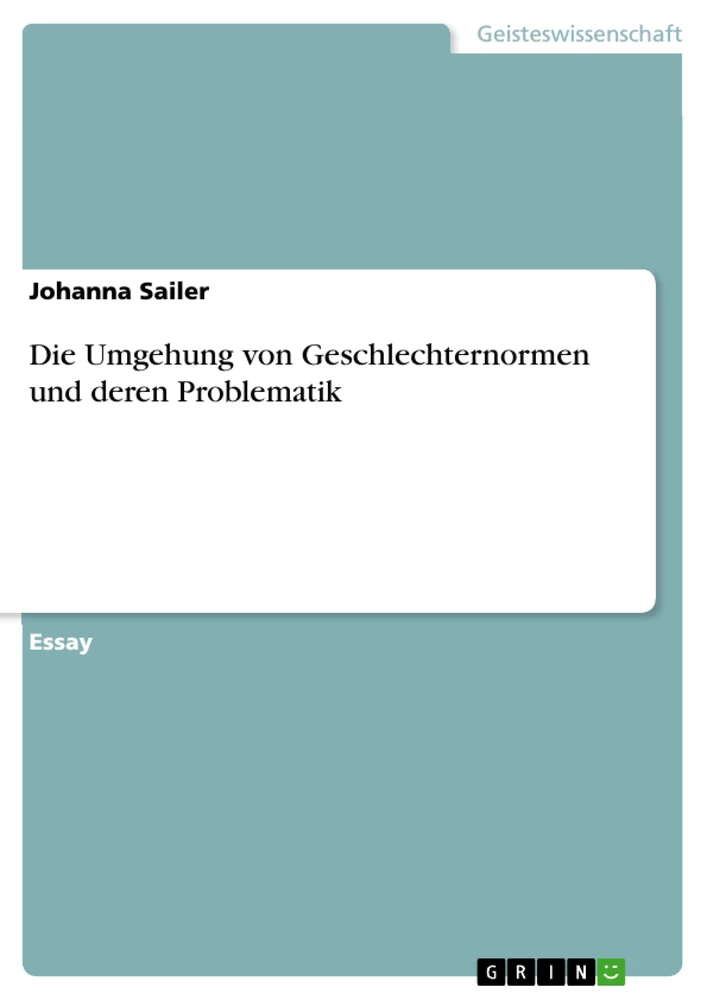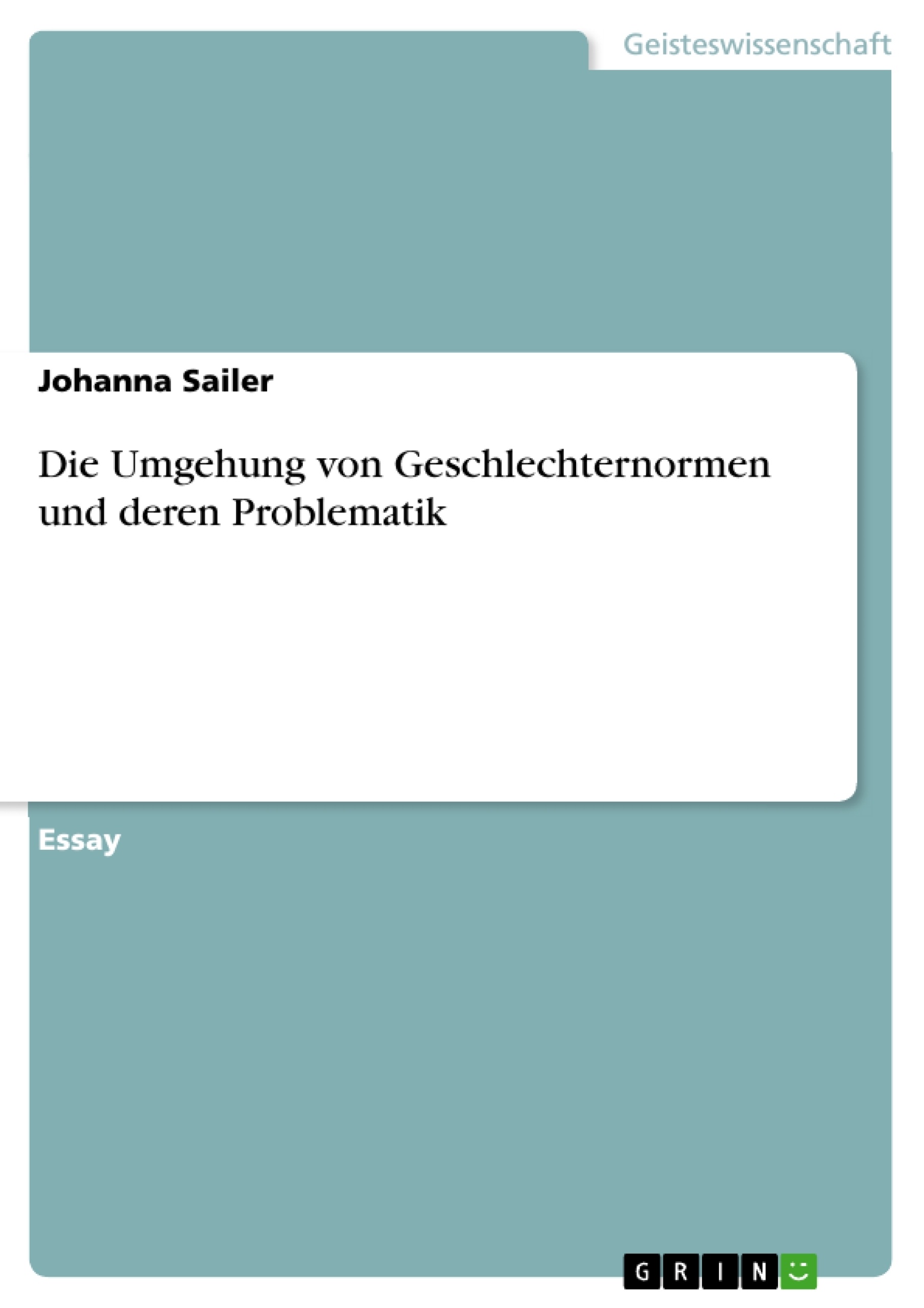Die Geschlechterforschung beschäftigt sich seit den 90'er Jahren intensiv mit der Frage, inwieweit Geschlechternormen unsere sozialen Beziehungen beeinflussen.1
Gesellschaftliche Normen geben uns Orientierung und erleichtern das Zusammenleben von Menschen. „Das Geschlecht, nicht die Religion, ist das Opium des Volkes“2, meint der Soziologe Erving Goffman und umschreibt damit die beruhigende Wirkung, die das Gefühl von Dominanz oder Unentbehrlichkeit auf den Menschen haben kann und welches durch Geschlechternormen möglich ist. Sie führen auch zu Grenzziehungen, die vor allem zu Ungunsten der Frau ausfallen und eine Ungleichberechtigung im öffentlichen und privaten Leben bewirken.
Eine private Geschlechter-Beziehung unterscheidet sich dabei von einer „Arbeitsbeziehung“ insbesondere durch die intime Bindung, die dazu führt, dass Geschlechterunterschiede verharmlost werden, während sich im Berufsalltag die Geschlechter im Konkurrenzkampf gegenüberstehen.3
Doch warum gelingt ein Zusammenleben von Mann und Frau jenseits der Geschlechternormen auch im eigenen Haushalt meist nicht?4 Was hindert uns daran, eigene Konzeptionen zu entwickeln, die die Arbeitsteilung in Paarbeziehungen regeln, wenn es uns schon im Berufsleben nicht gelingt Gleichberechtigung zu bewirken?
Die Geschlechterforschung beschäftigt sich seit den 90'er Jahren intensiv mit der Frage, inwieweit Geschlechternormen unsere sozialen Beziehungen beeinflussen.[1] Gesellschaftliche Normen geben uns Orientierung und erleichtern das Zusammenleben von Menschen. „Das Geschlecht, nicht die Religion, ist das Opium des Volkes“[2], meint der Soziologe Erving Goffman und umschreibt damit die beruhigende Wirkung, die das Gefühl von Dominanz oder Unentbehrlichkeit auf den Menschen haben kann und welches durch Geschlechternormen möglich ist. Sie führen auch zu Grenzziehungen, die vor allem zu Ungunsten der Frau ausfallen und eine Ungleichberechtigung im öffentlichen und privaten Leben bewirken.
Eine private Geschlechter-Beziehung unterscheidet sich dabei von einer „Arbeitsbeziehung“ insbesondere durch die intime Bindung, die dazu führt, dass Geschlechterunterschiede verharmlost werden, während sich im Berufsalltag die Geschlechter im Konkurrenzkampf gegenüberstehen.[3]
Doch warum gelingt ein Zusammenleben von Mann und Frau jenseits der Geschlechternormen auch im eigenen Haushalt meist nicht?[4] Was hindert uns daran, eigene Konzeptionen zu entwickeln, die die Arbeitsteilung in Paarbeziehungen regeln, wenn es uns schon im Berufsleben nicht gelingt Gleichberechtigung zu bewirken?
Zuallererst scheint es notwenig, zu erklären, was Geschlechternormen sind, warum sie entstehen und wie sie unser Sozialverhalten verändern.
In „The arrangement between the sexes“ beschreibt Goffman bereits 1977 das Geschlecht als eine soziale Konstruktion.[5]
Demnach verändert eine „soziale Situation“[6] das Verhalten der Personen, weil in ihr kulturelle Geschlechternormen zum Tragen kommen.
In den Wissenschaften ist es Common Sense, biologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen als Ursache für deren Sozialverhalten anzugeben. Laut Goffman sind die biologischen Unterschiede zwischen ihnen aber zu gering: Gender- Eigenschaften werden vielmehr durch eine Zuordnung in „Geschlechterklassen“ institutionell geprägt und verstärkt.[7]
Die Geschlechterklasse ist bei Goffman eine soziologische Kategorie und bezieht sich auf das „Gender“ des Individuums, das durch Erziehung erworben wird.[8] Sie wird also kulturell und nicht biologisch gesteuert.
In der westlichen Kultur besteht die Vorstellung von der Existenz zweier Geschlechterklassen, wobei die Klasse der Frauen benachteiligt wird, da die Gesellschaft einer patriarchalen Ordnung unterliegt.[9]
Um näher zu bringen, mit welcher Begründung die Frau als das schwache Geschlecht fungiert, nutzt Goffman den Begriff der „institutionellen Reflexivität“: Tatsachen werden in die Umwelt hineinprojeziert oder aus der Umwelt herausgefiltert, um Geschlechterunterschiede bedeutsam zu machen.[10]
Das Stillen eines Säuglings zählt beispielsweise aus biologischen Gründen zum Aufgabenbereich der Frau.[11]
Diese biologische Tatsache wird herausgefiltert, um die Verantwortung der Frau für Haushalts- und Familienaufgaben und ihre Nichteignung für eine Karrierelaufbahn zu rechtfertigen. Andererseits werden ihr Charaktereigenschaften wie Fürsorglichkeit und Selbstlosigkeit zugeschrieben, die sie für bestimmte Aufgaben im Berufs- und Privatleben prädestinieren (und für andere hemmen).
Die Betrachtung des Arbeitsmarktes verdeutlicht weitere Fälle institutioneller Reflexivität: Männer gelten beispielsweise als mathematisch begabter, während Frauen ihnen sprachlich überlegen sein sollen. Diese Annahme lässt sich biologisch nicht belegen[12], sondern nur kulturell: In der Informatik waren 2005 in Deutschland 15% der
Studienanfänger weiblich, wogegen im Wintersemester 2003/2004 der Anteil der Studienanfängerinnen in der Germanistik mehr als 75% ausmachte.[13] Auch wenn in der Mathematik mit einem Frauenanteil von 50% bei den deutschen Studienanfängern 2004 bereits ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis herrschte, waren gleichzeitig nur 7% der Professuren von Frauen besetzt.[14]
Einerseits finden Angleichungen statt, andererseits hält die Diskriminierung der Frau scheinbar an, indem Fächergruppen, die in unserer Gesellschaft höheren Prestige genießen von Männern besetzt werden, oder zumindest die höheren Karrierestufen für sie reserviert sind.
Die Statistiken sind eine Folge der institutionell vermittelten Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit. Kulturelles wird zur Natur gemacht, indem es von Kindheit an als etwas Natürliches anerzogen wird.[15] In diesem Fall ist der Glaube, dass es natürlich sei, wenn die Tochter in Mathematik schlecht abschneidet, während der Sohn Schwierigkeiten hat Sprachen zu lernen, der Grund dafür, dass es natürlich wird. Nicht die Tatsache, sondern der Glaube an die Tatsache bewirkt ein bestimmtes Verhalten.
Doch was ist uns daran gelegen, Geschlechterunterschiede zu legitimieren?
Goffmans These lautet: Nur aufgrund der kulturell vermittelten Geschlechtsidentität finden sich Männer und Frauen in Paarbeziehungen zusammen; Sie sind motiviert ein „Arbeitsverhältnis“ einzugehen, durch das sie unangenehmer Arbeit entgehen und Anerkennung für ihre Leistung erhalten.[16]
[...]
[1] Vergl. Koppetsch,S.172.
[2] Goffman, S.131.
[3] Vergl. Koppetsch., S.180.
[4] Vergl. ebd., 173.
[5] Vergl. Goffman, S.108f.
[6] „Unter einer sozialen Situation verstehe ichjeden räumlichen Schauplatz, auf dem sich eine eintretende Person der unmittelbaren Gegenwart einer oder mehrerer anderer ausgesetzt findet; und unter einer Zusammenkunft alle dort anwesenden Personen, auch wenn sie nur durch die Prinzipien der höflichen Unaufmerksamkeit oder, noch weniger, der gegenwärtigen Verletzbarkeit miteinander verbunden sind.“ (Goffman, S.106)
[7] Vergl. Goffman, S.107.
[8] Vergl.ebd., S.109.
[9] Vergl. ebd., S. 116fff.
[10] Vergl. ebd., S.128.
[11] Vergl. ebd.
[12] Vergl. Zittlau, unter: http://www.welt.de/wissenschaft/article1965627/Maenner und Frauen ticken aehnlicher als gedach t.html (abgerufen am 09.03.2011).
[13] Vergl.Grasberger, unter http://www.focus.de/wissen/wissenschaft/uni-ranking-und150-teil-sechs- und150-germanistik-anglistik-geschichte-lesen-lesen-lesen_aid_198650.html (abgerufen am 09.03.2011).
[14] Vergl.: Blunck, S.821.
[15] Vergl.Goffman, S.129.
[16] Vergl. Goffman, S.128f.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Geschlechternormen laut der Geschlechterforschung?
Geschlechternormen sind gesellschaftliche Vorgaben, die soziale Beziehungen beeinflussen und Orientierung bieten. Sie können jedoch auch zu Grenzziehungen und Ungleichberechtigung führen, oft zu Ungunsten der Frau.
Welche Rolle spielt das Geschlecht nach Erving Goffman?
Goffman bezeichnet das Geschlecht als „Opium des Volkes“ und beschreibt es als soziale Konstruktion, die ein Gefühl von Dominanz oder Unentbehrlichkeit vermittelt.
Was ist der Unterschied zwischen privaten Geschlechter-Beziehungen und Arbeitsbeziehungen?
Private Beziehungen zeichnen sich durch eine intime Bindung aus, in der Unterschiede oft verharmlost werden, während im Berufsalltag eher ein Konkurrenzkampf zwischen den Geschlechtern herrscht.
Was bedeutet der Begriff „institutionelle Reflexivität“?
Dieser Begriff beschreibt, wie Tatsachen aus der Umwelt gefiltert oder in sie hineinprojiziert werden, um Geschlechterunterschiede künstlich bedeutsam zu machen, wie etwa die Zuweisung von Haushaltsaufgaben aufgrund biologischer Merkmale.
Sind Geschlechterunterschiede im Sozialverhalten biologisch bedingt?
Laut Goffman sind biologische Unterschiede zu gering, um das Sozialverhalten zu erklären; vielmehr werden Gender-Eigenschaften durch die Zuordnung zu kulturell geprägten „Geschlechterklassen“ institutionell verstärkt.
Wie beeinflussen kulturelle Bilder die Berufswahl?
Statistiken zeigen, dass bestimmte Fachgruppen (z. B. Informatik vs. Germanistik) stark geschlechtsspezifisch besetzt sind, was oft auf anerzogenen Glauben an „natürliche“ Begabungen statt auf biologische Fakten zurückzuführen ist.
- Quote paper
- Johanna Sailer (Author), 2011, Die Umgehung von Geschlechternormen und deren Problematik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210004