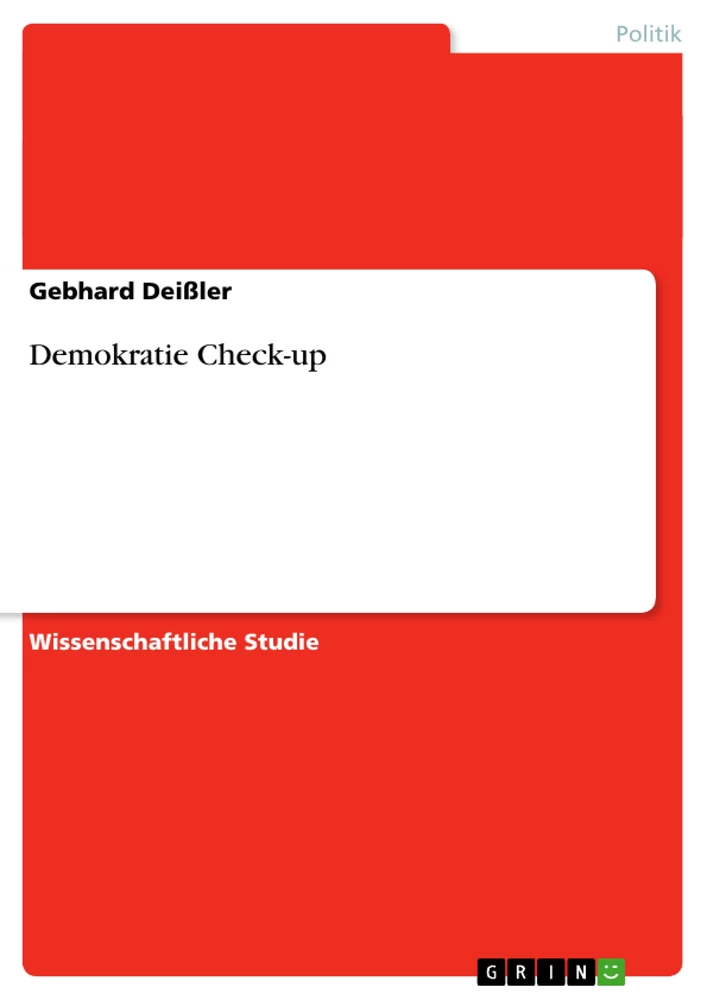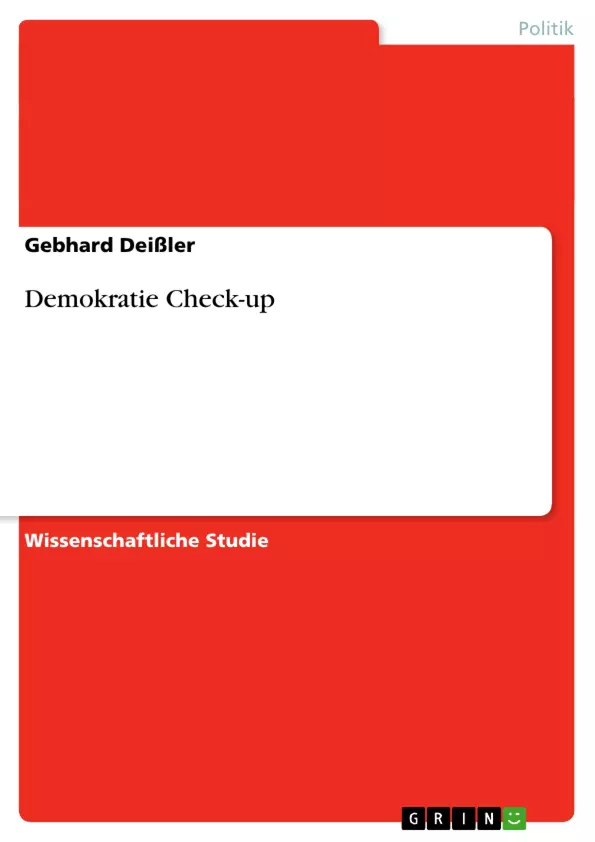...Die nationalkulturelle Geschichte kann als ein Kampf um die Integration des Dilemmas Macht versus Demokratie betrachtet werden. Eine Gesellschaft mag bezüglich der Lösung eine generell vorherrschende Tendenz für die Integration dieses Dilemmas entwickelt haben. Dann könnte man von einer stereotypen Lösungstendenz sprechen. Faktisch scheint es aber eher so zu sein, dass man - da es sich um eine kulturelle Prädisposition handelt - von Prototypen, das heißt, von verschiedenen Graden der Ausprägung des vermeintlichen Stereotyps hinsichtlich der Lösung des Dilemmas innerhalb derselben Gesellschaft ausgehen kann...
Macht versus Demokratie
Obstina initiis!
(Lateinischer Spruch)
Wehret den Anfängen!
(Deutsche Übersetzung)
Kaum ein Land der Welt hat für sein Ringen und seinen vielfältigen innen- und außenpolitischen Kampf um und für seine demokratische Identität einen höheren Preis bezahlt als Deutschland. Die damit verbundenen Werte sind Einigkeit und Recht und Freiheit, die unsere Nationalhymne als des deutschen Glückes Unterpfand besingt. Deshalb werden die Deutschen sich dieses kostbare Gut unter keinen Umständen aus dem Händen nehmen und entreißen lassen. Sie werden sich bewehren, um es als ihren geschichtlicher Juwel zu schützen, selbst wenn und gerade weil er noch nicht zu vollendetem Glanz geschliffen, makellos erstrahlt. Doch manche Kräfte würden diesen Kronjuwel gerne an sich reißen und korrumpieren.
Die innenpolitischen Sachverhalte sollen hier schwerpunktmäßig betrachtet werden, denn die außenpolitischen sind im wesentlichen eine internationale Manifestation derselben.
Betrachtet man die gegenwärtige Lage der Welt, so stellt man fest, dass es prinzipiell zwei Tendenzen für die Regulierung sozialer Beziehungen gibt, nämliche autoritäre und demokratische. Dieser Dichotomie entsprechen Entwicklungsphasen in der Zeit und im Bewusstsein von archaischen hin zu modernen Gesellschaften. Dieses Dilemma ist sowohl zeitlicher, räumlicher, als auch individual und kollektiv psychologischer Natur. Jeder individuelle und kollektive gesellschaftliche Akteur muss dieses Dilemma stets lösen. Und die Art, wie er es löst, macht ihn, gleich wo er sich befindet, zu einem alten, von Machtmotiven gesteuerten Menschen, der den demokratischen Pol des Machtpols negiert oder aber zu einem sozial weiterentwickelten Menschen, der den komplementären demokratischen Pol in sein Verhalten miteinbeziehen kann. Der alte Mensch ist ein Einprinzip Wesen, das alles dem Machtprinzip opfert. Es kennt nur seine Interessen, von denen sein ganzes Bewusstsein erfüllt ist und kann keine weiteren inneren Räume erschließen und sozial nutzen, um die Interessen der Mitmenschen darin zu beherbergen und zu berücksichtigen.
Jedes Individuum und jede Gesellschaft befindet sich in seiner Entwicklung irgendwo auf dem Macht–Demokratie Kontinuum und muss stets dieses sozialpsychologische Dilemma integrieren. Wird es eindimensional in einem Nullsummenspiel, zugunsten des Machtprinzips, interpretiert und gelöst, so befinden wir uns in Gegenwart des gesellschaftssteuernden Machtprinzips, wird es integriert, so befindet man sich in Gegenwart eines sozialpsychologischen Nicht-Nullsummenspiels, in dem das demokratische Prinzip, das über die Eindimensionalität des Bewusstseins hinausgeht, zum Zuge kommt. Wird es eindimensional zugunsten des Demokratieprinzips interpretiert, so zeugt dies jedoch nur von einer sozialpsychologischen Höherentwicklung, wenn das Demokratieverständnis keine mechanische Gleichmacherei aller, ohne Rücksicht auf partikularistische Erfordernisse ist. Schließlich ist der Mensch, nicht zuletzt aufgrund seiner singulären Ebenbildlichkeit mit seinem Schöpfer und seiner beobachtbaren biologischen Variabilität, kein substituierbares statistisches Durchschnittswesen.
Das universalistische Demokratieprinzip muss also seinerseits, ohne persönlichen Machtagenden zu folgen, noch den für dieses komplementären Pol des legitimen Partikularismus integrieren. Erst dann entsteht eine reifere Form des Demokratieverständnisses.
Betrachtet man die kulturelle Landkarte der Welt unter dem Blickwinkel der interkulturellen Forschung, so stellt man fest, dass es Kulturen gibt, die im Hinblick auf diese fundamentale Dilemmalösung weiter fortgeschritten sind als andere. Die Gesellschaften mit niedrigerer Machtdistanz gehören dazu, während jene am entgegengesetzten Pol des Machtdistanzkontinuums noch in archaischeren mentalen Strukturen, Einstellungen, Verhaltensweisen und Prozessen zu verharren scheinen. Der gegenwärtige arabische Frühling, beispielsweise, kann als der kulturhistorisch, politische Versuch gewertet werden, dieses Dilemma zu integrieren.
In Deutschland ist man davon ausgegangen, dass der Faschismus mit seinen Folgen und insbesondere die Antwort darauf seitens der weiterentwickelten demokratischen internationalen Gemeinschaft, ein Zäsur zwischen diesen beiden individuell, wie sozialpsychologischen Modi darstellen würde. Formal ist dies durchaus gelungen. Man hat eine Verfassung auf die Beine gestellt, die die Demokratie von ihrer edelsten Seite zur Geltung bringt. Doch es ist nicht gelungen diese demokratische Verbalhülse mit Substanz zu erfüllen und man tut sich immer noch schwer dabei. Die Diskrepanz zwischen den Worten und der realen menschlichen Psyche kann meilenweit auseinanderklaffen, denn der formale Anspruch des sozialpsychologischen Sonntagsgesichts einer Nation muss auch im Ernstfall einlösbar sein, um kein Etikettenschwindel in den Augen einer diese Prozesse angesichts der deutschen Geschichte zurecht argwöhnisch beobachtenden internationalen Gesellschaft zu sein, die historisch unter der Nichtintegration des Macht-Demokratie Kontinuums in den internationalen Beziehungen Deutschlands gelitten hat.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Dilemma im „Demokratie Check-up“?
Das Dokument thematisiert den ständigen Kampf zwischen dem Machtprinzip (autoritär) und dem Demokratieprinzip (sozial weiterentwickelt) in Gesellschaften.
Wie wird der „alte Mensch“ im Text definiert?
Der „alte Mensch“ ist ein Wesen, das ausschließlich von Machtmotiven gesteuert wird, nur eigene Interessen kennt und keinen Raum für die Bedürfnisse anderer lässt.
Was bedeutet „Machtdistanz“ in diesem Kontext?
Kulturen mit hoher Machtdistanz verharren eher in archaischen, autoritären Strukturen, während Gesellschaften mit niedriger Machtdistanz demokratische Prozesse besser integrieren können.
Welche Rolle spielt die deutsche Geschichte für die Demokratie?
Deutschland hat einen hohen Preis für seine demokratische Identität bezahlt. Der Text warnt davor, die Demokratie nur als „Verbalhülse“ zu nutzen, ohne sie mit psychologischer Substanz zu füllen.
Was ist ein sozialpsychologisches Nicht-Nullsummenspiel?
Es beschreibt einen Zustand, in dem durch die Integration demokratischer Prinzipien nicht einer auf Kosten des anderen gewinnt (Macht), sondern ein gemeinsamer Mehrwert für alle entsteht.
- Citar trabajo
- D.E.A./UNIV. PARIS I Gebhard Deißler (Autor), 2013, Demokratie Check-up, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210023