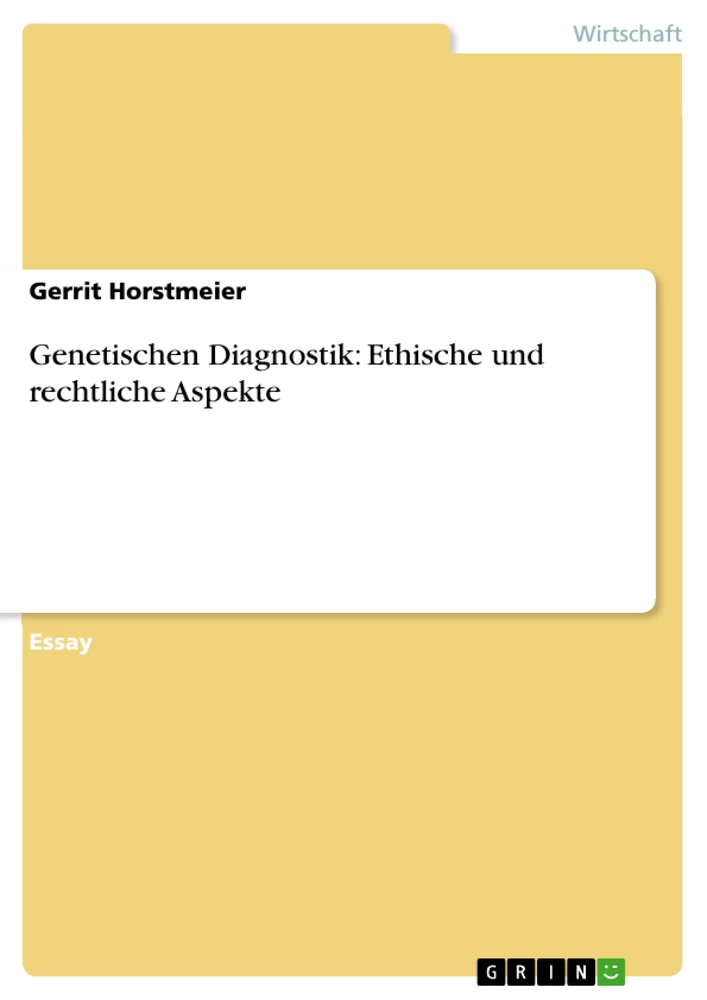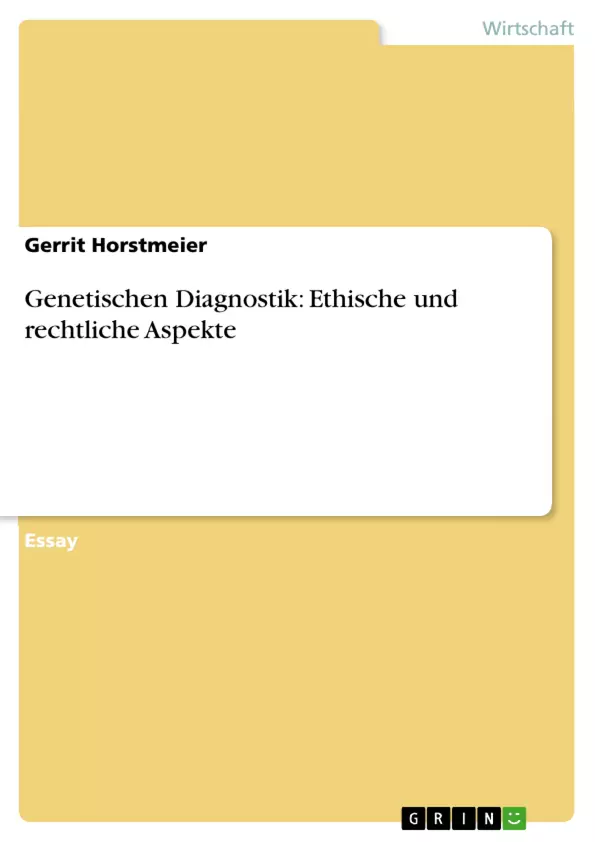Die Problematik des Themas wird anschaulich an folgendem, real in Deutschland verhandelten Fall, der dem Verwaltungsgericht (VG) Darmstadt 2004 zur Entscheidung vorlag:
Dabei klagte eine Lehrerin auf Verbeamtung. Diese hatte die zuständige Schulbehörde versagt wegen eines hohen Risikos der Referendarin, an Chorea Huntington zu erkranken. Die Klägerin gab nämlich bei der amtsärztlichen Untersuchung an, ihr Vater leide an dieser Krankheit. Die Verbeamtung wurde daraufhin abgelehnt, da eine erhöhte Wahrscheinlichkeit bestehe, dass in den nächsten zehn Jahren bei ihr die Huntingtonsche Krankheit ausbreche. Die einstellende Schulbehörde befürchtete daraufhin häufige Dienstunfähigkeitszeiten bis hin zur vorzeitigen Dienstunfähigkeit der Klägerin.
Gliederung
A. Einführungsfall
B. Fragestellung
C. Ethische Beurteilung
D. Rechtliche Situation
A. Einführungsfall
Die Problematik des Themas wird anschaulich an folgendem, real in Deutschland verhandelten Fall, der dem Verwaltungsgericht (VG) Darmstadt 2004 zur Entscheidung vorlag:
Dabei klagte eine Lehrerin auf Verbeamtung. Diese hatte die zuständige Schulbehörde versagt wegen eines hohen Risikos der Referendarin, an Chorea Huntington zu erkranken. Die Klägerin gab nämlich bei der amtsärztlichen Untersuchung an, ihr Vater leide an dieser Krankheit. Die Verbeamtung wurde daraufhin abgelehnt, da eine erhöhte Wahrscheinlichkeit bestehe, dass in den nächsten zehn Jahren bei ihr die Huntingtonsche Krankheit ausbreche. Die einstellende Schulbehörde befürchtete daraufhin häufige Dienstunfähigkeitszeiten bis hin zur vorzeitigen Dienstunfähigkeit der Klägerin.
Das VG Darmstadt gab der Klägerin mit ihrer Klage auf Verbeamtung gegen das Land Hessen jedoch Recht[1]. Es befürchtete Benachteiligungen für Arbeitssuchende, die Träger krankheitsrelevanter genetischer Veranlagungen sind und deswegen in einem Rekrutierungsverfahren nicht berücksichtigt werden.
B. Fragestellung
Auch wenn der Einführungsfall sich nicht im klassischen Arbeitsrecht, sondern im Beamtenrecht abspielte, ist er für den hier zu behandelnde Klärungs- und Regelungsbedarf doch aufschlussreich. Denn in ihm ist der gleiche Grundkonflikt festzustellen. Einerseits gibt es durch moderne Diagnostikverfahren bis hin zur Gendiagnostik medizinische Möglichkeiten, Träger von krankheitsrelevanten Veranlagungen zu bestimmen. Darüber hinaus kann das Risiko, dass sich diese Veranlagung auch als Krankheit verwirklicht, im Rahmen einer genetischen Untersuchung festgestellt werden. Daher stellt sich für Arbeitgeber heute die Frage:
Soll man als Arbeitnehmer ethisch und rechtlich genötigt werden können, genetische Informationen über sich selbst gewinnen zu lassen und sie Dritten gegenüber zu offenbaren?
Diese Frage soll im Nachfolgenden ethisch, aber auch rechtlich beleuchtet werden.
C. Ethische Beurteilung
Um die Frage vom ethischen Standpunkt beurteilen zu können, empfiehlt es sich, sich über den Weg zu diesem Standpunkt klar zu werden. Damit sollen auch gleichzeitig die Nachvollziehbarkeit und die Transparenz des Standpunktes gewährleistet werden. Dazu werden folgende sechs Schritte benutzt[2]:
1. Feststellung des Sachverhalts: Zum Sachverhalt gehört in diesem Zusammenhang eine Feststellung des Begriffs der „Gendiagnostik“: Dabei handelt es sich um die Untersuchung von dem Körper entnommenen Substanzen, um mit Hilfe genetischer Analysen (zytogenetische oder Chromosomenanalyse, Analyse der DNA bzw. der RNA) Aufschluss über die genetische Ausstattung eines Menschen zu bekommen. Ansonsten geht es um Sachverhalte, die für Bewerber von Arbeitsstellen dem Einführungsfall vergleichbar sind.
2. Welche Kriterien spielen für die ethische Beurteilung der Fragestellung eine Rolle? Im Rahmen eines Rekrutierungsprozesses eines Mitarbeiters kann man von folgenden Gesichtspunkten ausgehen:
- Das Interesse des Arbeitgebers, einen geworbenen Arbeitnehmer nicht durch Krankheit zu entbehren: Die Arbeitgeber werden durch Lohnfortzahlung am Erkrankungsrisiko ihrer Arbeitnehmer beteiligt, d. h. die Zulassung einer genetischer Auswahl würde diese Risikominimierung an den Beginn des Arbeitsverhältnisses legen. Allerdings ist zu beachten, dass der Voraussagewert derartiger prädiktiver Informationen, je weiter die Prognose reicht, doch sehr begrenzt sein kann.
- Bedarf des Arbeitnehmers an Erwerbsarbeit: Arbeitnehmer haben strukturell einen geringeren Handlungsspielraum als Arbeitgeber und sind auf Erwerbsarbeit als Daseinsvorsorge angewiesen
- Gefahr der „genetischen“ Diskriminierung? Nicht jede ungleiche Behandlung ist diskriminierend. Prädiktive Informationen werden auch auf anderem als auf gendiagnostischem Weg beschafft werden (s. Einführungsfall). Aber: Genetische Daten haben ein größeres Gewicht bzgl. der Präzision und Nachhaltigkeit derartiger Aussagen.
- „Recht auf Nichtwissen“ (Informationelle Selbstbestimmung): Betroffene haben grundsätzlich ein Recht darauf, ob und was sie über ihre genetische Veranlagung erfahren wollen.
[...]
[1] VG Darmstadt vom 24. 6. 2004, 1 E 470/04
[2] Beruhend auf Prof. Dr. Albrecht Müller, Hochschule Nürtingen, Tagung der Ethikbeauftragten der Fachhochschulen Baden-Württembergs in Bad Lauterbach, Sep. 2007
Häufig gestellte Fragen
Dürfen Arbeitgeber genetische Informationen von Bewerbern fordern?
Die Arbeit untersucht die ethischen und rechtlichen Grenzen dieser Frage, wobei das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ein zentrales Gegenargument ist.
Was bedeutet das „Recht auf Nichtwissen“?
Es ist das Recht eines jeden Menschen, selbst zu entscheiden, ob und welche Informationen er über seine eigene genetische Veranlagung erfahren möchte.
Was war der Fall der Lehrerin vor dem VG Darmstadt 2004?
Einer Lehrerin wurde die Verbeamtung wegen eines Risikos für Chorea Huntington verweigert; das Gericht gab ihr jedoch Recht, um genetische Diskriminierung zu verhindern.
Was versteht man unter Gendiagnostik?
Es ist die Untersuchung von DNA oder Chromosomen, um Aufschluss über die genetische Ausstattung und mögliche Krankheitsrisiken eines Menschen zu erhalten.
Welches Interesse haben Arbeitgeber an Gendiagnostik?
Arbeitgeber möchten das Risiko von Krankheitsausfällen und vorzeitiger Dienstunfähigkeit minimieren, um Lohnfortzahlungskosten zu sparen.
- Arbeit zitieren
- Prof. Dr. Gerrit Horstmeier (Autor:in), 2007, Genetischen Diagnostik: Ethische und rechtliche Aspekte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210046