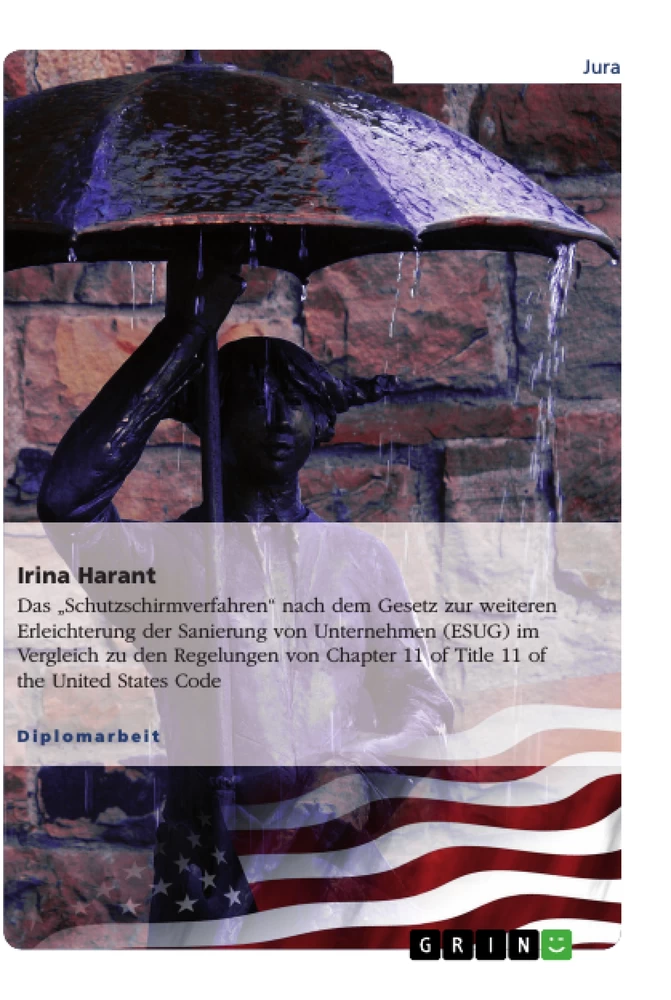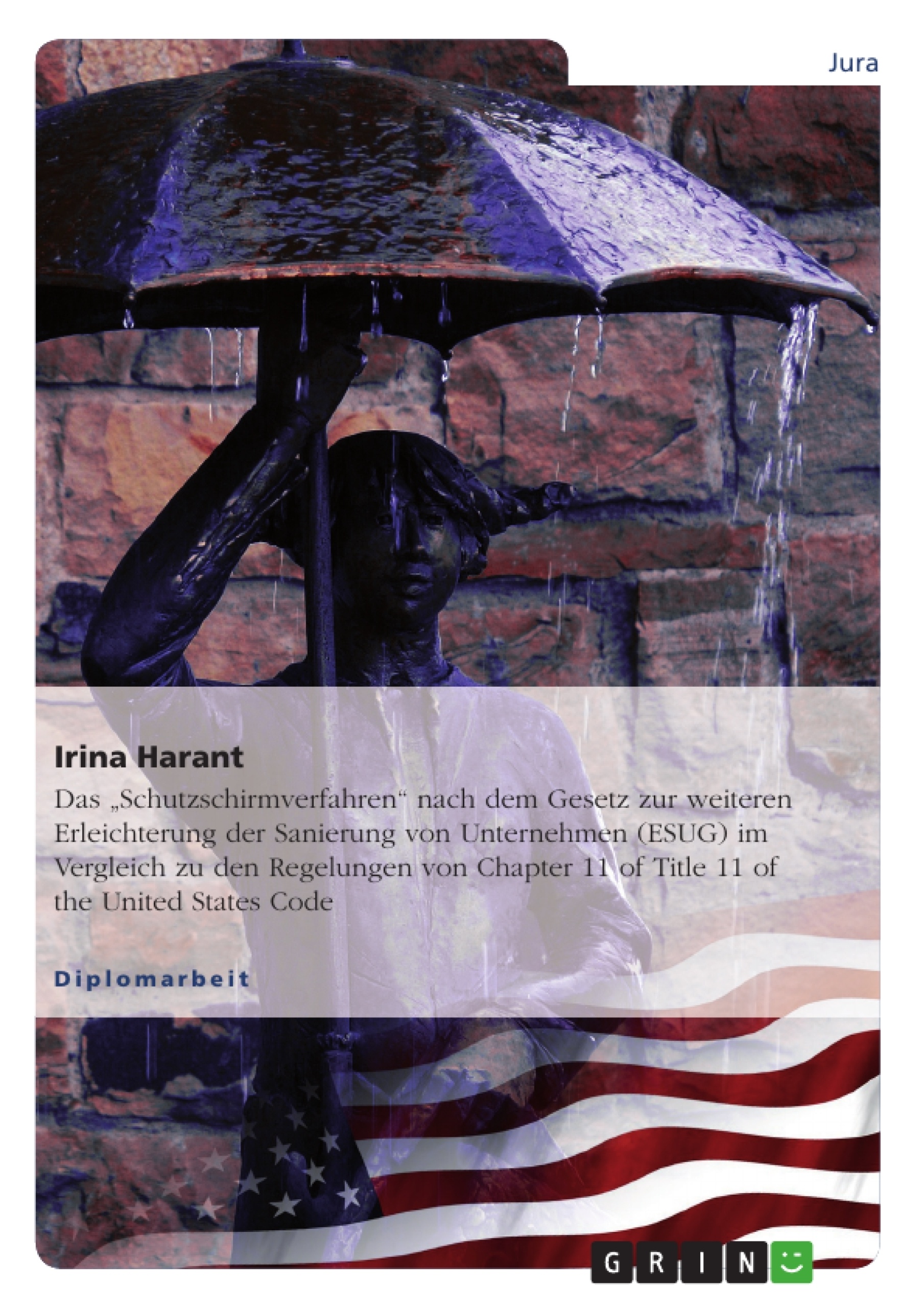Endstation Insolvenzverfahren, finales Todesurteil oder Neubeginn? Der Begriff Insolvenz wird im Allgemeinen mit dem endgültigen Untergang des Unternehmens gleichgesetzt. Musste der Schuldner im Mittelalter noch mit einem Arrest im Schuldturm rechnen, wurde ihm im Jahre 1999 die Insolvenzordnung an die Hand gegeben. Mit deren Einführung sollte die Sanierung und Fortführung von Unternehmen ins Zentrum des deutschen Insolvenzrechts rücken. Ausdruck haben die Bestrebungen des Gesetzgebers vor allem in den neu hervorgebrachten Instituten des Insolvenzplans, der Eigenverwaltung und des Insolvenzantragsgrundes der drohenden Zahlungsunfähigkeit gefunden. Jedoch hat die InsO mit ihren zahlreichen Sanierungswerkzeugen nicht dazu beigetragen, der Sanierung mittels Insolvenzplan und Eigenverwaltung aus dem Schattendasein zu verhelfen.
Demgegenüber laufen eigenverwaltende Plansanierungen in den USA nach dem dortigen Chapter 11-Verfahren geradezu wie am Fließband, dazu aktuell der Fall American Airlines. Doch wieso funktioniert die InsO nicht? Die Gründe für das Ausbleiben deutscher Erfolgsgeschichten finden sich in den unbefriedigenden Regelungen zur Eigenverwaltung sowie der mangelnden Planungssicherheit des Verfahrens.
Der Gesetzgeber versucht diese Schwachstellen zu beseitigen und reagiert mit dem „Gesetz zur Erleichterung der Sanierung von Unternehmen“ (ESUG). Es soll Deutschland zu einem Mentalitätswandel in eine andere Insolvenzkultur verhelfen. Eine Kultur, die die Insolvenz vom Stigma der Liquidation befreit und sich an der US-amerikanischen Tradition einer „zweiten Chance“ überlebensfähiger Unternehmen orientiert. Einer der Kernpunkte der Reform ist die Einführung des sog. Schutzschirmverfahrens, eine Art eigenständiges Sanierungsverfahren, geregelt in § 270b InsO.
Die aktuelle Reform und die daraus entstiegene neue Insolvenzkultur geben den entscheidenden Anlass dafür, sich mit der rechtsvergleichenden Thematik der Sanierungsmöglichkeiten von Unternehmen in der Insolvenz durch das deutschen Schutzschirmverfahren nach § 270b InsO und das US-amerikanischen Reorganisationsverfahren nach Chapter 11 zu befassen.
Ziel der Arbeit ist es, die Verfahren nicht lediglich gegenüberzustellen, sondern vielmehr, den Verfahrensverlauf und sich aus den Verfahren ergebende Problemfelder unter begleitender Bezugnahme auf ausgesuchte Wirtschaftsfallbeispiele eingehend zu untersuchen und miteinander zu vergleichen.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einführung
- B. Sanierungsmodelle im Überblick
- I. Sanierung im deutschen Insolvenzrecht: das „Schutzschirmverfahren“, neue Dimension der Eigenverwaltung
- 1. Die ESUG-Reform
- 2. Hintergründe der Reform: Die Eigenverwaltung, ein verkannter Sanierungsweg
- a) Das Grundkonzept der Eigenverwaltung
- b) Der verkannte Sanierungsweg
- aa) Defizite bisheriger Regelungen
- bb) Lösung
- 3. Das Schutzschirmverfahren nach § 270b InsO
- a) Der neue „Schutzschirm“
- b) Regelmäßiger Verlauf des Schutzschirmverfahrens im Überblick
- 4. Zusammenfassung
- II. Sanierung im U.S.-amerikanischen Insolvenzrecht: das Reorganisationsverfahren nach Chapter 11
- 1. Grundlagen des U.S.-amerikanischen Insolvenzrechts
- a) Historische Entwicklung der planmäßigen Reorganisation
- b) Der Bankruptcy Code von 1978
- 2. Das Reorganisationsverfahren nach Chapter 11
- a) Die Vorschriften des Chapter 11
- b) Das Reorganisationsverfahren
- c) Statistische Betrachtungen
- d) Regelmäßiger Verlauf des Verfahrens im Überblick
- 3. Zusammenfassung
- C. Das Schutzschirmverfahren in rechtsvergleichender Betrachtung mit dem Reorganisationsverfahren nach Chapter 11
- I. Vorgehensweise
- II. Begleitend zu betrachtende Fallbeispiele
- III. Vom Antrag zur Verfahrenseröffnung
- IV. Die Rechtsfolgen der Verfahrenseröffnung
- V. Die Rolle des Schuldners
- VI. Kontrolle des Schuldners
- VII. Beteiligung der Gläubiger
- VIII. Moratorium
- IX. Auswirkungen auf noch zu erfüllende Verträge
- X. Finanzierung des Verfahrens
- XI. Der Sanierungsplan
- XII. Beendigung des Verfahrens
- XIII. Kritische Bewertung
- D. Abschließende Betrachtungen
- I. Ergebnis der Analyse
- II. Ausblick: Was wird aus dem Schutzschirmverfahren?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit verfolgt das Ziel, das deutsche „Schutzschirmverfahren“ nach dem Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG) mit dem amerikanischen Chapter 11-Verfahren zu vergleichen. Die Arbeit analysiert die jeweiligen Regelungen, Verfahrensabläufe und Auswirkungen auf die beteiligten Parteien. Der Fokus liegt auf der rechtsvergleichenden Betrachtung beider Verfahren.
- Vergleich des Schutzschirmverfahrens und Chapter 11
- Analyse der Verfahrensabläufe beider Verfahren
- Bewertung der jeweiligen Vor- und Nachteile für Schuldner und Gläubiger
- Untersuchung der Rolle des Schuldners in beiden Verfahren
- Beurteilung der Erfolgsquoten und der Auswirkungen auf Verträge
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einführung: Diese Einleitung führt in die Thematik der Unternehmensinsolvenz und der Bedeutung von Sanierungsverfahren ein. Sie umreißt den Fokus der Arbeit, nämlich den Vergleich des deutschen Schutzschirmverfahrens mit dem amerikanischen Chapter 11 Verfahren, und skizziert die methodische Vorgehensweise.
B. Sanierungsmodelle im Überblick: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Sanierungsmodelle im deutschen und amerikanischen Recht. Es beschreibt das Schutzschirmverfahren im Detail, unter Berücksichtigung der ESUG-Reform und der Hintergründe der Eigenverwaltung. Es werden die Defizite der bisherigen Regelungen und die Lösungsansätze im neuen Schutzschirmverfahren erläutert. Parallel dazu wird das amerikanische Chapter 11 Verfahren vorgestellt, wobei die historischen Entwicklungen und der Bankruptcy Code von 1978 erklärt werden. Die Kapitel liefern eine detaillierte Darstellung der Verfahren, einschließlich der regelmäßigen Abläufe, und bieten eine erste Zusammenfassung der jeweiligen Besonderheiten.
C. Das Schutzschirmverfahren in rechtsvergleichender Betrachtung mit dem Reorganisationsverfahren nach Chapter 11: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit. Es vergleicht systematisch das deutsche Schutzschirmverfahren mit dem amerikanischen Chapter 11 Verfahren anhand verschiedener Aspekte. Die Vorgehensweise wird erläutert und anhand von Fallbeispielen wie American Airlines, General Motors und Lehman Brothers illustriert. Der Vergleich umfasst den Antragsprozess, die Rechtsfolgen der Verfahrenseröffnung, die Rolle des Schuldners, die Gläubigerbeteiligung, das Moratorium, die Auswirkungen auf Verträge, die Finanzierung des Verfahrens, den Sanierungsplan und die Beendigung des Verfahrens. Jeder Aspekt wird detailliert untersucht und die jeweiligen Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausgearbeitet.
D. Abschließende Betrachtungen: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der rechtsvergleichenden Analyse zusammen, bewertet kritisch die Vor- und Nachteile beider Verfahren und gibt einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des Schutzschirmverfahrens. Der Ausblick zeigt mögliche Entwicklungen und Verbesserungsvorschläge auf.
Schlüsselwörter
Schutzschirmverfahren, Chapter 11, ESUG, Eigenverwaltung, Insolvenzrecht, Unternehmensreorganisation, Gläubigerschutz, Schuldnerfreundlichkeit, Rechtsvergleich, Sanierungsplan, Moratorium, Finanzierung, Fallbeispiele, American Airlines, General Motors, Lehman Brothers.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Rechtsvergleichendes Studium des deutschen Schutzschirmverfahrens und des amerikanischen Chapter 11 Verfahrens
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Diese Diplomarbeit vergleicht das deutsche „Schutzschirmverfahren“ nach dem Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG) mit dem amerikanischen Chapter 11-Verfahren. Der Fokus liegt auf einer rechtsvergleichenden Betrachtung beider Verfahren, analysiert die jeweiligen Regelungen, Verfahrensabläufe und Auswirkungen auf die beteiligten Parteien.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Vergleich des Schutzschirmverfahrens und Chapter 11, Analyse der Verfahrensabläufe beider Verfahren, Bewertung der Vor- und Nachteile für Schuldner und Gläubiger, Untersuchung der Rolle des Schuldners, Beurteilung der Erfolgsquoten und Auswirkungen auf Verträge. Konkrete Aspekte umfassen den Antragsprozess, die Rechtsfolgen der Verfahrenseröffnung, die Gläubigerbeteiligung, das Moratorium, die Vertragsauswirkungen, die Finanzierung, den Sanierungsplan und die Verfahrensbeendigung. Fallbeispiele wie American Airlines, General Motors und Lehman Brothers werden begleitend betrachtet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Hauptteile: A. Einführung: Einleitung in die Thematik und die methodische Vorgehensweise. B. Sanierungsmodelle im Überblick: Detaillierte Beschreibung des Schutzschirmverfahrens (inkl. ESUG-Reform und Eigenverwaltung) und des Chapter 11 Verfahrens (inkl. historischer Entwicklung und Bankruptcy Code). C. Rechtsvergleichende Betrachtung: Systematischer Vergleich beider Verfahren anhand verschiedener Aspekte. D. Abschließende Betrachtungen: Zusammenfassung der Ergebnisse, kritische Bewertung und Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des Schutzschirmverfahrens.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das deutsche Schutzschirmverfahren und das amerikanische Chapter 11-Verfahren umfassend zu vergleichen und ihre jeweiligen Stärken und Schwächen aufzuzeigen. Sie soll einen Beitrag zum Verständnis beider Verfahren und ihrer Anwendung in der Praxis leisten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Schutzschirmverfahren, Chapter 11, ESUG, Eigenverwaltung, Insolvenzrecht, Unternehmensreorganisation, Gläubigerschutz, Schuldnerfreundlichkeit, Rechtsvergleich, Sanierungsplan, Moratorium, Finanzierung, Fallbeispiele, American Airlines, General Motors, Lehman Brothers.
Werden in der Arbeit Fallbeispiele verwendet?
Ja, die Arbeit verwendet Fallbeispiele wie American Airlines, General Motors und Lehman Brothers, um die Verfahren zu illustrieren und den Vergleich zu verdeutlichen.
Welche Aspekte werden im Rechtsvergleich besonders hervorgehoben?
Der Rechtsvergleich konzentriert sich auf die Verfahrensabläufe, die Rolle des Schuldners und der Gläubiger, die Auswirkungen auf Verträge, die Finanzierungsmöglichkeiten und die Erfolgsaussichten der jeweiligen Verfahren. Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten werden detailliert untersucht.
Was ist das Ergebnis der Analyse?
Das Ergebnis der Analyse wird im letzten Kapitel zusammengefasst. Es enthält eine kritische Bewertung der Vor- und Nachteile beider Verfahren und einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des deutschen Schutzschirmverfahrens.
Gibt es einen Ausblick auf die Zukunft des Schutzschirmverfahrens?
Ja, die Arbeit enthält einen Ausblick, der mögliche Entwicklungen und Verbesserungsvorschläge für das deutsche Schutzschirmverfahren diskutiert.
- Quote paper
- Irina Harant (Author), 2012, Das „Schutzschirmverfahren“ nach dem Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG) im Vergleich zu den Regelungen von Chapter 11 of Title 11 of the United States Code, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210131