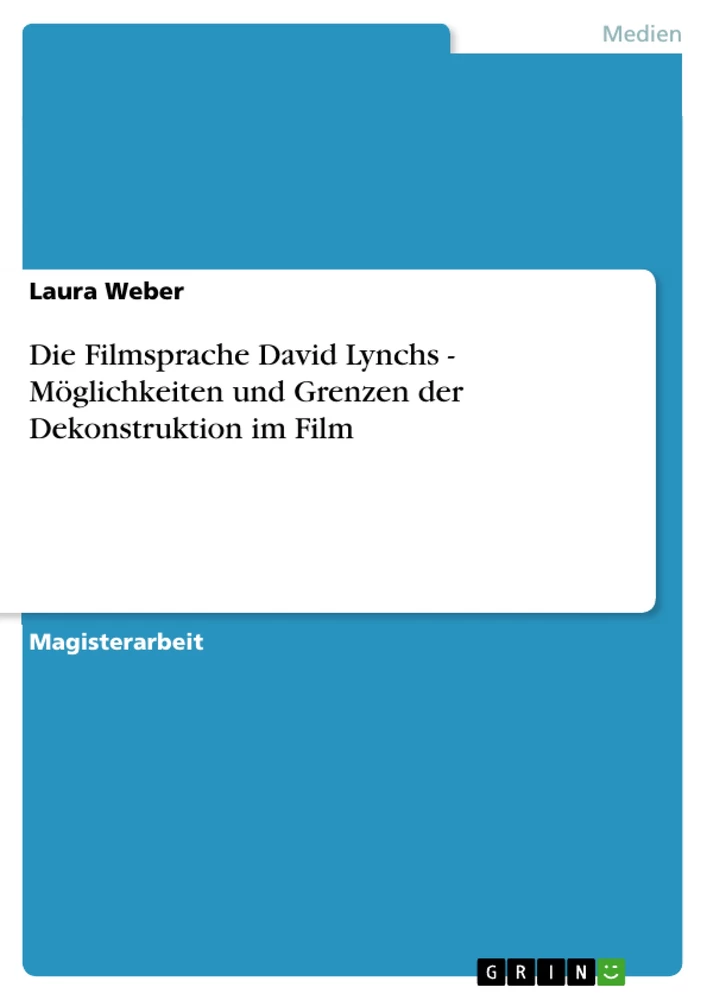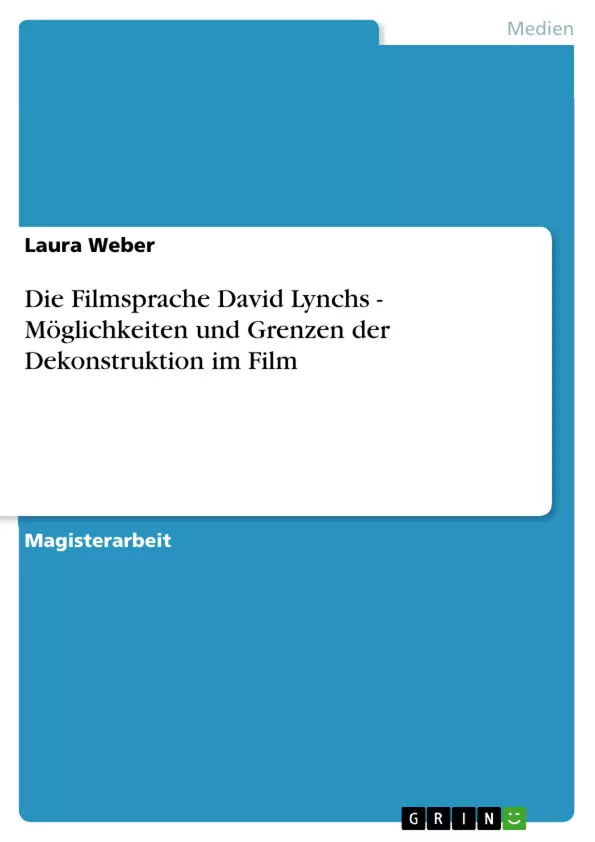David Lynchs Filme schlagen wie kaum ein anderes Werk eines in Hollywood ansässigen Regisseurs den Bogen zwischen Hollywood-, Arthouse- und Independentfilm. Es ist eben dieser Status im Zwischenraum, im Jenseits klassischer Genrekonventionen, der den Anspruch eines Regisseurs widerspiegelt, der sich gegen eindeutige Interpretationen sträubt. Die Grenzen
des Nicht-Eindeutigen, des Vieldeutigen auszuloten, sie so weit zu spannen, bis sie sich in der Bedeutungslosigkeit verlieren, so ließe sich das Programm von David Lynch formulieren.
„Es [das klassische Erzählkino, Anm.LW] ist zeitlos, und ich liebe es sehr. Doch ich will seine Formen und Strukturen so weit wie möglich dehnen.“ (David Lynch).Die Liebe zum Kino ist Lynchs Filmen anzumerken. So sind seine Filme, selbst wenn sie sämtliche kinematographische Formeln und Regeln auf die Probe stellen, stets auch eine Hommage an das Kino und an das Medium Film, dessen vielfältige Gestaltungsmittel konsequent ausgeschöpft und ergründet werden. Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass Lynchs Filme immer wieder als Beitrag zu einer Theorie des Films verstanden werden. Indem sie die Mechanismen des klassischen Kinos einem experimentellen Spiel aussetzen, lassen sie deren
Konventionalität deutlich hervortreten und bieten alternative filmische Konzepte an.
In diesem Umgang mit dem Medium Film und den Konventionen des Kinos erkennen Filmwissenschaftler oft ein dekonstruktives Verfahren. Damit wird der Blickwinkel aus einer philosophischen Perspektive eröffnet. Die Dekonstruktion ist eine im Geiste des Poststrukturalismus geborene Haltung des französischen Philosophen Jacques Derrida. Sie beschreibt ein vielschichtiges Lektüreverfahren, mit dem Derrida hauptsächlich Texten der philosophischen Tradition begegnet. Das Aufdecken textimmanenter Aporien wirkt sich dabei als radikale Infragestellung traditioneller Grundannahmen der abendländischen Philosophie aus. Zusammenhänge zwischen Zeichen und Bedeutung werden zu unsicheren Faktoren.
Der Import des Begriffs in den filmwissenschaftlichen Bereich spiegelt seine Popularität wider und evoziert eine Reihe von Fragen: Ist das Konzept der Dekonstruktion, so wie es Derrida versteht, überhaupt auf den Bereich des Films anwendbar oder handelt es sich um den inflationären Gebrauch eines Modewortes? Wird damit das Medium Film zum philosophischen Gegenstand oder zum Ort eines philosophischen Diskurses? Können Lynchs Filme tatsächlich als eine dekonstruktive Reflexion verstanden werden?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Forschungsstand und Literaturlage
- 1.2 Vorgehensweise
- 2. Die Dekonstruktion – Eine philosophische Strategie Jacques Derridas
- 2.1 Der Kontext der Dekonstruktion: Poststrukturalismus und Strukturalismus
- 2.2 Logozentrismus und Phonozentrismus
- 2.3 Derrida und Sprache – La différance
- 2.3.1 Semantische Bestimmung von „La différance“
- 2.3.2 Bewegung statt Ursprung
- 2.3.3 Die Unkontrollierbarkeit der Bedeutung
- 2.3.4 Der offene Text
- 2.3.5 Zusammenfassung und Wirkungsbereich der Dekonstruktion
- 3. Filmsprache
- 3.1 Zum Begriff der Filmsprache in der Filmsemiotik
- 3.2 Der Code der klassischen Filmsprache: Die Herrschaft der Erzählung
- 3.3 Kinemato-Graphia: Filmschrift anstatt Filmsprache
- 3.4 Ein Exkurs zum Dekonstruktivismus in der Architektur
- 3.5 Dekonstruktivistische Filmstrategie
- 4. David Lynch: Ein Filmemacher zwischen Kunst und Kino
- 4.1 Biografische Notiz zu David Lynch und Gliederung seines Werks
- 5. Die Filmsprache David Lynchs und ihr dekonstruktivistisches Potential
- 5.1 Analyse der narrativen Strukturen
- 5.1.1 LOST HIGHWAY
- 5.1.1.1 Inhaltsangabe
- 5.1.1.2 Narrative Struktur und mögliche Interpretationsansätze
- 5.1.2 MULHOLLAND DRIVE
- 5.1.2.1 Inhaltsangabe
- 5.1.2.2 Narrative Struktur und mögliche Interpretationsansätze
- 5.1.3 Die Inszenierung von Raum und Zeit bei David Lynch
- 5.1.3.1 Spiel mit klassisch-filmtechnischen Manipulationen
- 5.1.3.2 Der Abschied von der Linearität
- 5.1.3.3 Eine simultane Zeitordnung?
- 5.1.3.4 Raumsprünge und falsche Anschlüsse
- 5.1.3.5 Zusammenfassung: Dezentrierung der Narration
- 5.1.4 Freiheit der Bildgestaltung
- 5.2 Die Instabilität der medialen Grenzen
- 5.2.1 Die Macht des Offs
- 5.2.2 Erweiterung des Bild- und Tonraums: Das Verhältnis von Bild zu Ton
- 5.2.3 Die verschachtelte Bildfolge in MULHOLLAND DRIVE
- 5.2.4 Fiktion in Fiktion in MULHOLLAND DRIVE
- 5.3 Die Dekonstruktion der filmischen Zeichen
- 5.3.1 Die Verschachtelung der narrativen Ebenen in LOST HIGHWAY
- 5.3.2 Zu Status und Ort des kinematographischen Bildes
- 5.3.3 Der Verlust der bildlichen Referenz in LOST HIGHWAY
- 5.3.4 Die Dekonstruktion des bildlichen Zeichens
- 5.3.5 Die Dekonstruktion des sprachlichen Zeichens
- 5.4 Ein transtextueller Text - INLAND EMPIRE
- 5.4.1 Inhaltsangabe INLAND EMPIRE
- 5.4.2 Die Netz-Struktur von INLAND EMPIRE
- 5.4.2.1 Handlungs- und Bildgeflecht
- 5.4.2.2 Intertextuelle Verweise zu anderen 'Lynch-Texten'
- 5.4.2.3 Der Tod und die Wiederbelebung des Films: Eine Transformation
- 5.4.3 David Lynch, die Kunst und die Dekonstruktion
- 6. Fazit
- 6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse: Die Filmsprache David Lynchs
- 6.2 Bewertung: Möglichkeiten und Grenzen der Dekonstruktion im Film
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Filmsprache David Lynchs und deren dekonstruktives Potential. Ziel ist es, Lynchs filmische Strategien im Kontext der dekonstruktivistischen Philosophie Jacques Derridas zu analysieren und deren Möglichkeiten und Grenzen zu beleuchten.
- Dekonstruktion der narrativen Strukturen in Lynchs Filmen
- Analyse der Instabilität medialer Grenzen in Bezug auf Bild und Ton
- Untersuchung der Dekonstruktion filmischer Zeichen (bildlich und sprachlich)
- Der Einfluss des Poststrukturalismus auf Lynchs filmisches Werk
- Vergleich der klassischen Filmsprache mit Lynchs experimentellem Ansatz
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Möglichkeiten und Grenzen der Dekonstruktion in David Lynchs Filmen. Sie verortet Lynchs Werk im Spannungsfeld zwischen Hollywood-, Arthouse- und Independentkino und hebt dessen experimentellen und dekonstruktiven Charakter hervor, der sich gegen eindeutige Interpretationen sträubt. Die Arbeit wird als Beitrag zu einer Theorie des Films verstanden, die die Konventionalität des klassischen Kinos durch ein experimentelles Spiel hervorhebt und alternative filmische Konzepte aufzeigt.
2. Die Dekonstruktion – Eine philosophische Strategie Jacques Derridas: Dieses Kapitel erläutert die philosophischen Grundlagen der Dekonstruktion nach Jacques Derrida. Es beschreibt den Kontext des Poststrukturalismus und Strukturalismus, die Konzepte des Logozentrismus und Phonozentrismus und die zentrale Rolle von „La différance“ für Derridas Denken. Das Kapitel beleuchtet die semantische Bestimmung von „La différance“, den Fokus auf Bewegung statt Ursprung, die Unkontrollierbarkeit der Bedeutung und den offenen Text als Ergebnis der dekonstruktiven Lektüre. Abschließend wird der Wirkungsbereich und die Bedeutung der Dekonstruktion zusammengefasst.
3. Filmsprache: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Begriff der Filmsprache in der Filmsemiotik. Es untersucht den Code der klassischen Filmsprache und deren Fokus auf die Erzählung, vergleicht ihn mit dem Konzept der Kinemato-Graphia und macht einen Exkurs in den dekonstruktivistischen Ansatz in der Architektur. Schließlich wird eine dekonstruktivistische Filmstrategie definiert, die als theoretische Grundlage für die Analyse von Lynchs Filmen dient.
4. David Lynch: Ein Filmemacher zwischen Kunst und Kino: Dieses Kapitel gibt eine kurze biografische Notiz über David Lynch und bietet eine Gliederung seines Werks. Es bereitet den Boden für die folgende detaillierte Analyse von Lynchs spezifischer Filmsprache und deren dekonstruktivistischen Potential.
5. Die Filmsprache David Lynchs und ihr dekonstruktivistisches Potential: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Aspekte der Filmsprache Lynchs im Hinblick auf ihr dekonstruktivistisches Potential. Es untersucht die narrativen Strukturen in Filmen wie Lost Highway und Mulholland Drive, die Inszenierung von Raum und Zeit, die Freiheit der Bildgestaltung, die Instabilität medialer Grenzen und die Dekonstruktion filmischer Zeichen (bildlich und sprachlich). Der transtextuelle Charakter von Inland Empire wird ebenfalls behandelt.
Schlüsselwörter
David Lynch, Filmsprache, Dekonstruktion, Jacques Derrida, Poststrukturalismus, Narrative Strukturen, Mediale Grenzen, Bild, Ton, Lost Highway, Mulholland Drive, Inland Empire, Filmsemiotik, klassische Filmsprache, experimentelles Kino.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Magisterarbeit: David Lynchs Filmsprache und ihr dekonstruktivistisches Potential
Was ist das Thema der Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Filmsprache des Regisseurs David Lynch und analysiert deren dekonstruktivistisches Potential. Sie untersucht, wie Lynchs filmische Strategien mit den philosophischen Konzepten der Dekonstruktion nach Jacques Derrida in Verbindung stehen.
Welche Filme werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit konzentriert sich auf drei Hauptfilme von David Lynch: Lost Highway, Mulholland Drive und Inland Empire. Diese Filme werden im Detail auf ihre narrativen Strukturen, die Inszenierung von Raum und Zeit sowie die Dekonstruktion filmischer Zeichen untersucht.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die dekonstruktivistische Philosophie von Jacques Derrida und den Kontext des Poststrukturalismus. Konzepte wie Logozentrismus, Phonozentrismus und „La différance“ bilden die theoretische Grundlage der Analyse.
Welche Aspekte der Filmsprache werden untersucht?
Die Analyse umfasst verschiedene Aspekte der Filmsprache, darunter die narrativen Strukturen, die Inszenierung von Raum und Zeit, die Freiheit der Bildgestaltung, die Instabilität der medialen Grenzen (insbesondere das Verhältnis von Bild und Ton) und die Dekonstruktion filmischer Zeichen (sowohl bildlich als auch sprachlich).
Wie wird die klassische Filmsprache mit Lynchs Ansatz verglichen?
Die Arbeit vergleicht Lynchs experimentellen Ansatz mit den Konventionen der klassischen Filmsprache, um dessen dekonstruktiven Charakter hervorzuheben. Der Fokus liegt auf den Abweichungen von narrativer Linearität und der Auflösung traditioneller filmischer Codes.
Welche zentrale Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage befasst sich mit den Möglichkeiten und Grenzen der Dekonstruktion in David Lynchs Filmen. Es wird untersucht, inwieweit Lynchs Werk als Ausdruck dekonstruktivistischer Prinzipien betrachtet werden kann.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Dekonstruktion nach Derrida, Filmsprache, David Lynchs Werk, Analyse der Filmsprache Lynchs und Fazit. Die Kapitel bieten eine schrittweise Einführung in die Thematik, die theoretischen Grundlagen und die detaillierte Analyse von Lynchs Filmen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: David Lynch, Filmsprache, Dekonstruktion, Jacques Derrida, Poststrukturalismus, Narrative Strukturen, Mediale Grenzen, Bild, Ton, Lost Highway, Mulholland Drive, Inland Empire, Filmsemiotik, klassische Filmsprache, experimentelles Kino.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, Lynchs filmische Strategien im Kontext der dekonstruktivistischen Philosophie zu analysieren und deren Möglichkeiten und Grenzen zu beleuchten. Es soll ein Beitrag zu einer Theorie des Films geleistet werden, die über die Konventionen des klassischen Kinos hinausgeht.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Leser, die sich für David Lynchs Filmkunst, die dekonstruktivistische Philosophie und die Filmtheorie interessieren. Sie eignet sich insbesondere für akademische Zwecke im Bereich der Filmwissenschaft und Medienwissenschaften.
- Quote paper
- Laura Weber (Author), 2010, Die Filmsprache David Lynchs - Möglichkeiten und Grenzen der Dekonstruktion im Film, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210140