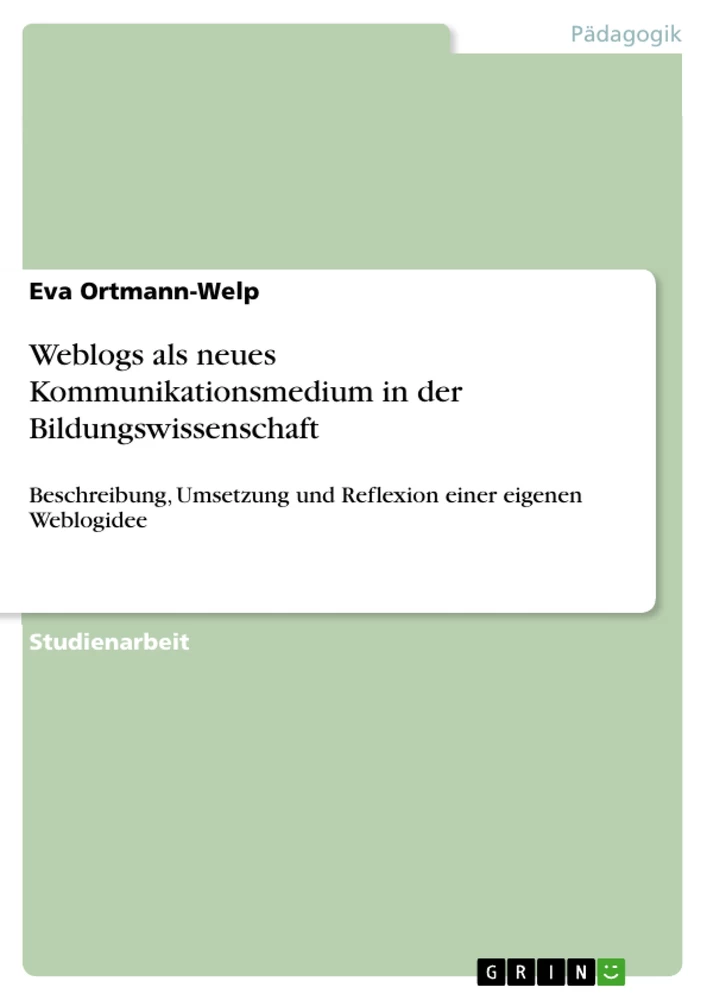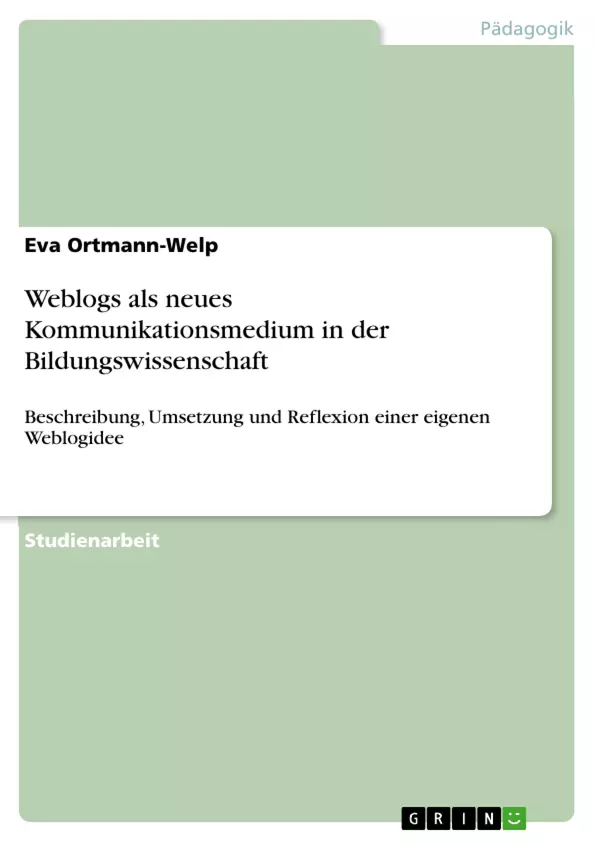Neue Medien lassen sich in der heutigen Zeit nicht mehr wegdenken. Aufgrund der Entwicklung von der Industrie- zur Wissensgesellschaft bieten gerade heutige Informations- und Kommunikationstechnologien Möglichkeiten, die Forderungen nach Lebenslangem Lernen, Kompetenzaufbau und der Aktualisierung des Wissens zu erfüllen. Hier ist insbesondere die Bildungswissenschaft gefordert, Potentiale neuer Technologien zu erkennen und gewinnbringend für die Bildung zu nutzen. Eine fortwährende Reduzierung der Halbwertzeit des Wissens kann durch alleinige formale Bildungsangebote kaum kompensiert werden. Neue Medien bieten aktuelle dynamische Inhalte in Hypertext- und Hypermedia-Form, die orts- und zeitunabhängig abrufbar sind. Zudem ermöglichen sie ein selbstgesteuertes und flexibles Lernen und je nach Medienform ebenso eine Wissenskonstruktion durch kommunikative und kollaborative Prozesse.
Das Internet der zweiten Generation (Web 2.0 bzw. Social Software) hat die Möglichkeit der persönlichen Partizipation aufgrund einer vereinfachten Technik immens ausgeweitet. Zum einen sind Internetnutzer nicht mehr nur Consumer oder Rezipienten, sie können selber zum Producer werden und aktiv ihr Wissen in Netzdienste einbringen. Zum anderen ist der gesteigerte Vernetzungscharakter hervorzuheben, der neue, veränderte Formen sozialer Interaktion hervorbringt. Ein Zusammenschluss mit anderen zu Learning Communities kann eine höhere Lernmotivation und eine kollaborative Wissenskonstruktion bewirken.
Neben Wikis stellen insbesondere Weblogs die Möglichkeit dar, sich an diesem Web aktiv zu beteiligen und die Forderung der heutigen Gesellschaft nach Lebenslangem Lernen, Wissens- und Kompetenzaufbau erfüllen zu können. Medienkompetenz wird hierbei zu einer wichtigen Schlüsselqualifikation, die in der heutigen Zeit als unerlässlich gesehen werden darf und die eine wichtige kulturelle Teilhabe bedeutet.
Diese Hausarbeit beschäftigt sich vorrangig mit dem Thema der Nutzung von Weblogs in der Bildungswissenschaft und stellt ein eigenes konzipiertes Weblog vor, das ebenso einen bildungswissenschaftlichen Bezug hat.
Inhaltsverzeichnis Seite
1 Einleitung
2 Weblogs und ihre Nutzungsformen
2.1 Definition
2.2 Funktionsweisen und Elemente von Weblogs
2.3 Funktionen und Motive von Weblogs in der Bildungswissenschaft
3 Die Verfahrensschritte des Instructional Designs
4 Das eigene Weblog „Lehr- Instrumente“
4.1 Funktionen, Motive und die Konzeption des Weblogs
4.2 Umsetzung der Weblogidee: Gestaltung und Aufbau
5 Reflexion
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielen Weblogs in der Bildungswissenschaft?
Weblogs dienen als Werkzeuge für selbstgesteuertes Lernen, Kompetenzaufbau und die kollaborative Wissenskonstruktion im Web 2.0.
Was bedeutet "Web 2.0" für Lernende?
Nutzer sind nicht mehr nur Konsumenten, sondern werden zu Produzenten (Prosumern), die aktiv Wissen in Netzdienste einbringen.
Warum ist Medienkompetenz eine Schlüsselqualifikation?
Sie ist unerlässlich für die kulturelle Teilhabe und ermöglicht den effektiven Umgang mit digitalen Informationen im Rahmen des Lebenslangen Lernens.
Was ist das Weblog "Lehr-Instrumente"?
Ein im Rahmen der Arbeit konzipiertes Blog, das bildungswissenschaftliche Inhalte und Werkzeuge für die Lehre vorstellt.
Wie unterstützen Weblogs das Lebenslange Lernen?
Sie bieten dynamische, ortsunabhängige Inhalte und fördern die Vernetzung in Learning Communities.
- Arbeit zitieren
- Eva Ortmann-Welp (Autor:in), 2012, Weblogs als neues Kommunikationsmedium in der Bildungswissenschaft, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210186