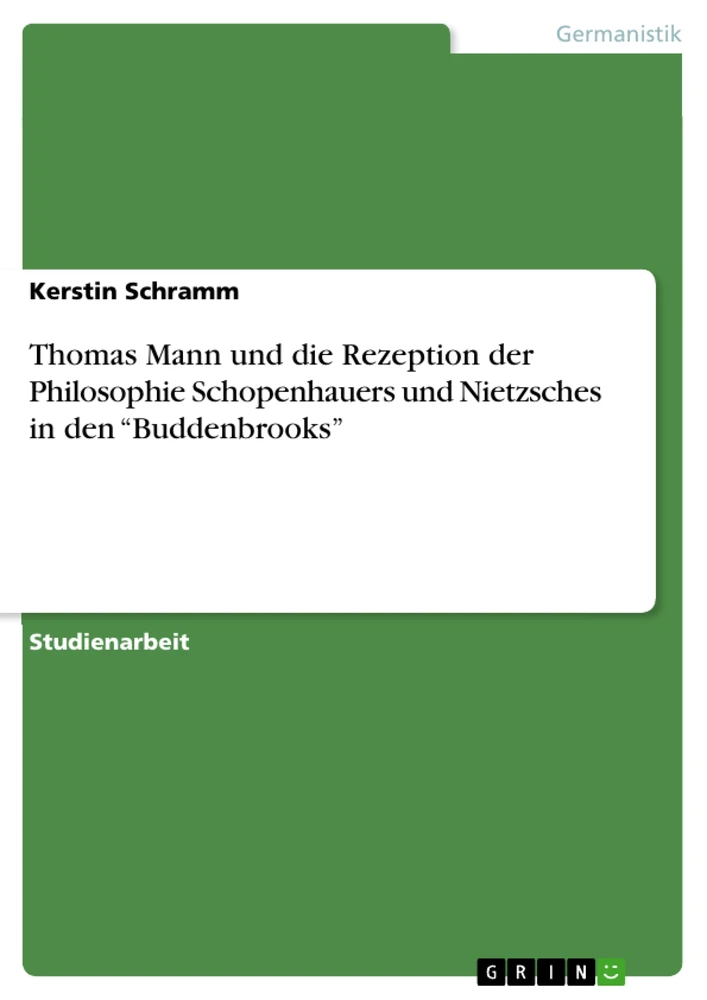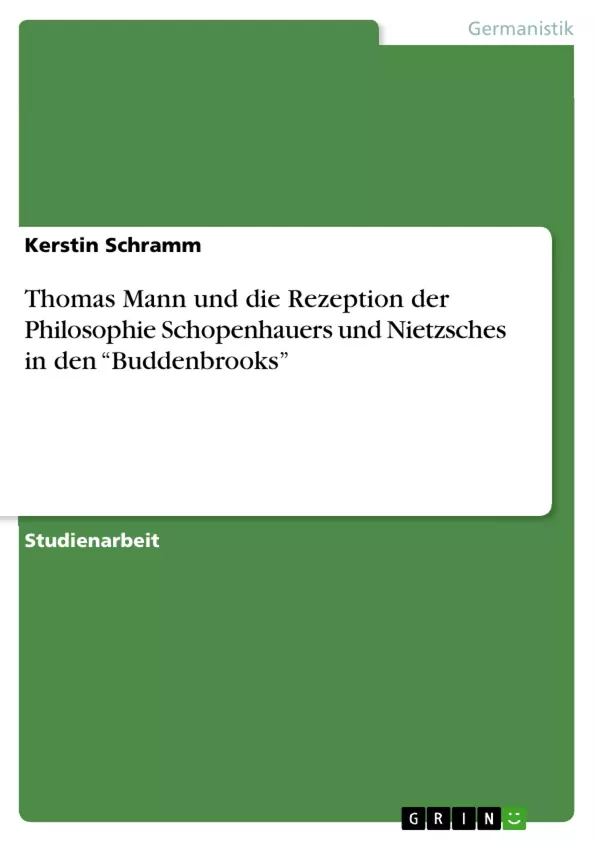Angeblich handelte es sich „bei Thomas Manns Verhältnis zur Philosophie […] recht besehen um ein Unverhältnis“ , die philosophischen Kenntnisse Thomas Manns seien gering gewesen. Der Einfluss der Philosophie Schopenhauers auf die „Buddenbrooks“ ist umstritten. Nach Thomas Manns Selbstaussagen in einem Brief an Agnes E. Meyer vom Januar 1951 hat er Schopenhauers „Welt als Wille und Vorstellung“ erst kennen gelernt, als er bereits im letzten Drittel des Buches stand. Später heißt es, „Schopenhauers pessimistische Moral, Nietzsche´s Décadence-Psychologie […] waren die Bildungselemente, die dem Erzählwerk des Dreiundzwanzig- bis Fünfundzwanzigjährigen (Thomas Mann), >Buddenbrooks< […] zur Gestalt verhalfen“. Ziel der Arbeit ist es, zu ermitteln, in wie weit die Philosophie Nietzsches und Schopenhauers Thomas Manns Werk „Buddenbrooks“ nun tatsächlich beeinflusst hat - oder auch nicht.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Thomas Manns Schopenhauer-Leseerlebnis
- Thomas Buddenbrooks Leseerlebnis
- Schopenhauer-Lektüre als religiöses Erlebnis
- Die Philosophie Schopenhauers und Nietzsches im Vergleich
- Der Wille
- Der Verstand
- Die Lösungsmodelle
- Schopenhauers Lösungsmodell
- Nietzsches Lösungsmodell
- ,,Kreativer Missbrauch“ der Philosophie bei Thomas Buddenbrook
- Die Quintessenz des Romans aus Philosophischer Perspektive
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss der Philosophie Schopenhauers und Nietzsches auf Thomas Manns Roman „Buddenbrooks“. Sie beleuchtet insbesondere die Rezeption der beiden Philosophen im Kontext der literarischen Décadence des Fin de siècle und analysiert die Rolle der Philosophie im Leben und Werk des Protagonisten Thomas Buddenbrook. Die Arbeit möchte verstehen, wie Schopenhauers und Nietzsches Ideen in den Roman eingeflossen sind und welche Auswirkungen sie auf dessen Handlung und Figuren haben.
- Die Rezeption der Philosophie Schopenhauers und Nietzsches im Kontext der literarischen Décadence des Fin de siècle
- Die Rolle der Philosophie im Leben und Werk des Protagonisten Thomas Buddenbrook
- Die Verarbeitung von Schopenhauer und Nietzsches Ideen in der Handlung und Figuren des Romans
- Die Bedeutung der Schopenhauer-Lektüre für Thomas Buddenbrooks Entwicklung und sein Verhältnis zum Leben und Tod
- Die Frage nach der tatsächlichen Bedeutung der Philosophie für die Gesamtkonzeption des Romans „Buddenbrooks“
Zusammenfassung der Kapitel
Das Vorwort stellt die Forschungsfrage und den Fokus der Arbeit vor. Es beleuchtet die kontroversen Aussagen Thomas Manns zu seiner Beziehung zur Philosophie und dem Einfluss von Schopenhauer und Nietzsche auf seine Werke. Das zweite Kapitel widmet sich Thomas Manns eigenem Schopenhauer-Leseerlebnis und dessen Verarbeitung in den „Buddenbrooks“. Es beschreibt, wie Thomas Buddenbrook in Kapitel 5 des Romans ein ähnliches Leseerlebnis erlebt wie Thomas Mann selbst. Das dritte Kapitel betrachtet Schopenhauer-Lektüre als ein religiöses Erlebnis und die zentralen philosophischen Themen Schopenhauers, wie den Willen und die Verneinung des Willens, die in der „Buddenbrooks“ analysiert werden.
Im vierten Kapitel werden die Philosophien Schopenhauers und Nietzsches verglichen. Es wird auf die zentralen Themen beider Philosophen, insbesondere die Konzepte von Wille, Verstand und den Lösungsmodellen, eingegangen. In den folgenden Kapiteln wird die Philosophie bei Thomas Buddenbrook, die Quintessenz des Romans aus philosophischer Perspektive sowie ein Schlusswort behandelt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen: Schopenhauer, Nietzsche, Buddenbrooks, Décadence, Fin de siècle, Philosophie, Wille, Verstand, Pessimismus, Tod, Leben, Moral, Literatur, Roman, Existenzialismus, „Welt als Wille und Vorstellung“.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusste Schopenhauer Thomas Manns "Buddenbrooks"?
Schopenhauers Pessimismus und sein Werk "Die Welt als Wille und Vorstellung" prägten vor allem das letzte Drittel des Romans und die philosophische Entwicklung der Figur Thomas Buddenbrook.
Welche Rolle spielt Nietzsches Philosophie im Roman?
Nietzsches "Décadence-Psychologie" diente als Bildungselement, um den Verfall der Familie Buddenbrook über vier Generationen hinweg psychologisch und kulturell zu untermauern.
Was bedeutet der "kreative Missbrauch" der Philosophie bei Thomas Buddenbrook?
Der Begriff beschreibt, wie die literarische Figur philosophische Ideen (insb. Schopenhauer) subjektiv interpretiert, um Trost angesichts des eigenen Verfalls und des Todes zu finden.
Wann las Thomas Mann Schopenhauer tatsächlich?
Laut eigenen Angaben lernte Thomas Mann Schopenhauer erst kennen, als er bereits am letzten Drittel der "Buddenbrooks" schrieb, was die Wirkung der Lektüre auf das Romanende erklärt.
Was ist die Quintessenz des Romans aus philosophischer Sicht?
Der Roman thematisiert den Konflikt zwischen dem vitalen Lebenswillen und der lähmenden Erkenntnis durch den Geist, was letztlich zum biologischen und wirtschaftlichen Niedergang führt.
- Quote paper
- Kerstin Schramm (Author), 2004, Thomas Mann und die Rezeption der Philosophie Schopenhauers und Nietzsches in den “Buddenbrooks”, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210461