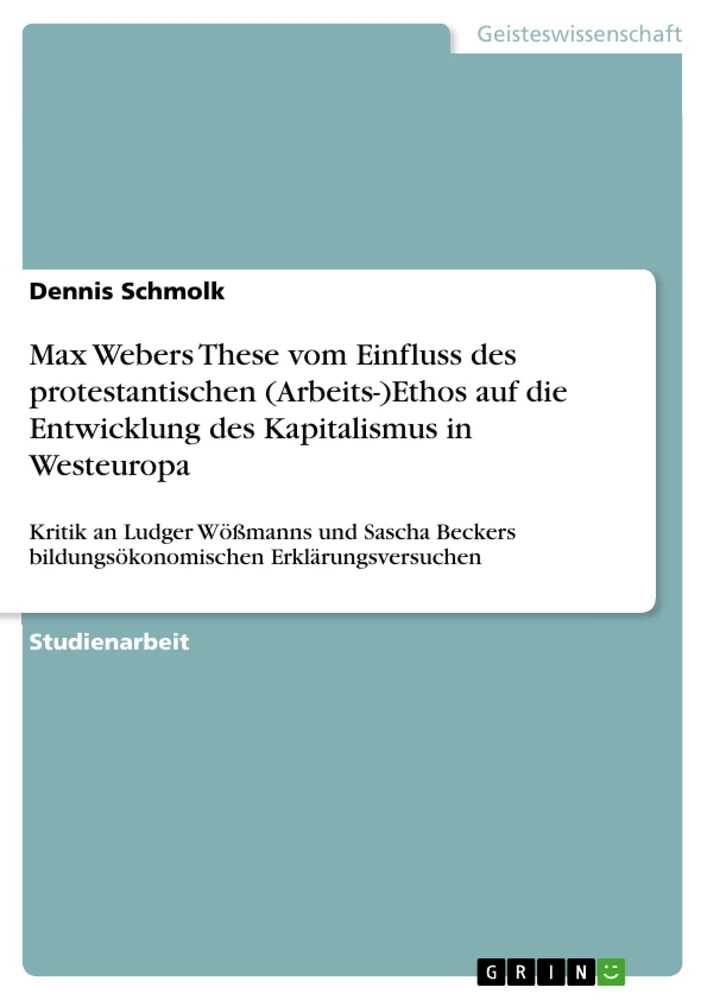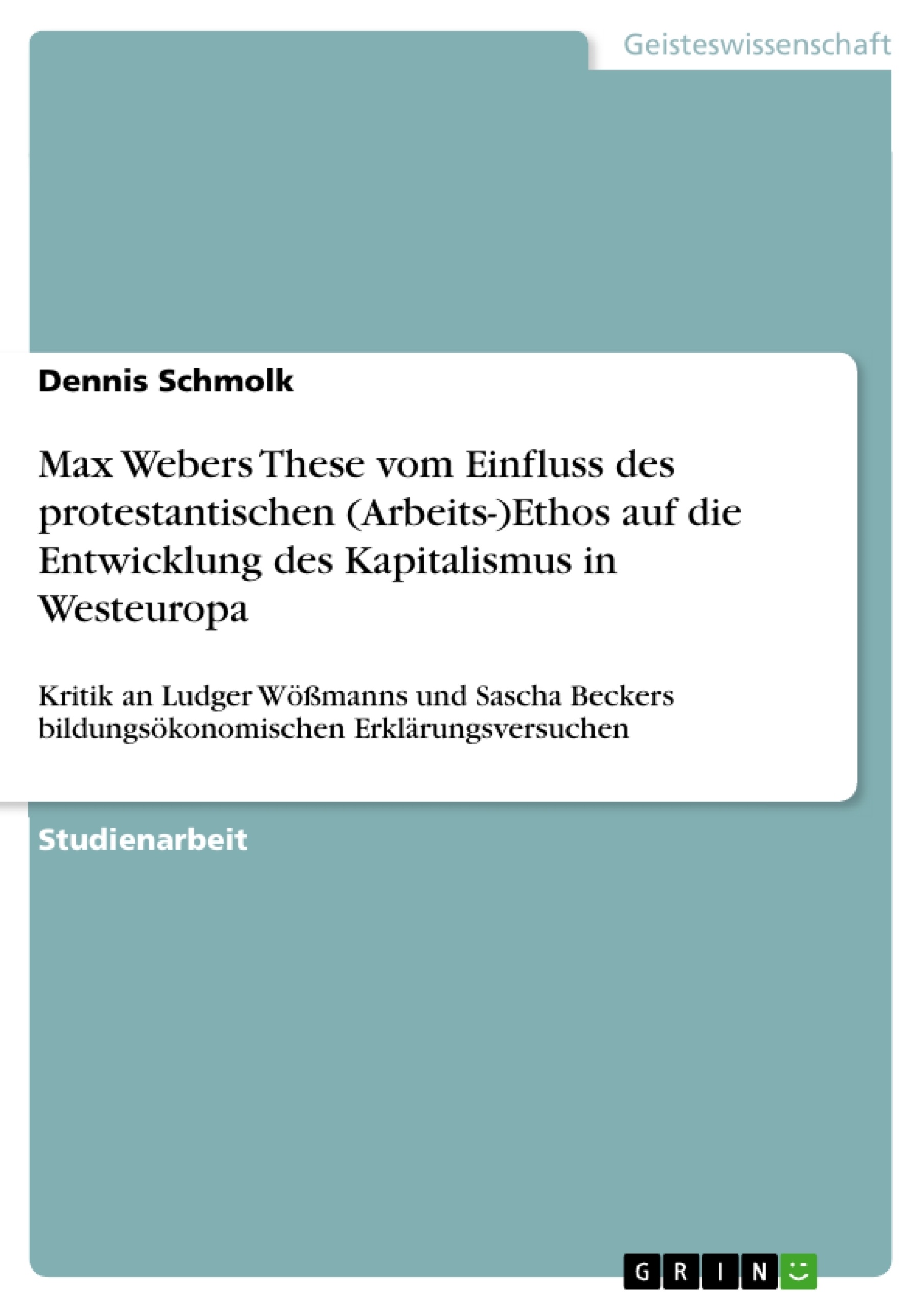Grundsätzlich bedarf jede wissenschaftliche Theorie der empirischen Überprüfung (oder zumindest der Überprüfbarkeit), um als „wissenschaftlich“ gelten zu können. Dies gilt selbstredend auch für die Geistes- und Sozialwissenschaften, also auch für die Soziologie.
Die folgende Arbeit versucht, eine bildungsökonomische Kritik an Webers
empirischen Methoden bei der Erstellung seines Hauptwerks „Die protestantische
Ethik und der Geist des Kapitalismus“ darzustellen und aufzuzeigen,
inwieweit diese Kritik auch zu einer Kritik der Theorie führen muss. Ziel
dieser Arbeit ist eine kritische Würdigung der daraus entstehenden neuen
Perspektiven auf Webers Werk und abschließend der Versuch, aufzuzeigen,
was von diesem weiterhin Gültigkeit hat.
Inhaltsverzeichnis
1 Soziologische Theorien auf dem empirischen Prüfstand
2 Neue Perspektiven in der Diskussion von Max Webers Schrift „Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus“?
2.1 Webers These vom Einfluss der Konfession auf die wirtschaft- liche Situation
2.1.1 Wissenschaftshistorische Vorbemerkung
2.1.2 Die protestantische Ethik
2.1.3 Der Geist des Kapitalismus: Webers Darstellung des modernen Kapitalisten
2.2 Ludger Wößmanns und Sascha Beckers Erklärung über die Drittvariable „Bildung“
2.2.1 Exkurs: Drittvariablen in der empirischen Sozialfor- schung
2.2.2 Wößmanns und Beckers Methodik
2.2.3 Ergebnisse: Bildung erklärt die Einkommensunterschie- de von Protestanten und Katholiken
2.3 Kritik an der Methode Wößmanns und Beckers
2.3.1 Cui bono: Einsichten aus der Bildungsökonomie
2.3.2 Das Ethos als Ursache des Schulfleißes
2.3.3 Was bleibt von Webers These?
3 Abschließende Gedanken
3.1 Theologische Probleme
3.2 Forschungsfeld: Der Kapitalismus als Religion
4 Bibliographie
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kernaussage von Max Webers These zum Kapitalismus?
Weber postuliert, dass das protestantische Arbeitsethos eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des modernen Kapitalismus in Westeuropa gespielt hat.
Wie lautet die Kritik von Wößmann und Becker an Weber?
Sie argumentieren, dass nicht die religiöse Ethik an sich, sondern die durch den Protestantismus geförderte "Bildung" die eigentliche Ursache für wirtschaftliche Unterschiede war.
Was versteht Weber unter dem "Geist des Kapitalismus"?
Es beschreibt die spezifische Lebensführung und Einstellung des modernen Kapitalisten, die durch Rationalität, Fleiß und Askese geprägt ist.
Warum ist die empirische Überprüfung von Webers Theorie schwierig?
Wissenschaftshistorisch wird kritisiert, dass Webers Methoden heute bildungsökonomisch hinterfragt werden müssen, da Drittvariablen wie Bildung oft nicht ausreichend isoliert wurden.
Hat Webers Werk heute noch Gültigkeit?
Die Arbeit untersucht dies kritisch und beleuchtet neue Perspektiven, wie etwa das Forschungsfeld "Kapitalismus als Religion".
- Citation du texte
- Dennis Schmolk (Auteur), 2009, Max Webers These vom Einfluss des protestantischen (Arbeits-)Ethos auf die Entwicklung des Kapitalismus in Westeuropa, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210598