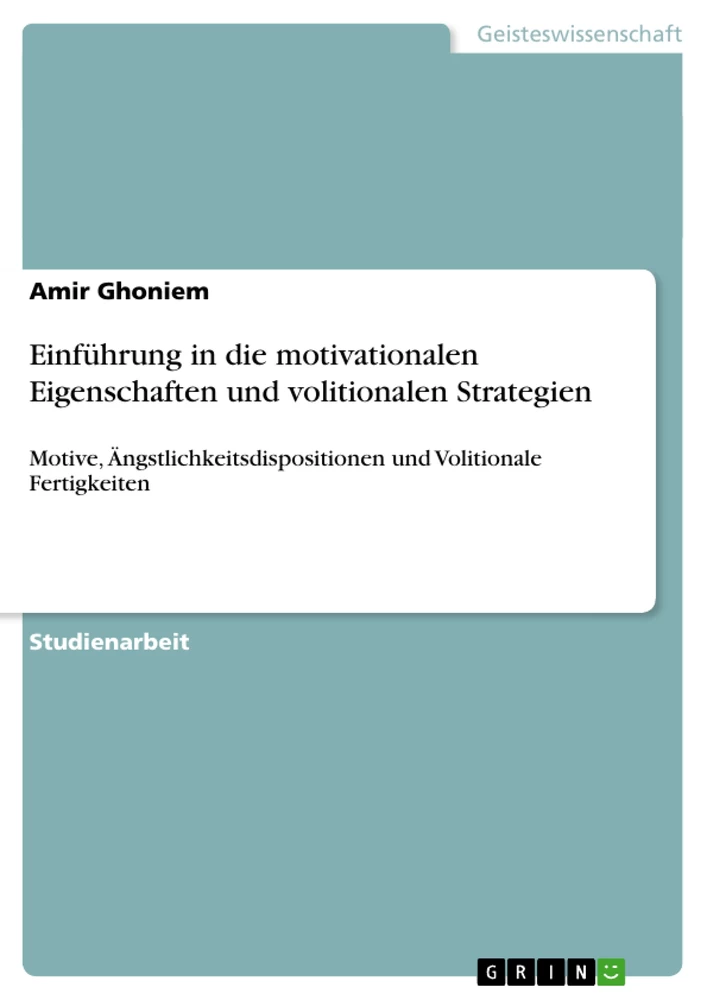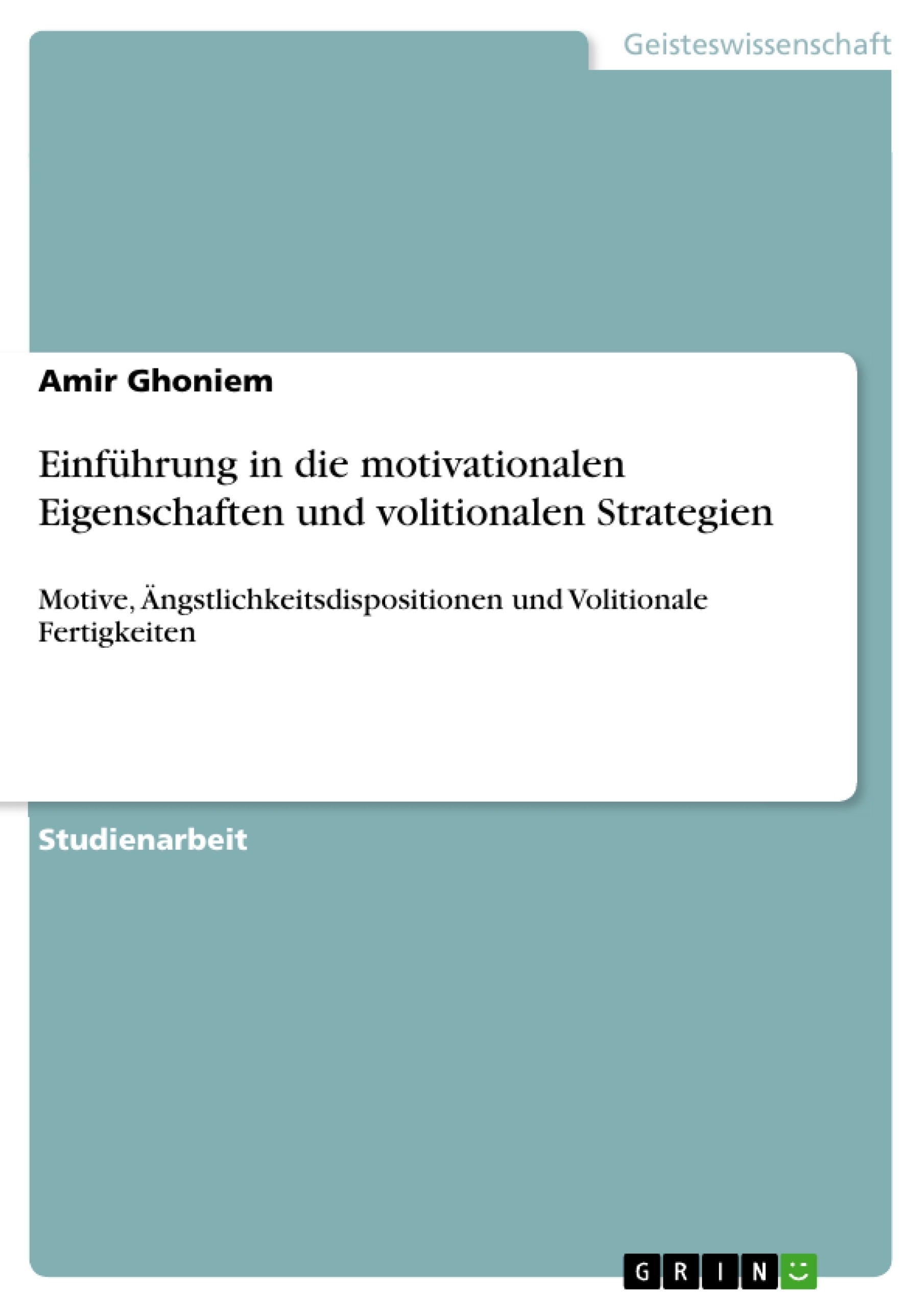In dem folgenden Artikel, sollen motivationale Eigenschaften und volitionale Strategien
vorgestellt werden. Dabei liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Unterscheidung impliziter
und expliziter Motive. Daraufhin wird ein motivationales Problem anhand eines Fallbeispiels
betrachtet und anhand den dargestellten theoretischen und empirischen Erkenntnissen
diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Motivational Traits
- Leistungsmotiv
- Angst
- Motivmessung
- Explizite Motivtests
- Implizite Motivtests
- Volition
- Fallbeispiel
- Problembeschreibung und Problemanalyse
- Handlungsempfehlungen
- Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Artikel präsentiert motivationale Eigenschaften und volitionale Strategien mit besonderem Fokus auf die Unterscheidung impliziter und expliziter Motive. Anhand eines Fallbeispiels wird ein motivationales Problem beleuchtet und unter Berücksichtigung theoretischer und empirischer Erkenntnisse diskutiert.
- Unterscheidung impliziter und expliziter Motive
- Das Leistungsmotiv und seine Komponenten (Hoffnung auf Erfolg, Furcht vor Misserfolg)
- Das Angstkonstrukt und seine verschiedenen Ausprägungen
- Volitionale Fertigkeiten und Selbstkontrolle
- Anwendung der Konzepte auf ein Fallbeispiel
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Der Artikel gibt eine Übersicht über motivationale Eigenschaften und volitionale Strategien, wobei der Schwerpunkt auf der Differenzierung zwischen impliziten und expliziten Motiven liegt. Ein Fallbeispiel dient der Veranschaulichung eines motivationalen Problems und seiner Diskussion im Kontext der vorgestellten Theorien und empirischen Befunde.
Motivational Traits: Dieses Kapitel etabliert das Rahmenmodell der Arbeitsmotivation von Kanfer und Heggestad (1997), welches motivationale Eigenschaften (stabile, domän-unspezifische Dispositionen wie Leistungsmotiv und Angst) von volitionalen Fertigkeiten (veränderliche, domän-spezifische Zustandsvariablen) unterscheidet. Es legt den Grundstein für die detailliertere Betrachtung dieser Eigenschaften in den folgenden Kapiteln.
Leistungsmotiv: Hier wird das Leistungsmotiv nach Heckhausen (1965) als das Bestreben definiert, die eigene Tüchtigkeit zu erhalten oder zu steigern, um einen verbindlichen Gütemaßstab zu erreichen. Die Unterscheidung zwischen Hoffnung auf Erfolg und Furcht vor Misserfolg (Heckhausen & Atkinson, 1957) wird erläutert, ebenso wie die Orientierungen „personal mastery“ und „competition excellence“ nach Kanfer und Heggestad (1997).
Angst: Dieses Kapitel beschreibt kurz das Angstkonstrukt nach Kanfer und Heggestad (1997), differenziert zwischen „fear of failure“, „test anxiety“ und „general anxiety“. Die Bedeutung dieser Variablen wird im Kontext des Leistungsmotivs und der motivationalen Eigenschaften herausgestellt, obwohl im Fallbeispiel kein spezifisches Angst-Messinstrument verwendet wird.
Motivmessung: Der Abschnitt unterscheidet zwischen expliziten (respondentes Verhalten, bewusst kontrolliert) und impliziten (operantes Verhalten, spontan) Motivtests. Explizite Tests wie Fragebögen sind anfällig für Selbstdarstellung und soziale Erwünschtheit, während implizite Tests wie der Thematische Apperzeptionstest oder der Multi-Motiv-Gitter weniger anfällig für Verzerrungen sind. Die unterschiedlichen Vor- und Nachteile der Methoden werden beleuchtet.
Volition: Dieses Kapitel behandelt die Rolle der Willenskraft und Selbstkontrolle (Volition) bei Diskrepanzen zwischen expliziten und impliziten Motiven. Es beschreibt verschiedene volitionalen Fertigkeiten wie Emotionskontrolle, Motivationskontrolle, Aufmerksamkeitskontrolle, Umweltkontrolle, Entscheidungskontrolle und handlungsorientierte Misserfolgsbewältigung. Die Grenzen der Selbstkontrolle und die Möglichkeit des „Erschöpfens“ der volitionalen Ressourcen werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Motivation, Volition, Leistungsmotiv, Angst, implizite Motive, explizite Motive, Motivmessung, Selbstkontrolle, volitionale Fertigkeiten, Fallbeispiel, Handlungskontrolle, Motivationskontrolle, Emotionskontrolle
Häufig gestellte Fragen zum Artikel: Motivationale Eigenschaften und Volitionale Strategien
Was ist der Inhalt dieses Artikels?
Der Artikel bietet einen umfassenden Überblick über motivationale Eigenschaften und volitionale Strategien. Er konzentriert sich insbesondere auf die Unterscheidung zwischen impliziten und expliziten Motiven und veranschaulicht dies anhand eines Fallbeispiels. Der Artikel beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zu motivationalen Merkmalen (insbesondere Leistungsmotiv und Angst), Motivmessung (explizit und implizit), Volition und ein abschließendes Kapitel mit Diskussion und Handlungsempfehlungen.
Welche motivationalen Eigenschaften werden behandelt?
Der Schwerpunkt liegt auf dem Leistungsmotiv mit seinen Komponenten Hoffnung auf Erfolg und Furcht vor Misserfolg sowie auf dem Angstkonstrukt mit seinen verschiedenen Ausprägungen (z.B. „fear of failure“, „test anxiety“, „general anxiety“). Das verwendete Rahmenmodell ist das der Arbeitsmotivation von Kanfer und Heggestad (1997).
Wie wird die Motivmessung beschrieben?
Der Artikel unterscheidet zwischen expliziten Motivtests (z.B. Fragebögen) und impliziten Motivtests (z.B. Thematischer Apperzeptionstest, Multi-Motiv-Gitter). Er erläutert die Vor- und Nachteile beider Methoden und betont die Anfälligkeit expliziter Tests für Selbstdarstellungseffekte.
Was ist die Rolle der Volition?
Der Artikel beschreibt Volition als Willenskraft und Selbstkontrolle, insbesondere im Kontext von Diskrepanzen zwischen impliziten und expliziten Motiven. Verschiedene volitionale Fertigkeiten wie Emotionskontrolle, Motivationskontrolle, Aufmerksamkeitskontrolle etc. werden diskutiert, ebenso wie die Grenzen der Selbstkontrolle und das „Erschöpfen“ volitionaler Ressourcen.
Wie wird das Fallbeispiel verwendet?
Das Fallbeispiel dient der Veranschaulichung eines motivationalen Problems. Es wird eine Problembeschreibung und -analyse gegeben, gefolgt von Handlungsempfehlungen, die auf den im Artikel dargestellten Theorien und empirischen Befunden basieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Artikel am besten?
Schlüsselwörter sind: Motivation, Volition, Leistungsmotiv, Angst, implizite Motive, explizite Motive, Motivmessung, Selbstkontrolle, volitionale Fertigkeiten, Fallbeispiel, Handlungskontrolle, Motivationskontrolle, Emotionskontrolle.
Welche Theorien werden im Artikel verwendet?
Der Artikel stützt sich auf das Rahmenmodell der Arbeitsmotivation von Kanfer und Heggestad (1997) und integriert Konzepte des Leistungsmotivs nach Heckhausen (1965) und Heckhausen & Atkinson (1957).
Für wen ist dieser Artikel gedacht?
Der Artikel richtet sich an ein akademisches Publikum, das sich mit Motivationspsychologie beschäftigt. Er eignet sich für Studierende und Wissenschaftler, die sich mit Themen wie Leistungsmotiv, Angst, implizite und explizite Motive sowie Volition auseinandersetzen.
- Quote paper
- Cand.-Psych. Amir Ghoniem (Author), 2011, Einführung in die motivationalen Eigenschaften und volitionalen Strategien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210670