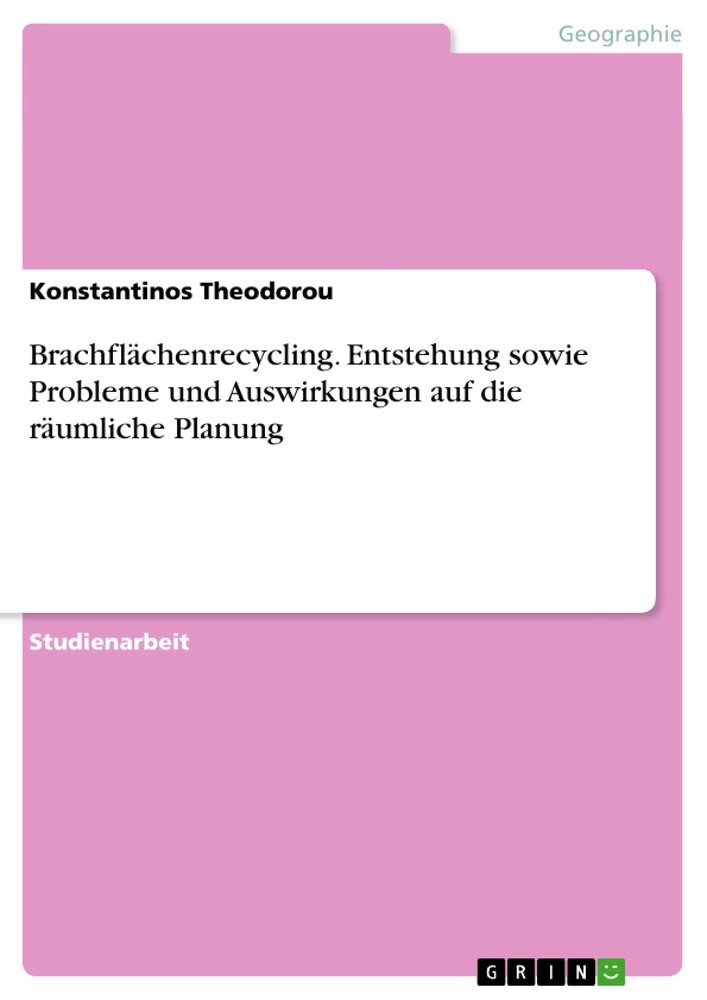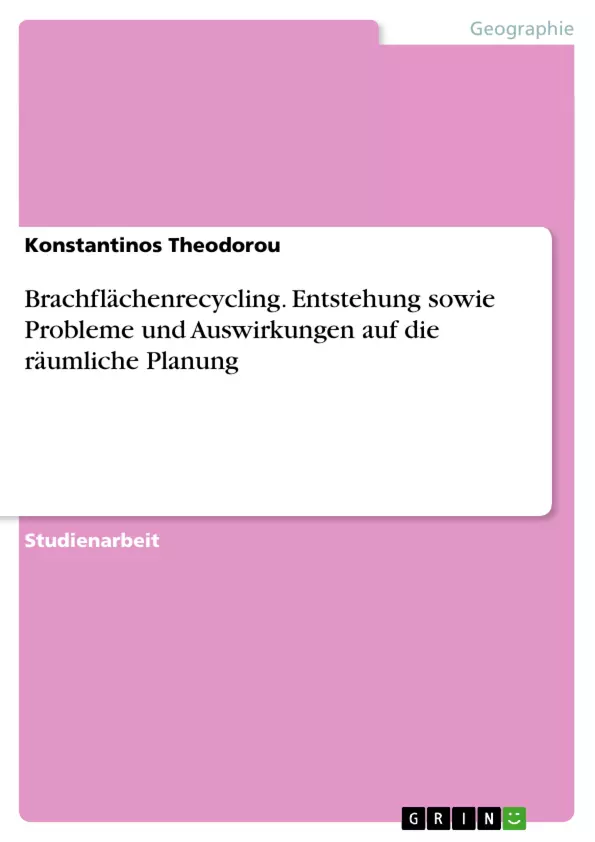Die vorliegende deskriptive Hausarbeit des Moduls „Räumliche Planung“ befasst sich mit dem Thema Brachflächenrecycling. Gerade im Prozess des Strukturwandels gibt es immer größere, ungenutzte Flächen und einen analog dazu erhöhten Flächenbedarf der Industrie, aber auch der Wohnnutzung. Es liegt nahe, dass in der räumlichen Planung angesichts des Flächenbedarfs, diese Flächen in Hinblick auf eine Wiedernutzung eine wichtige Rolle spielen. Jedoch ist das Brachflächenrecycling mit ökologischen – z.B. den sogenannten Altlasten, ökonomischen und planerischen Problemen behaftet, auf die ich im Laufe dieser Arbeit eingehen möchte. Dazu werde ich zunächst neben einer Definition des Begriffs „Brachflächenrecycling“ die Entstehung von Brachflächen, die Probleme sowie die Auswirkungen auf die räumliche Planung erläutern. Anschließend möchte ich noch einige Lösungsvorschläge vorstellen, wie diese großen Flächenpotentiale sinnvoll genutzt werden können.
Inhaltsverzeichnis:
1 Einleitung
2 Brachflächenrecycling
2.1 Definition
2.2 Entstehung und besondere Problemstellung von Brachflächen
2.3 Auswirkungen auf die Raum- und Stadtplanung
3 Lösungsansätze und Beispiele für eine erfolgreiche Brachflächensanierung
4 Fazit
5 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Die vorliegende deskriptive Hausarbeit des Moduls „Räumliche Planung“ befasst sich mit dem Thema Brachflächenrecycling. Gerade im Prozess des Strukturwandels gibt es immer größere, ungenutzte Flächen und einen analog dazu erhöhten Flächenbedarf der Industrie, aber auch der Wohnnutzung. Es liegt nahe, dass in der räumlichen Planung angesichts des Flächenbedarfs, diese Flächen in Hinblick auf eine Wiedernutzung eine wichtige Rolle spielen. Jedoch ist das Brachflächenrecycling mit ökologischen – z.B. den sogenannten Altlasten, ökonomischen und planerischen Problemen behaftet, auf die ich im Laufe dieser Arbeit eingehen möchte. Dazu werde ich zunächst neben einer Definition des Begriffs „Brachflächenrecycling“ die Entstehung von Brachflächen, die Probleme sowie die Auswirkungen auf die räumliche Planung erläutern. Anschließend möchte ich noch einige Lösungsvorschläge vorstellen, wie diese großen Flächen-potentiale sinnvoll genutzt werden können.
2 Brachflächenrecycling
In diesem Abschnitt sollen die Fragen geklärt werden, was Brachflächenrecycling ist, welche Probleme beim Recyceln entstehen und welche Auswirkungen dies auf die kommunale und allgemeine Stadtplanung hat.
2.1 Definition
Das Bundesamt für Bauwesen und Raumplanung bezeichnet Brachflächen als „Flächen, die aufgrund ihrer Lage, ihrer natürlichen Bedingungen oder wegen ihrer ehemaligen Nutzungen nicht mehr wirtschaftlich genutzt werden können, weil die Kosten einer Erschließung oder Aufbereitung im Verhältnis zu einem möglicherweise auf diesen Flächen zu erwirtschaftenden Gewinn zu hoch sind.“ (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung: Internetquelle) Das Problem bei Brachflächen ist also in erster Linie ökonomischer Natur. Das Recycling, dass diesen Zustand entgegenwirken soll impliziert allerdings auch den ökologischen und sozialen Aspekt: „Flächenrecycling ist die nutzungsbezogene Wiedereingliederung solcher Grundstücke in den Wirtschafts- und Naturkreislauf, die ihre bisherige Funktion und Nutzung verloren haben“ [...] (ebd.). Die neuen Funktionen können sich über eine erneute Ansiedlung von Betrieben, Wohnnutzung, Anlage von Grünflächen und dergleichen mehr erstrecken.
2.2 Entstehung und besondere Problemstellung von Brachflächen
Die Gründe, dass eine genutzte Fläche zur Brachfläche wird sind sehr vielfältig. Dazu gehören z.B. das Fehlen von Erweiterungsflächen, aber auch Konzentrationsprozesse und Auflagen zum Immissionsschutz. (Kahnert 1992: 11). In vielen Fällen kommt es in Verbindung mit der industriellen Nutzung zu Kontaminationen bzw. Entstehung von Altlasten, etwa durch unkontrollierte Ablagerung und Versickerung von bedenklichen Industrieabfällen, die eine Gefährdung von Mensch und Umwelt darstellen (Kahnert 1987: 3). Diese wieder zu beseitigen kann sehr aufwändig und teuer sein (Altlastensanierung). Hinzu kommen weitere finanzielle Aspekte wie z.B. überzogene Preisvorstellungen beim Verkauf der Flächen sowie der Anreiz für Investoren sich auf Freiflächen anzusiedeln (Kahnert 1992: 14). Diese Ansiedlung auf der „grünen Wiese“ ist aus der Sicht der Unternehmen ökonomisch oftmals die bessere Alternative. Allerdings geschieht das auf Kosten der endlichen Ressource Fläche und führt zu Zersiedlung, da die neuausgewiesenen Flächen meist in ökologisch wertvollen Außenbereichen liegen (Genske et al. 1995: 29). Dabei werden allein in Deutschland täglich über 90ha in Anspruch genommen (Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen: Internetquelle). Das trotz sinkender Einwohnerzahlen und stagnierender Wirtschaft immer mehr Fläche benötigt wird, liegt zum Einen an Image und Flexibilität der Unternehmen sowie an der Automatisierung innerhalb der Produktion (Kahnert 1992: 3). Zum Anderen sind die Wohnansprüche der Bevölkerung, wie etwa die durchschnittliche Wohnfläche oder der Anspruch an die Lage, gestiegen (Reiß-Schmidt 1997). Im Zuge der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung sollen diese Flächen jedoch auf das erhebliche Brach-flächenpotential der Kommunen und privater Akteure von etwa 130.000ha abgewälzt werden und somit die Flächeninanspruchnahme bis zum Jahr 2020 auf täglich 30ha reduziert werden (Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen: Internetquelle).
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist Brachflächenrecycling?
Die Wiedereingliederung von ehemals genutzten, nun ungenutzten Flächen (z.B. alte Fabrikgelände) in den Wirtschafts- oder Naturkreislauf.
Warum entstehen industrielle Brachflächen?
Gründe sind Strukturwandel, Betriebsverlagerungen, fehlende Erweiterungsflächen oder strenge Immissionsschutzauflagen.
Was sind "Altlasten" beim Flächenrecycling?
Kontaminationen des Bodens oder Grundwassers durch frühere industrielle Nutzung, deren Beseitigung oft sehr teuer und technisch aufwendig ist.
Warum bauen Unternehmen lieber auf der "grünen Wiese"?
Die Erschließung neuer Flächen im Außenbereich ist oft billiger und unkomplizierter als die Sanierung belasteter Brachflächen im Innenstadtbereich.
Welches Ziel verfolgt die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung?
Ziel war es, die tägliche Flächeninanspruchnahme in Deutschland bis 2020 auf 30 Hektar zu reduzieren, unter anderem durch verstärktes Recycling von Brachflächen.
- Citar trabajo
- Konstantinos Theodorou (Autor), 2006, Brachflächenrecycling. Entstehung sowie Probleme und Auswirkungen auf die räumliche Planung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210733