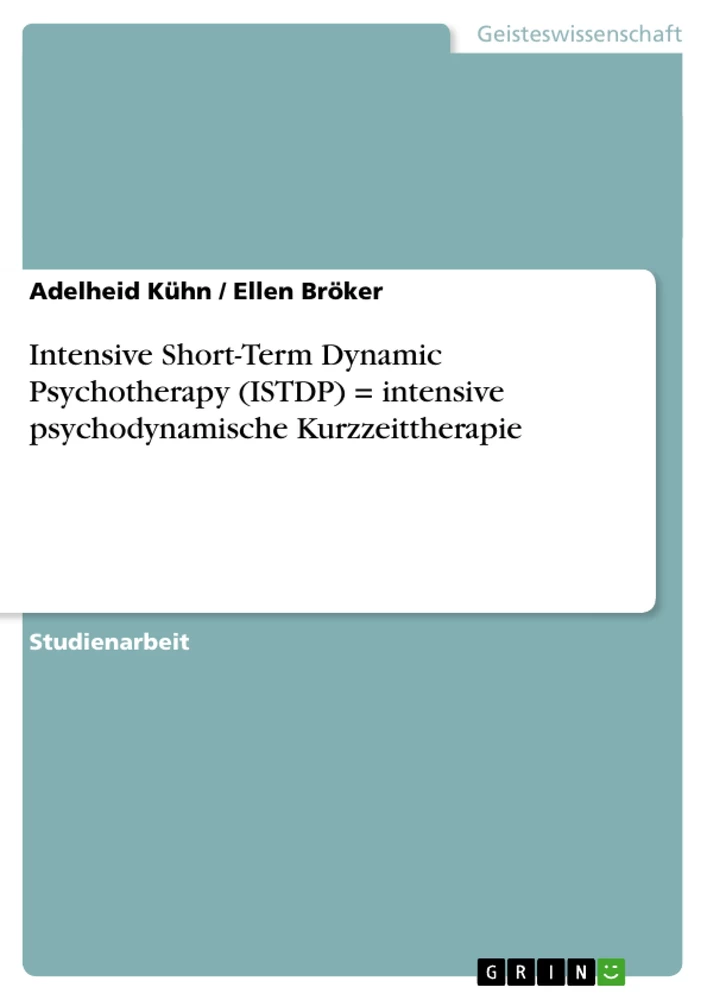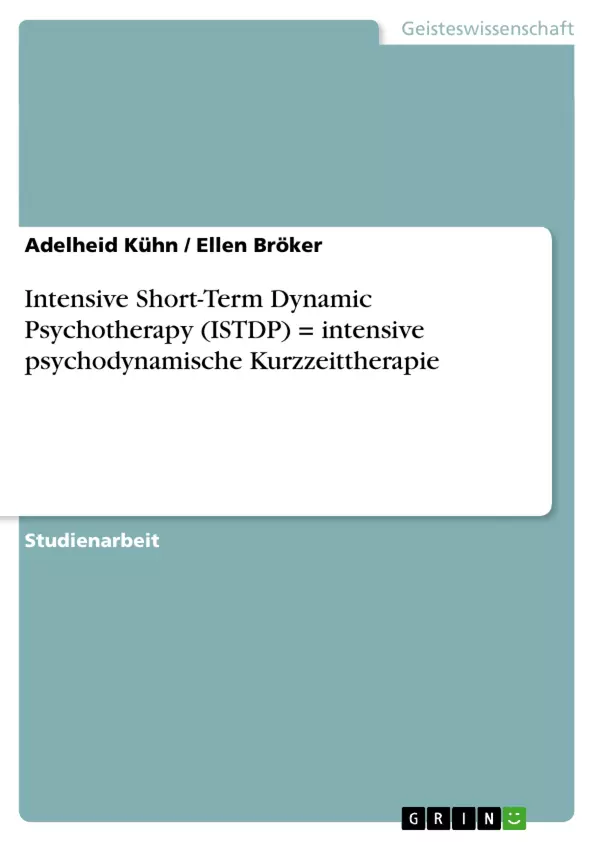Die ISTDP ist eine psychotherapeutische Methode, die von bereits ausgebildeten Therapeuten verschiedener Richtungen zusätzlich erlernt wird, aber kassenärztlich nicht zugelassen ist. Die Methode ist abgeleitet aus der Psychoanalyse und arbeitet im wesentlichen mit und in der Übertragung, wobei davon ausgegangen wird, daß der Patient bereits Übertragungsbereitschaft in die Therapie mitbringt, d.h. den Therapeuten als primäre Bezugsperson sieht. Übertragungsbereitschaft hat generell jeder Mensch. Entdeckt wurde dies von Freud und konsequent angewandt und umgesetzt hat dies Davanloo. Die Methode wird sehr kontrovers diskutiert und kann auch kontroverse Gefühle bei Beobachtern des Verfahrens auslösen, wie z.B. Faszination oder Aggression und Abwehr.
Inhaltsverzeichnis
- Gemeinsamkeiten mit der Psychoanalyse
- Unterschiede zur Psychoanalyse
- Die ISTDP zielt ab auf
- Indikation
- Kontraindikation
- Theoretischer Hintergrund
- Psychische Phänomene
- Abwehrmechanismen
- Angst
- Gefühle
- Psychische Phänomene
- Interventionen: Zentraldynamische Sequenz der ISTDP
- Probetherape
- Interventionsmethoden
- Therapiephasen und ihre Auswirkungen
- Zugangswege zum Unbewussten
- Zusätzliche Technik für Sonderfälle
- Anforderungen an den Therapeuten
- Therapeutische Haltung bzw. Aktivität
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit bietet einen Überblick über die Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) nach Habib Davanloo. Ziel ist es, die zentralen Prinzipien, Methoden und Anwendungsbereiche dieser psychotherapeutischen Methode darzustellen und sie im Kontext der Psychoanalyse zu verorten. Die Arbeit beleuchtet Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu traditionellen psychoanalytischen Ansätzen.
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen ISTDP und Psychoanalyse
- Zentrale Interventionen und die „Zentraldynamische Sequenz“
- Indikationen und Kontraindikationen für die ISTDP
- Der theoretische Hintergrund und die Rolle psychischer Phänomene (Abwehrmechanismen, Angst, Gefühle)
- Anforderungen an den Therapeuten und die therapeutische Haltung
Zusammenfassung der Kapitel
Gemeinsamkeiten mit der Psychoanalyse: Dieses Kapitel beschreibt die Übereinstimmungen zwischen ISTDP und der Psychoanalyse. Beide Ansätze zielen auf die Aufdeckung und Durcharbeitung verdrängter Ursachen psychischer Störungen ab, wobei unverarbeitete traumatische Erlebnisse mit Bezugspersonen als Motor für neurotische Symptome gesehen werden. Die Nutzung der Übertragung und die Widerstandsanalyse spielen in beiden Verfahren eine zentrale Rolle. Der Fokus liegt auf der Befreiung durch die Aufdeckung des Verdrängten und der Integration der Erkenntnisse.
Unterschiede zur Psychoanalyse: Im Gegensatz zur klassischen Psychoanalyse legt die ISTDP Wert auf eine rasche Mobilisierung des Unbewussten und einen schnellen Durchbruch verdrängter Gefühle. Die freie Assoziation wird durch die gezielte Beobachtung und Nutzung von Übertragungsgefühlen ersetzt. Das Ziel ist die Vermeidung einer Übertragungsneurose und die Förderung einer aktiven therapeutischen Allianz.
Die ISTDP zielt ab auf: Dieses Kapitel beschreibt die konkreten Ziele der ISTDP, darunter das Herausfordern von Widerständen, die Aufdeckung intensiver Übertragungsgefühle und die Schaffung von Situationen, die einen direkten Zugang zum Unbewussten ermöglichen. Es wird auf die Mobilisierung der Kernneurose und die Arbeit mit den psychodynamischen Kräften der Störung eingegangen.
Indikation: Hier werden die geeigneten Anwendungsbereiche der ISTDP aufgeführt, darunter neurotische Erkrankungen, Persönlichkeitsstörungen und psychosomatische Störungen. Es wird betont, dass die ISTDP nicht für alle Patienten geeignet ist.
Kontraindikation: Dieses Kapitel listet die Situationen auf, in denen die ISTDP kontraindiziert ist, wie z.B. Psychosen, fragile Persönlichkeitsstrukturen, schwere Depressionen, Manien, schwere Borderline-Störungen und fortgeschrittener Substanzmissbrauch. Die Erkennung von Kontraindikationen erfolgt anhand von Lebensgeschichte und klinischen Zeichen.
Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel erläutert die Entwicklung der ISTDP durch die Analyse gefilmter Arzt-Patient-Interaktionen. Es wird die Entwicklung der „Zentraldynamischen Sequenz“ beschrieben und die Bedeutung gezielter Interventionen zur Mobilisierung komplexer Übertragungsgefühle hervorgehoben. Davanloo konzentrierte sich auf Abwehrmechanismen, Angst und Gefühle als zentrale psychische Phänomene.
Interventionen: Zentraldynamische Sequenz der ISTDP: [Anmerkung: Es wird davon ausgegangen, dass dieser Abschnitt detaillierte Interventionsschritte enthält, die hier aus Gründen der Kürze nicht zusammengefasst werden können. Eine detaillierte Beschreibung dieser Sequenz würde den Rahmen dieser Zusammenfassung sprengen.]
Therapiephasen und ihre Auswirkungen: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Phasen der ISTDP und ihre Auswirkungen auf den Patienten. Die Phasen umfassen die Befragung nach Schwierigkeiten, den Druck auf unterdrückte Gefühle, das Klären und Herausfordern von Abwehrmechanismen, den Angriff auf Widerstände im Über-Ich, die intrapsychische Krise und den Einblick in die Kernneurose, die Analyse von Übertragungsgefühlen, die Vervollständigung der Anamnese und die psychodynamische Formulierung und Therapieplanung.
Anforderungen an den Therapeuten: Dieser Abschnitt beschreibt die notwendigen Fähigkeiten und Eigenschaften eines ISTDP-Therapeuten, sowie die therapeutische Haltung und Aktivität.
Schlüsselwörter
Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP), Habib Davanloo, Psychoanalyse, Übertragung, Widerstandsanalyse, Abwehrmechanismen, Angst, Gefühle, Zentraldynamische Sequenz, Indikation, Kontraindikation, Unbewusstes, Kernneurose, therapeutische Allianz.
Häufig gestellte Fragen zu Intensiver Kurzzeit-Dynamischer Psychotherapie (ISTDP) nach Davanloo
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über die Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) nach Habib Davanloo. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung der Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf den Prinzipien, Methoden und Anwendungsbereichen der ISTDP im Vergleich zur Psychoanalyse.
Welche Gemeinsamkeiten bestehen zwischen ISTDP und Psychoanalyse?
Sowohl ISTDP als auch die Psychoanalyse zielen auf die Aufdeckung und Bearbeitung verdrängter Ursachen psychischer Störungen ab. Unverarbeitete traumatische Erlebnisse mit Bezugspersonen werden als Motor für neurotische Symptome angesehen. Übertragung und Widerstandsanalyse spielen in beiden Verfahren eine zentrale Rolle. Das Ziel ist die Befreiung durch die Aufdeckung des Verdrängten und die Integration der Erkenntnisse.
Worin unterscheiden sich ISTDP und Psychoanalyse?
Im Gegensatz zur klassischen Psychoanalyse betont die ISTDP eine schnelle Mobilisierung des Unbewussten und einen schnellen Durchbruch verdrängter Gefühle. Die freie Assoziation wird durch die gezielte Beobachtung und Nutzung von Übertragungsgefühlen ersetzt. Ziel ist die Vermeidung einer Übertragungsneurose und die Förderung einer aktiven therapeutischen Allianz.
Was sind die Ziele der ISTDP?
Die ISTDP zielt darauf ab, Widerstände herauszufordern, intensive Übertragungsgefühle aufzudecken und Situationen zu schaffen, die einen direkten Zugang zum Unbewussten ermöglichen. Es geht um die Mobilisierung der Kernneurose und die Arbeit mit den psychodynamischen Kräften der Störung.
Für wen ist die ISTDP geeignet (Indikation)?
Die ISTDP kann bei neurotischen Erkrankungen, Persönlichkeitsstörungen und psychosomatischen Störungen angewendet werden. Es wird jedoch betont, dass die ISTDP nicht für alle Patienten geeignet ist.
Für wen ist die ISTDP nicht geeignet (Kontraindikation)?
Die ISTDP ist kontraindiziert bei Psychosen, fragilen Persönlichkeitsstrukturen, schweren Depressionen, Manien, schweren Borderline-Störungen und fortgeschrittenem Substanzmissbrauch. Die Erkennung von Kontraindikationen erfolgt anhand von Lebensgeschichte und klinischen Zeichen.
Wie ist der theoretische Hintergrund der ISTDP?
Die ISTDP entwickelte sich durch die Analyse gefilmter Arzt-Patient-Interaktionen. Die „Zentraldynamische Sequenz“ und gezielte Interventionen zur Mobilisierung komplexer Übertragungsgefühle spielen eine zentrale Rolle. Davanloo konzentrierte sich auf Abwehrmechanismen, Angst und Gefühle als zentrale psychische Phänomene.
Was ist die „Zentraldynamische Sequenz“?
Dieser Abschnitt beschreibt die detaillierten Interventionsschritte der Zentraldynamischen Sequenz. Eine detaillierte Beschreibung würde den Rahmen dieser Zusammenfassung sprengen.
Welche Therapiephasen gibt es in der ISTDP und welche Auswirkungen haben sie?
Die ISTDP umfasst Phasen wie die Befragung nach Schwierigkeiten, den Druck auf unterdrückte Gefühle, das Klären und Herausfordern von Abwehrmechanismen, den Angriff auf Widerstände im Über-Ich, die intrapsychische Krise und den Einblick in die Kernneurose, die Analyse von Übertragungsgefühlen, die Vervollständigung der Anamnese und die psychodynamische Formulierung und Therapieplanung.
Welche Anforderungen werden an den ISTDP-Therapeuten gestellt?
Dieser Abschnitt beschreibt die notwendigen Fähigkeiten und Eigenschaften eines ISTDP-Therapeuten sowie die therapeutische Haltung und Aktivität.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die ISTDP?
Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP), Habib Davanloo, Psychoanalyse, Übertragung, Widerstandsanalyse, Abwehrmechanismen, Angst, Gefühle, Zentraldynamische Sequenz, Indikation, Kontraindikation, Unbewusstes, Kernneurose, therapeutische Allianz.
- Citar trabajo
- Dipl.-Psych. Adelheid Kühn (Autor), Ellen Bröker (Autor), 2001, Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) = intensive psychodynamische Kurzzeittherapie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/21074