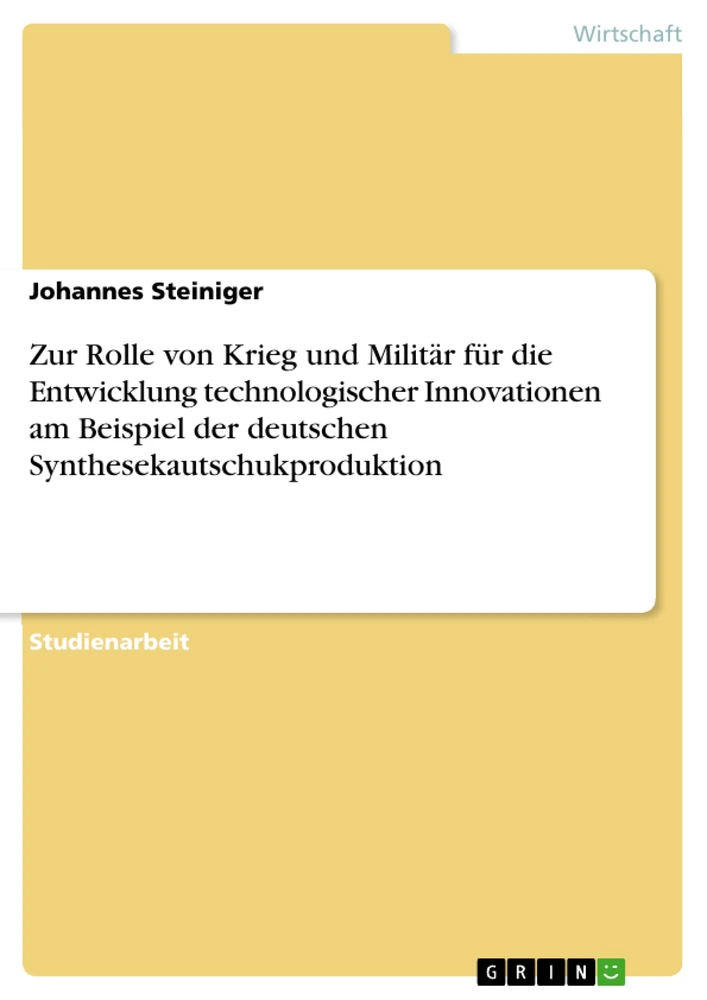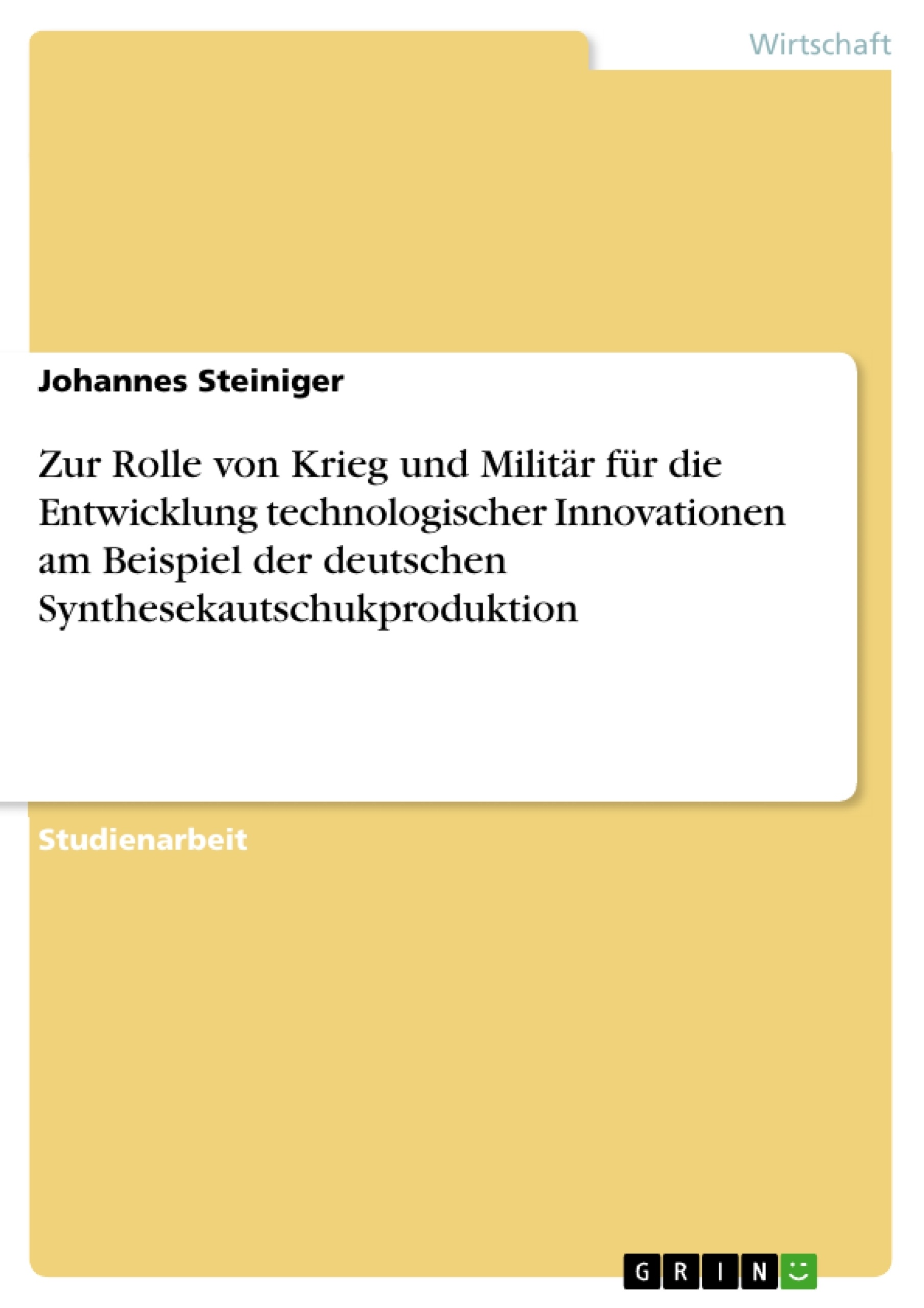Die Arbeit untersucht, inwiefern staatliches Handeln technologische Innovationen induzieren kann. Dabei wird auf das Beispiel einer ureigens staatliche Sphäre, nämlich d ervon Krieg und Militär, eingegangen und gefragt: Haben Investitionen in Militär und Krieg Auswirkungen auf die
Entwicklung technologischer Innovationen?
Eine zentrale Kontroverse beschäftigt sich dabei mit dem Verhältnis von
Staat und Technik: Wer kann für Innovationen sorgen? Gilt das Primat der
Politik oder das Primat der Ökonomie? Mit der Rüstung als Teil staatlichen
Handelns kann hier ein Ausschnitt dieser bekannten Fragestellung näher be-
trachtet werden. Dabei interessiert auf der einen Seite, ob Rüstung Innova-
tionen induzieren kann. Auf der anderen Seite -und das ist die interessantere
Frage- welche Wirkungsmechanismen zum Tragen kommen.
Die Arbeit geht folgendermaßen vor: Nach der ersten Einordnung der Fragestellung und dem Aufzeigen der Relevanz des Themas wird im darauf folgenden Abschnitt definiert, was unter den zentralen Begriffen zu verstehen ist. Danach werden die wichtigsten Argumente aus der Forschungsliteratur vorgestellt. Im dritten und zentralen Schritt wird eine exemplarische Untersuchung durchgeführt. Dabei wird im Detail darauf eingegangen, wie sich die Rüstungswirtschaft der nationalsozialistischen Regierung auf die Entwicklung des synthetischen Kautschuks ausgewirkt hat. Im letzten Abschnitt werden die wichtigsten Ergebnisse zusammengetragen und auf weitere Forschungsmöglichkeiten hingewiesen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Hintergrund
- Definitionen
- Innovation
- Krieg
- Forschungsstand
- Definitionen
- Fallbeispiel: Die synthetische Kautschukproduktion in Deutschland bis 1945
- Von der Invention zur Innovation
- Instrumente der staatlichen Kriegswirtschaft
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob und wie Investitionen in Militär und Krieg Auswirkungen auf die Entwicklung technologischer Innovationen haben. Die Arbeit untersucht die Rolle von Krieg und Militär als Motor für technologische Entwicklungen und analysiert die Beziehung zwischen Staat und Technik im Kontext von Innovationen. Darüber hinaus untersucht die Arbeit die Frage, welche Wirkungsmechanismen in diesem Zusammenhang zum Tragen kommen.
- Die Rolle von Krieg und Militär als Motor für technologische Entwicklungen
- Die Beziehung zwischen Staat und Technik im Kontext von Innovationen
- Die Analyse spezifischer Wirkungsmechanismen, die zur Entstehung von Innovationen im Bereich von Krieg und Militär führen
- Die Bedeutung von staatlichen Investitionen in die Entwicklung von Technologie
- Die Untersuchung des Fallbeispiels der synthetischen Kautschukproduktion im Dritten Reich
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die Relevanz des Themas dar. Der zweite Abschnitt definiert die zentralen Begriffe "Innovation" und "Krieg" und stellt den Forschungsstand zur Beziehung zwischen Krieg und Innovationen vor. Der dritte und zentrale Teil untersucht die synthetische Kautschukproduktion in Deutschland bis 1945 als Fallbeispiel, wobei die Rolle der staatlichen Kriegswirtschaft und die Entwicklung von der Invention zur Innovation im Detail beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Beziehung zwischen Krieg und Militär und technologischen Innovationen. Zentrale Begriffe sind: Innovation, Krieg, Rüstung, Staatswirtschaft, synthetischer Kautschuk, Invention, Entwicklung, technologischer Fortschritt.
Häufig gestellte Fragen
Fördert Krieg tatsächlich den technologischen Fortschritt?
Die Arbeit untersucht die Kontroverse, ob staatliche Investitionen in Rüstung und Militär als Motor für Innovationen dienen können und welche Wirkungsmechanismen dabei zum Tragen kommen.
Was ist der Unterschied zwischen Invention und Innovation?
Eine Invention ist die bloße Erfindung, während eine Innovation die erfolgreiche wirtschaftliche oder gesellschaftliche Umsetzung und Verbreitung dieser Erfindung beschreibt.
Welches Fallbeispiel wird in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit analysiert detailliert die Entwicklung und Produktion von synthetischem Kautschuk (Buna) in der deutschen Kriegswirtschaft bis 1945.
Gilt das Primat der Politik oder der Ökonomie bei Innovationen?
Dies ist eine zentrale Fragestellung der Arbeit: Inwieweit kann der Staat durch politische Vorgaben (z. B. Autarkiebestrebungen) technische Entwicklungen erzwingen, die der Markt allein nicht hervorgebracht hätte.
Welche Instrumente nutzte die NS-Regierung zur Innovationsförderung?
Der Staat griff massiv in die Wirtschaft ein, indem er Forschungsprojekte finanzierte, Abnahmegarantien gab und die Ressourcenverteilung im Rahmen der Kriegswirtschaft steuerte.
- Quote paper
- Johannes Steiniger (Author), 2012, Zur Rolle von Krieg und Militär für die Entwicklung technologischer Innovationen am Beispiel der deutschen Synthesekautschukproduktion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210783