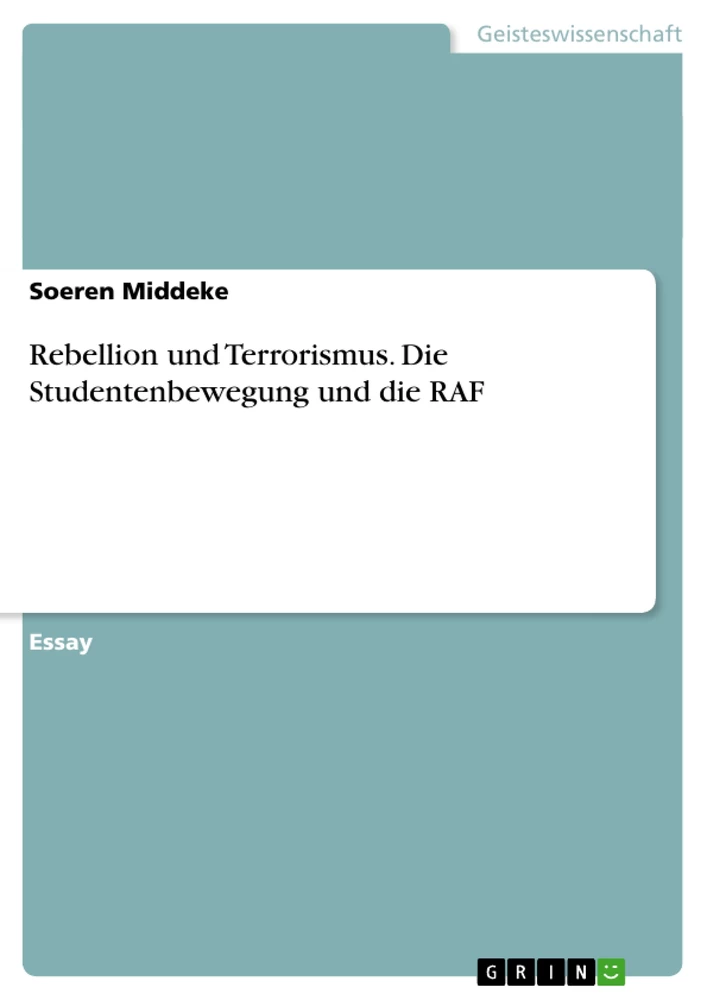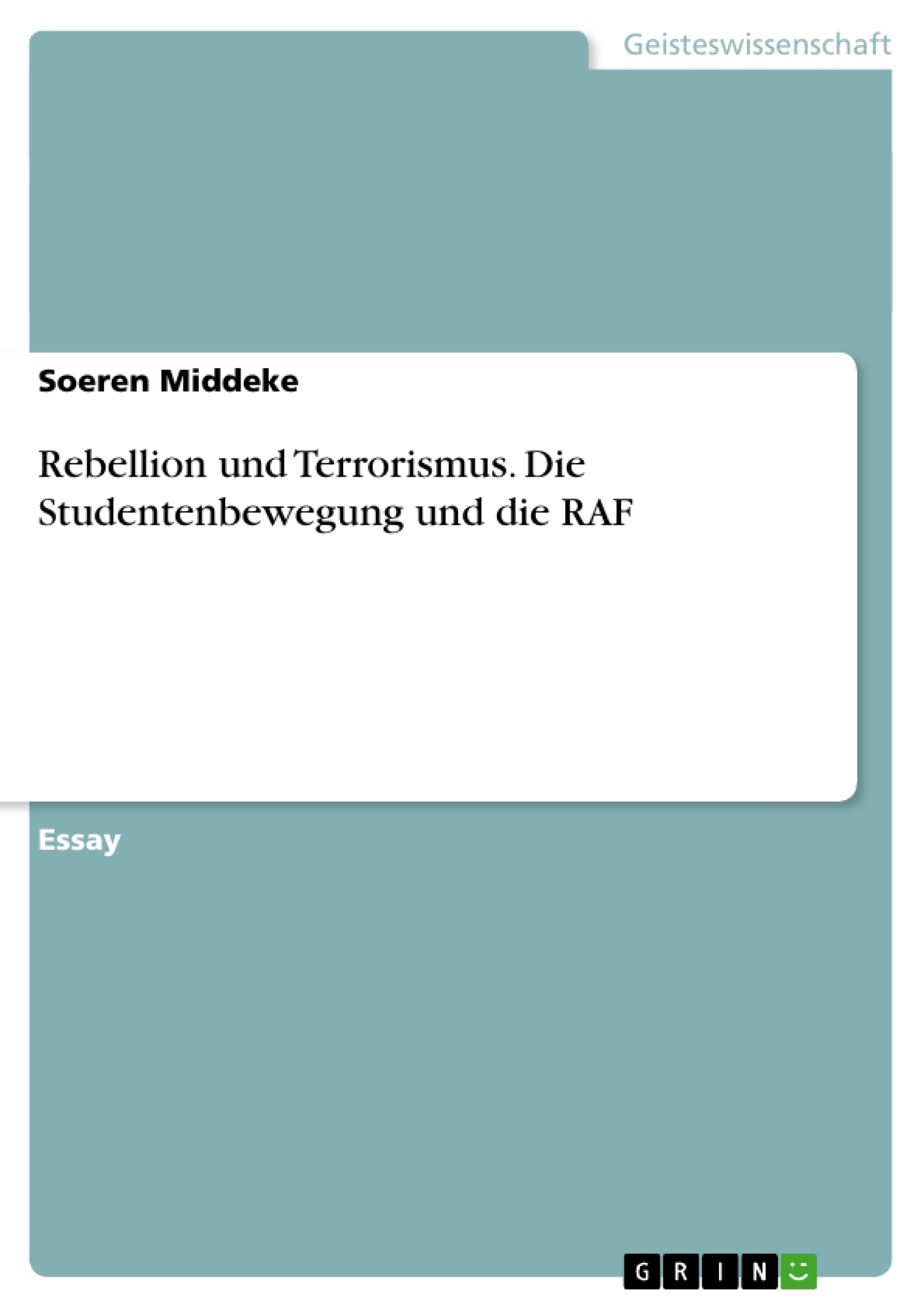Was von der RAF übrig bleibt ist eine für die deutsche Nachkriegsgeschichte er-schreckende Bilanz von 61 Toten, 230 Verletzten und umgerechnet 250 Millionen Euro Sachschaden, ganz zu schweigen von dem nicht in nackten Zahlen zu messen-den psychischem Schaden, der ein ganzes Land nachhaltig traumatisierte und den damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt an den Rande des Rücktritts drängte. Über kaum ein anderes Thema der deutschen Nachkriegsgeschichte ist gleichzeitig so viel diskutiert, aber auch so viel geschwiegen worden wie über die Rote Armee Fraktion und vielleicht erweckt es gerade deshalb den Eindruck, noch immer nicht vollständig aufgearbeitet zu sein. Die folgende, kurze Abhandlung versucht weder psychologische Täterprofile zu erstellen und zu deuten, noch eine subjektive Bewer-tung der Geschehnisse zu unternehmen, sondern allein einen kurzen Überblick über die Einflüsse der Studentenbewegung, dessen Geschichte Ulrike Meinhof in der ers-ten RAF-Kampfschrift „Das Konzept Stadtguerilla“ (1971) als „ihre Vorgeschichte“ bezeichnet, auf die Gründung der RAF zu geben. Der erfasste Zeitraum lässt sich somit zwischen 1964 und dem besagten 14. Mai 1970 datieren.
Am 20. April 1998 erreicht die Nachrichtenagentur Reuters in Köln ein achtseitiges Schreiben, welches den Absender „Rote Armee Fraktion“ trägt. In diesem im Nachhinein von Beamten des Bundeskriminalamtes als authentisch eingestuften Schreiben erklären die Verfasser das „Projekt RAF“ für beendet:
„Vor fast 28 Jahren, am 14. Mai 1970, entstand in einer Befreiungsaktion die RAF. Heute beenden wir das Projekt. Die Stadtguerilla in Form der RAF ist nun Geschichte“, schreiben die Verfasser: „Die RAF war der revolutionäre Versuch einer Minderheit - entgegen der Tendenz dieser Gesellschaft - zur Umwälzung der kapitalistischen Verhältnisse. Wir sind froh, Teil dieses Versuchs gewesen zu sein. Das Ende des Projekts zeigt, dass wir auf diesem Weg nicht durchkommen konnten.“ Beispiel: „Es war ein strategischer Fehler, neben der illegalen, bewaffneten keine politisch-soziale Organisation aufzubauen.“ Fazit: „Das Ergebnis kritisiert uns.“1
Was von der RAF übrig bleibt ist eine für die deutsche Nachkriegsgeschichte er- schreckende Bilanz von 61 Toten, 230 Verletzten und umgerechnet 250 Millionen Euro Sachschaden, ganz zu schweigen von dem nicht in nackten Zahlen zu messen- den psychischem Schaden, der ein ganzes Land nachhaltig traumatisierte und den damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt an den Rande des Rücktritts drängte. Über kaum ein anderes Thema der deutschen Nachkriegsgeschichte ist gleichzeitig so viel diskutiert, aber auch so viel geschwiegen worden wie über die Rote Armee Fraktion und vielleicht erweckt es gerade deshalb den Eindruck, noch immer nicht vollständig aufgearbeitet zu sein. Die folgende, kurze Abhandlung versucht weder psychologische Täterprofile zu erstellen und zu deuten, noch eine subjektive Bewer- tung der Geschehnisse zu unternehmen, sondern allein einen kurzen Überblick über die Einflüsse der Studentenbewegung, dessen Geschichte Ulrike Meinhof in der ers- ten RAF-Kampfschrift „Das Konzept Stadtguerilla“ (1971) als „ihre Vorgeschichte“ bezeichnet, auf die Gründung der RAF zu geben. Der erfasste Zeitraum lässt sich somit zwischen 1964 und dem besagten 14. Mai 1970 datieren.
Gegen Mitte der 1960er formiert sich in einigen deutschen Großstädten, vornehmlich in Berlin, die Studentenbewegung, die erstmals in einer organisiert-öffentlichen Kri- tik die bestehenden Verhältnisse der derzeitigen Gesellschaft anprangert. Als Haupt- kritikpunkt der Studenten gilt, neben dem von ihnen als „Völkermord“ bezeichneten Krieg der USA gegen die kommunistische Revolutionsbewegung in Vietnam, die verfehlte bzw. die unzureichende Aufarbeitung des 3. Reiches durch die Generation ihrer Eltern. Nach dem Ende des 2. Weltkrieges ist für sie der Alltag in Deutschland wieder viel zu schnell eingekehrt, was vielen das Gefühl gibt, dass man Verbrechen wie Auschwitz oder Buchenwald lieber totschweigt, anstatt sich selbstkritisch und offensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Des weiteren ist es den Studenten ein Dorn im Auge, dass man ungeachtet des Geschehenen nach wie vor alte NS- Funktionäre in den Führungsetagen bedeutender Institutionen finden kann (wie etwa Heinrich Lübke oder den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Hans Filbin- ger), ob nun in Universitäten, in Ministerien, in der Justiz oder in leitenden Positio- nen der Wirtschaft. Weitern Treibstoff liefern im Vorfeld bereits einige Geschehnis- se, wie etwa die einsetzende Wiederbewaffnung Deutschlands in den 1950ern oder die sog „Spiegel-Affäre“ 1962, in denen die Studenten einen weiteren Ausdruck der Restauration des herrschenden Systems entdecken. Mit dem Beginn des noch friedli- chen Aufbegehrens der Studenten beginnt auch die die kritische Berichterstattung des Axel-Springer-Verlags, der über seine Zeitungen Bild, BZ und Die Welt schon früh gegen die Studentenbewegung wettert. Ein Konflikt, der die folgenden Jahre wesentlich mitbestimmen wird.
Zur ersten handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen Studenten und der Staats- macht kommt es gegen Ende des Jahres 1964, als Studenten während des Besuches des kongolesischen Ministerpräsidenten die Polizeibarrikaden durchbrechen und den Staatsgast mit Eiern bewerfen, da man diesem eine Verstrickung in die Ermordung seines Vorgängers Patrice Lumumba vorwirft. In den darauf folgenden Monaten kommt es immer wieder zu größeren Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg, zur Erfindung der Sitzblockade und zum vermehrten Einsatz von Schlagstöcken der Staatsgewalt. Durch einen gesteigerten Druck der öffentlichen Meinung, unter ande- rem angeheizt durch den Springer-Verlag, sieht sich der Regierende Bürgermeister Berlins, Heinrich Albertz, nun zu Maßnahmen gezwungen, verhängt im Februar 1966 ein Demonstrationsverbot über die gesamte Berliner Innenstadt und rechtfertigt das harte Vorgehen der Polizei gegen die Demonstranten. „Der Ton des Staates ist härter geworden. Im Zweifel „Knüppel frei“ lautet die von oben ausgegebene Devi- se.“2 Der Dezember des gleichen Jahres markiert einen weiteren wichtigen Punkt, der für das Verständnis der Radikalisierung der Studentenbewegung von Bedeutung ist. Nach der Bundestagswahl regieren CDU und SPD gemeinsam in einer Großen Koa- lition.
[...]
1 Peters, Butz: Tödlicher Irrtum - Die Geschichte der RAF, S.28 / 29.
2 Peters, Butz: Tödlicher Irrtum - Die Geschichte der RAF, S.85.
Häufig gestellte Fragen
Wann wurde die Rote Armee Fraktion (RAF) gegründet?
Die RAF entstand am 14. Mai 1970 im Zuge einer Befreiungsaktion.
Welchen Einfluss hatte die Studentenbewegung auf die RAF?
Ulrike Meinhof bezeichnete die Studentenbewegung als die "Vorgeschichte" der RAF; viele Radikalisierungsprozesse begannen in der Protestkultur der 1960er Jahre.
Was waren die Hauptkritikpunkte der Studentenbewegung?
Kritisiert wurden die unzureichende Aufarbeitung der NS-Vergangenheit, der Vietnamkrieg und die Präsenz ehemaliger NS-Funktionäre in hohen Ämtern.
Wann löste sich die RAF offiziell auf?
Am 20. April 1998 ging ein achtseitiges Schreiben an die Nachrichtenagentur Reuters, in dem die RAF das Projekt für beendet erklärte.
Welche Rolle spielte der Axel-Springer-Verlag?
Der Verlag stand in scharfem Konflikt mit der Studentenbewegung und prägte durch seine Berichterstattung die öffentliche Meinung gegen die Demonstranten.
- Arbeit zitieren
- Soeren Middeke (Autor:in), 2010, Rebellion und Terrorismus. Die Studentenbewegung und die RAF, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210851