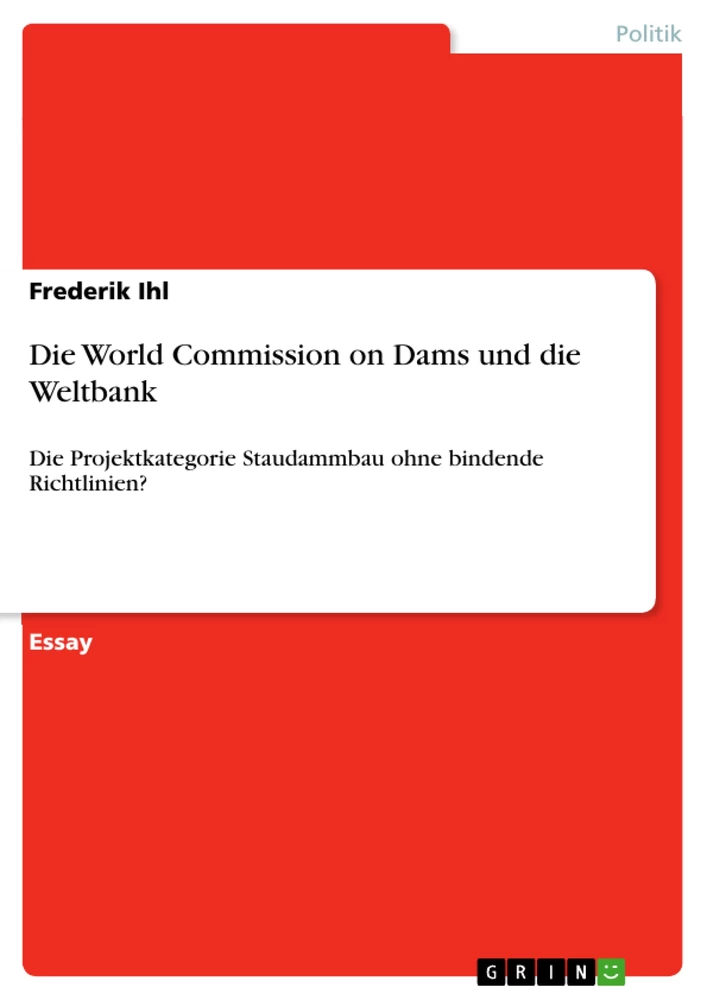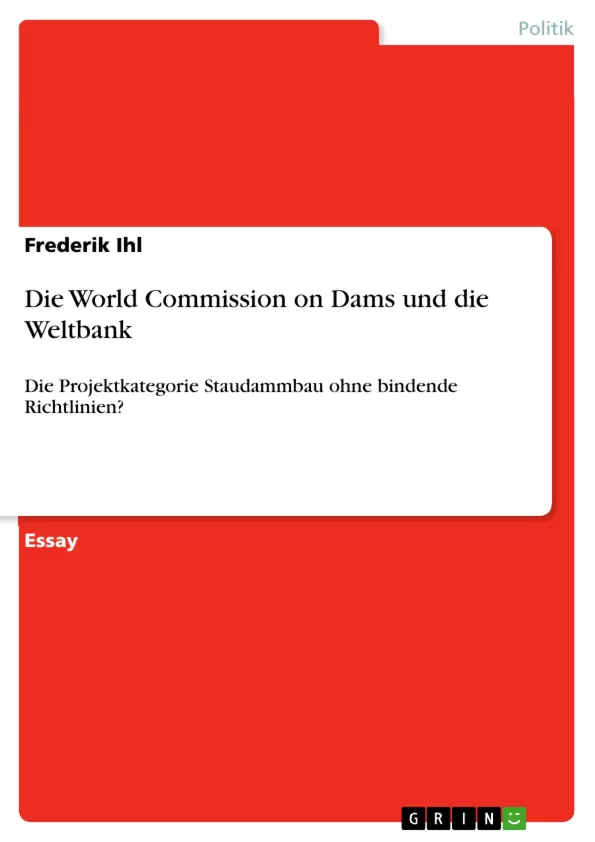Nachdem im Jahr 2000 nach fast dreijähriger Ausarbeitung die World Commission on Dams (WCD) in ihrem Abschlussbericht eine letztendlich negative Bilanz der meisten Staudammprojekte, die von der Weltbank in Entwicklungsländern finanziert wurden, vorgelegt hatte, erhofften sich viele interessierte Beobachter der internationalen Entwicklungspolitik eine Kehrtwende in der Kreditvergabepolitik der Weltbank. Viele Jahre wurde die Agenda der Weltbank durch enorme Kreditsummen für Staudammprojekte in der ganzen Welt bestimmt und rief einen enormen Proteststurm aufgrund der negativen Folgen von Staudämmen für die betroffenen Regionen hervor. Im der vorliegenden Arbeit wird diskutiert, inwieweit die ausgearbeiteten Ergebnisse der World Commission on Dams die Entscheidungen der Weltbank in Bezug auf die finanzielle Unterstützung von Staudammprojekten beeinflusst haben und welche Probleme auch weiterhin auftreten. Diese Fragestellungen leiten zur These, dass die Analyse der World Commission on Dams überflüssig war, da trotz der Ergebnisse des unabhängigen Expertengremiums auch weiterhin Staudammprojekte ohne bindende und international anerkannte Richtlinien von der Weltbank finanziert und von multinationalen Unternehmen gebaut werden. Im folgenden soll zunächst kurz die World Commission on Dams und ihre Ergebnisse vorgestellt werden, sodass im Anschluss eine fundierte Analyse die bereits genannte These diskutiert und das abschließende Fazit versucht, die Thematik zusammenzufassen und Vorschläge für die Umsetzung der Standards bei zukünftigen Großstaudämmen abzuleiten.
Nachdem im Jahr 2000 nach fast dreijähriger Ausarbeitung die World Commission on Dams (WCD) in ihrem Abschlussbericht eine letztendlich negative Bilanz der meisten Staudammprojekte, die von der Weltbank in Entwicklungsländern finanziert wurden, vorgelegt hatte, erhofften sich viele interessierte Beobachter der internationalen Entwicklungspolitik eine Kehrtwende in der Kreditvergabepolitik der Weltbank. Viele Jahre wurde die Agenda der Weltbank durch enorme Kreditsummen für Staudammprojekte in der ganzen Welt bestimmt und rief einen enormen Proteststurm aufgrund der negativen Folgen von Staudämmen für die betroffenen Regionen hervor. Im der vorliegenden Arbeit wird diskutiert, inwieweit die ausgearbeiteten Ergebnisse der World Commission on Dams die Entscheidungen der Weltbank in Bezug auf die finanzielle Unterstützung von Staudammprojekten beeinflusst haben und welche Probleme auch weiterhin auftreten. Diese Fragestellungen leiten zur These, dass die Analyse der World Commission on Dams überflüssig war, da trotz der Ergebnisse des unabhängigen Expertengremiums auch weiterhin Staudammprojekte ohne bindende und international anerkannte Richtlinien von der Weltbank finanziert und von multinationalen Unternehmen gebaut werden. Im folgenden soll zunächst kurz die World Commission on Dams und ihre Ergebnisse vorgestellt werden, sodass im Anschluss eine fundierte Analyse die bereits genannte These diskutiert und das abschließende Fazit versucht, die Thematik zusammenzufassen und Vorschläge für die Umsetzung der Standards bei zukünftigen Großstaudämmen abzuleiten.
Basierend auf der massiven Kritik an den von der Weltbank finanzierten Staudammprojekten auf der ganzen Welt und den einhergehenden Folgen für die nationale Wirtschaft, das soziale Leben und die regionale Ökologie, initiierte unter anderem auch die Weltbank zeitgleich mit dem sich selbst auferlegten Moratorium, welches die Finanzierung stoppte, die World Commission on Dams (vgl. Baur 2001: 24). Diese unabhängige Kommission sollte positive Ergebnisse und nachhaltige Probleme von bereits finanzierten Projekten durch eine detaillierte Analyse prüfen und im Anschluss Empfehlungen und Standards erarbeiten, an denen sich die Weltbank aber auch private Investoren in Zukunft orientieren sollten (vgl. Scheumann 2010a: 47). Aufgrund der Proteste gegen finanzierte Großprojekte wird die Weltbank vor allem mit Problemen und negativen Folgen durch einen Staudammbau oder ganzer Staudammsysteme konfrontiert: Unter anderem die ökologischen Folgen werden von den Kritikern in dem Mittelpunkt gestellt. Die Zerstörung von ganzen Ökosystemen, die Erosion, die Senkung des Grundwasserspiegels oder durch Staudämme verursachte Erdbeben (vgl. Odenwald 2000) stellen dabei nur einen Bruchteil der negativen Folgen des Staudammbaus dar (vgl. Dittrich 2006: 9,vgl. Kell 2012: 201ff.). Das traditionelle soziale Leben wird durch Zwangsumsiedlungen von Menschenmassen verändert. Am Beispiel des Narmada-Staudammsystems in Indien wird deutlich, dass über hunderttausend Menschen ihren Heimatort verlassen müssen (vgl. Venzky 1992) und damit ganze Regionen und Städte ihre Identität und Kultur verlieren (vgl. Sachs 2006). Auch ökonomisch werden in vielen Projekten die Ziele durch den Staudammbau nicht erreicht, sodass sich viele Entwicklungsländer weiter verschulden, die Kosten und der Nutzen ungerecht verteilt werden oder die erwirtschafteten Gewinne wieder in das Ausland abgeschöpft werden (vgl. Kell 2012: 200f.). Politisch können diese Aspekte oftmals zu internationalen Disparitäten und transnationalen Konflikten führen. Diese Probleme stehen allerdings im Gegensatz zu den Makrozielen der Weltbank, die mit dem Bau von Staudämmen erreicht werden sollen: Die Prosperität ganzer Volkswirtschaften durch Staatseinnahmen und Energieexport, den Infrastrukturausbau (vgl. Tetzlaff 1980: 376) oder die Schuldenreduktion steht dabei genauso im Mittelpunkt wie die soziale und ökologische Entwicklung durch Hochwasserschutz, eine gesicherte Wasserversorgung, die Stärkung der Menschenrechte oder die Armutsreduktion. Die erarbeiteten Richtlinien für oder gegen die Finanzierung eines Staudamm-Großprojektes „Gerechtigkeit, Effizienz, partizipative Entscheidungs-findung, Nachhaltigkeit und Rechenschaftspflicht“ (Baur 2001: 25, vgl. Schneider 2005: 3), sind allerdings objektiv auslegbar und aus diesem Grund ohne Bindung für Weltbank und private Staudamm-Investoren. Vor allem die aktive Partizipation der betroffenen Bevölkerung wird jedoch besonders hervorgehoben (vgl. Schneider 2005: 3, vgl. World Commission on Dams 2010: 97ff.).
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was war die Aufgabe der World Commission on Dams (WCD)?
Die unabhängige Kommission wurde eingesetzt, um die sozialen, ökologischen und ökonomischen Auswirkungen von Großstaudämmen weltweit zu untersuchen und Standards für zukünftige Projekte zu entwickeln.
Welche ökologischen Folgen haben Großstaudämme?
Zu den Folgen gehören die Zerstörung von Ökosystemen, Erosion, die Senkung des Grundwasserspiegels und in extremen Fällen sogar durch den Wasserdruck verursachte Erdbeben.
Warum werden Staudammprojekte sozial kritisiert?
Hauptkritikpunkt sind Zwangsumsiedlungen. Am Beispiel des Narmada-Projekts in Indien wird deutlich, dass Zehntausende Menschen ihre Heimat, Kultur und Identität verlieren, oft ohne angemessene Entschädigung.
Welche Rolle spielt die Weltbank bei der Staudammfinanzierung?
Die Weltbank war lange Zeit der Hauptfinanzier. Trotz der kritischen Ergebnisse der WCD finanziert sie weiterhin Projekte, da die erarbeiteten Richtlinien nicht rechtlich bindend sind.
Was sind die ökonomischen Risiken für Entwicklungsländer?
Oft werden die ökonomischen Ziele (Energieexport, Armutsreduktion) nicht erreicht. Stattdessen verschulden sich die Länder weiter, während Gewinne oft an multinationale Bauunternehmen ins Ausland abfließen.
- Quote paper
- Frederik Ihl (Author), 2013, Die World Commission on Dams und die Weltbank, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210885