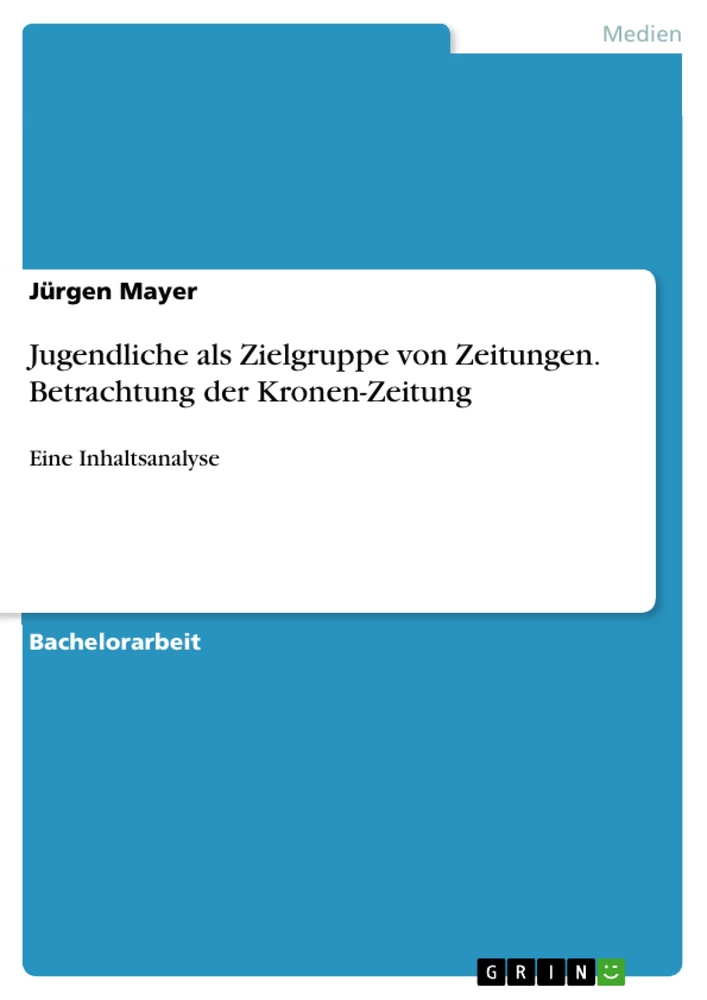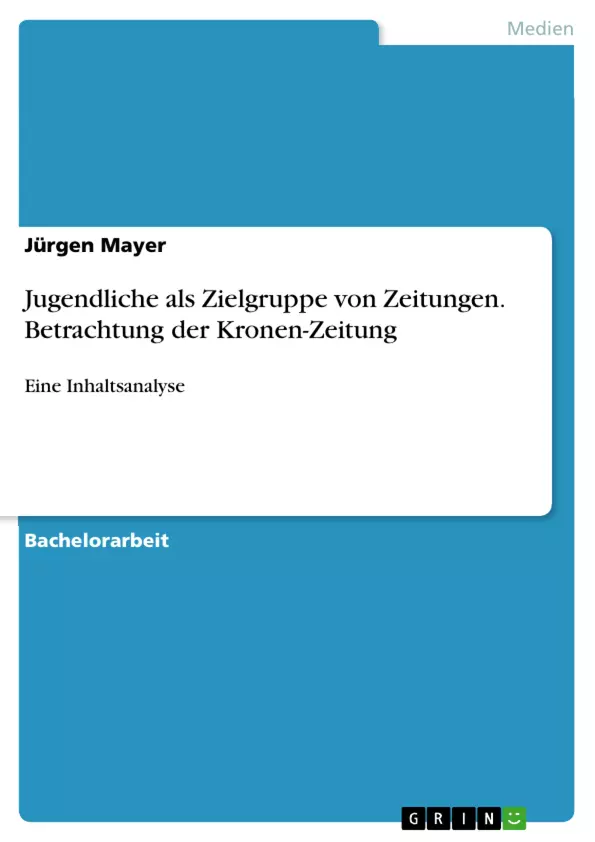Medien begleiten uns täglich und fast überall. Kaum jemand kommt heute noch einen Tag ohne Medienkonsum aus. Auch junge Menschen sind mit einer immer größer werdenden Vielzahl von Medienangeboten konfrontiert. Sie wachsen in einer Welt auf, die mehr denn je von den so genannten „Elektronischen Medien“, beispielsweise Computer, Internet oder Online-Diensten, geprägt ist (vgl. Klingler/Feierabend/Franzmann 1999: 173). Die traditionellen Medien stehen also in einem harten Konkurrenzkampf mit den „Neuen Medien“. Allen voran die Zeitung hat es heutzutage nicht leicht bei diesem Überangebot jugendliche LeserInnen zu gewinnen beziehungsweise zu behalten. Jedoch sollte
gerade dieser Zielgruppe ein hoher Stellenwert im Bereich der Printmedien eingeräumt werden, da sie die AbonnentInnen von morgen sind.
In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, was die österreichische Tageszeitung „Kronen-Zeitung“ unternimmt, um Jugendliche zu erreichen. Hierfür muss man deren Bedürfnisse und Motivationen zum Zeitunglesen kennen.
Darüber hinaus wird auch die Thematik „Jugendliche und Zeitung“ allgemein näher erläutert und der aktuelle Forschungsstand diesbezüglich zusammengefasst.
Mittels eine qualitativen und quantitativen Inhaltsanalyse wurde die auflagenstärkste Tageszeitung Österreichs untersucht, um anschließend Stärken und Schwächen in der jugendgerechten Aufbereitung aufzuzeigen.
Die Theorie klärt unter anderem diverse Begriffe wie "Boulevardisierung" und beleuchtet das Thema "Mediennutzung" sowie den sozialpsychologischen "Uses and Gratifications Approach".
Aber auch detaillierte Daten und Fakten zur Krone liefert die vorliegende Studie.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Ziel der Untersuchung
1.2. Methodische Vorgehensweise
1.3. Aufbau/ Gliederung der Arbeit
2. Theorieteil
2.1. Begriffsdefinition „Jugendliche“
2.2. Begriffsdefinition „Zeitung“
2.3. Jugendliche und Mediennutzung
2.4. Jugendliche und Zeitung - Leserschaftsforschung
2.4.1. Studien
2.4.2. Themeninteressen Jugendlicher
2.5. Untersuchungsgegenstand „Kronen-Zeitung“
2.5.1. Geschichte
2.5.2. Charakteristika
2.5.3. Auflage und Reichweite
2.6. Der "Uses and Gratifications Approach"
3. Empirischer Teil: Inhaltsanalyse
3.1. Forschungsfrage und Hypothesen
3.2. Untersuchungskategorien
4. Ergebnisse der Untersuchung
4.1. Überprüfung der Hypothesen
4.2. Beantwortung der Forschungsfrage
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis
6.1. Online-Quellen
6.2. Abbildungsverzeichnis
7. Anhang
Codierbuch
Codierbogen
Häufig gestellte Fragen
Warum sind Jugendliche eine wichtige Zielgruppe für Zeitungen?
Jugendliche sind die Abonnenten von morgen. Wenn Verlage sie heute nicht als Leser gewinnen, gefährdet dies die langfristige Existenz der Printmedien.
Was ist der „Uses and Gratifications Approach“?
Dies ist ein sozialpsychologischer Ansatz, der untersucht, warum Menschen bestimmte Medien nutzen, um ihre individuellen Bedürfnisse zu befriedigen.
Was unternimmt die Kronen-Zeitung für Jugendliche?
Die Arbeit analysiert mittels Inhaltsanalyse die Stärken und Schwächen der Kronen-Zeitung bei der jugendgerechten Aufbereitung von Themen.
Was bedeutet „Boulevardisierung“?
Boulevardisierung bezeichnet die Tendenz von Medien, Themen emotionaler, einfacher und unterhaltsamer aufzubereiten, um eine breitere Leserschaft anzusprechen.
Welche Themen interessieren Jugendliche in Zeitungen?
Die Forschung zeigt, dass Jugendliche vor allem an Themen interessiert sind, die einen direkten Bezug zu ihrer Lebenswelt haben oder hohen Unterhaltungswert bieten.
- Quote paper
- Magister Jürgen Mayer (Author), 2009, Jugendliche als Zielgruppe von Zeitungen. Betrachtung der Kronen-Zeitung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210968