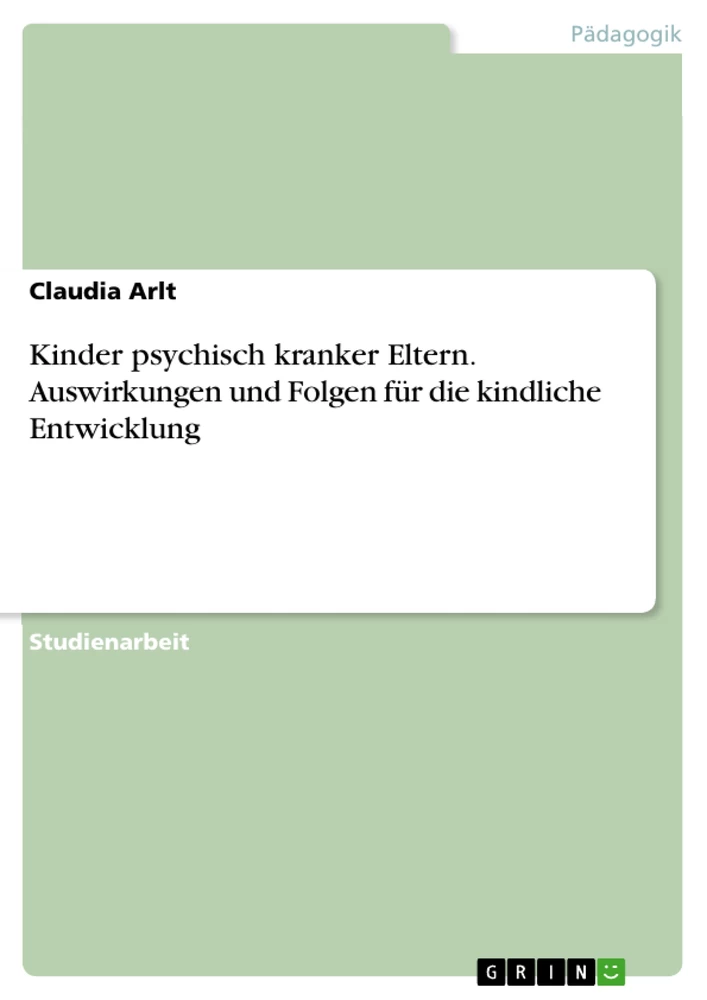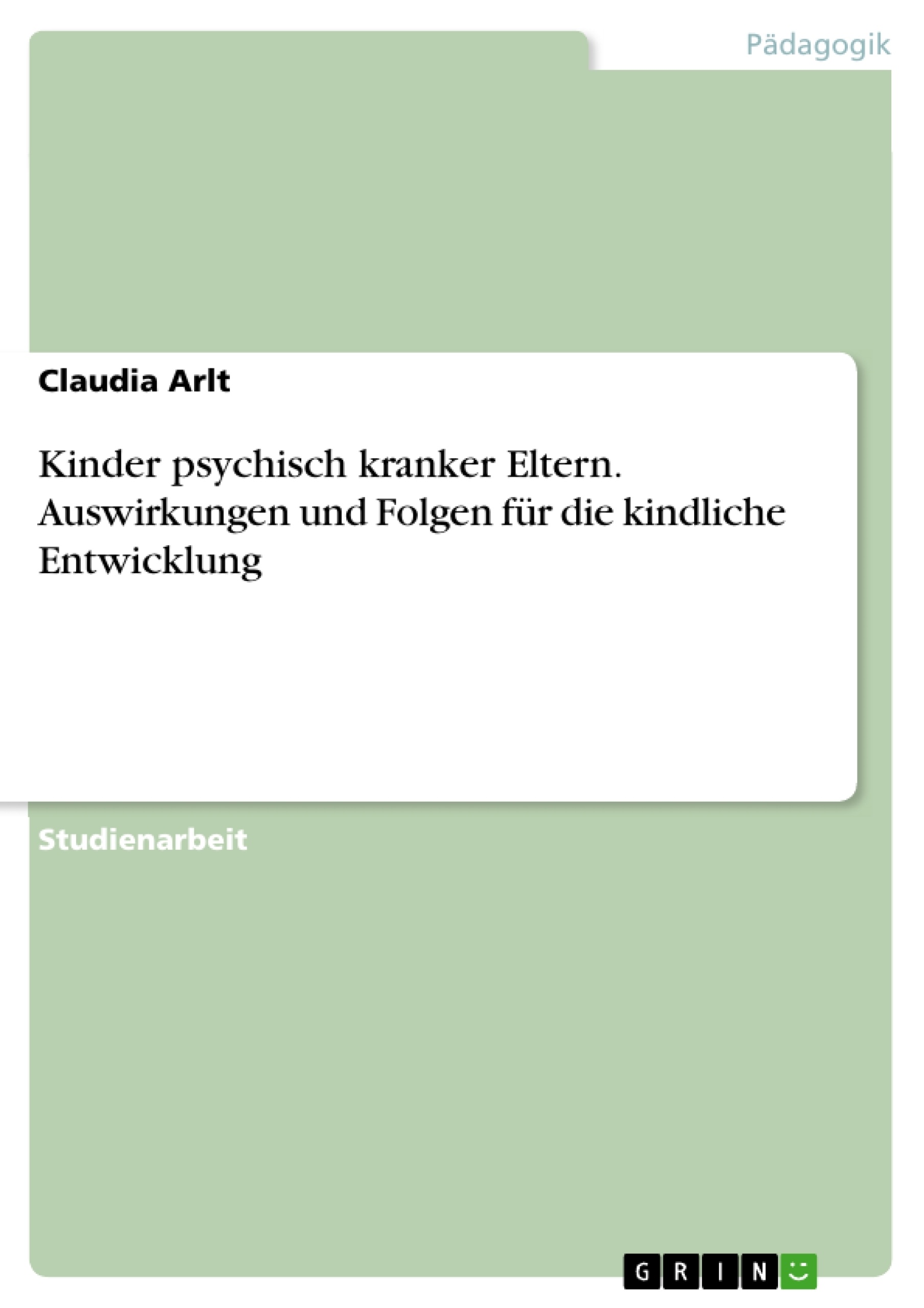Studien zufolge haben Kinder psychisch kranker Eltern tendenziell ein erhöhtes Risiko, später selbst psychisch zu erkranken. Neben den erblichen Faktoren gibt es dabei eine Vielzahl von Risikofaktoren, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen.
Ich werde im Verlauf meiner Arbeit näher auf diese Risikofaktoren eingehen, sowie auch auf Schutzfaktoren. Ich werde mich mit dem Erleben des Kindes seiner psychischen kranken Eltern befassen, Problemen des Kindes in seiner Umwelt und seines Alltags.
Mein inhaltlicher Schwerpunkt liegt auf den Erkenntnissen der Bindungs- und Entwicklungstheorie, zu denen ich konkrete Beispiele aus der Praxis heranziehen werde. Zum Abschluss zeige ich verschiedene Schutzfaktoren auf, die die Resilienz des betroffenen Kindes erhöhen können und beende meine fachlichen Ausführungen mit einer Zusammenfassung und einem Fazit. Adressen für betroffene Familien befinden sich im Anhang.
Um mich nun der Frage nach den Auswirkungen und Folgen für die kindliche Entwicklung bei Erkrankung eines oder beider Elternteile widmen zu können, möchte ich zu allererst auf einige Störungsbilder von Eltern eingehen, die in der Praxis häufig vorkommen und welche mir konkret in meinem Praktikum begegnet sind. Dies soll als kleiner Einblick dienen, wie sich psychische Erkrankungen darstellen können.
Ich werde im Speziellen auf drei psychische Störungen eingehen:
Depression und Manie (Affektive Störungen)
Das Borderline Syndrom (Persönlichkeitsstörung))
Zwangsstörung (Angststörung)
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Psychische Erkrankungen aus der Praxis
1.1 Depression
1.2 Manie
1.3 Das Borderline Syndrom (Persönlichkeitsstörung)
1.4 Die Zwangsstörung
2 Belastungsfaktoren für Kinder psychischer kranker Eltern
2.1 Genetische Faktoren
2.2 Beeinflussende Umweltfaktoren für die psychische Entwicklung von Kindern
2.3 Belastungen der Kinder im Alltag
2.4 Unmittelbare Probleme
2.5 Folgeprobleme
3 Entwicklungsspezische Auswirkungen auf das Kind
3.1 Störungen in Eltern-Kind-Beziehung (Bindungstheorie)
3.1.1 Das Konzept der Feinfühligkeit
3.1.2 Die Fremde-Situation
3.1.3 Unsicher - vermeidendes Bindungsmuster
3.1.4 Unsicher-ambivalentes Bindungsmuster
3.1.5 Generelle Folgen für die Persönlichkeitsentwicklung bei nicht sicher
gebunden Kindern
3.1.6 Bindungsverhalten am Beispiel aus der Praxis
3.1.7 Interaktionskompetenz
3.1.8 Interaktionskompetenz am Beispiel aus der Praxis
3.2 Die psychosexuelle Entwicklungstheorie
3.2.1 Die Orale Phase
3.2.2 Beispiel aus der Praxis
3.2.3 Die Anale Phase
3.2.4 Beispiel aus der Praxis
3.2.5 Phallische Phase
4 Resilienz und Schutzfaktoren für die kindliche Entwicklung
4.1 Resilienz
4.2 Schutzfaktoren für die kindliche Entwicklung
5 Zusammenfassung
Häufig gestellte Fragen
Haben Kinder psychisch kranker Eltern ein höheres Risiko für eigene Erkrankungen?
Ja, Studien zeigen ein erhöhtes Risiko, das sowohl auf genetischen Faktoren als auch auf belastenden Umweltfaktoren basiert.
Welche psychischen Störungen werden in der Arbeit thematisiert?
Die Arbeit geht speziell auf Depression, Manie, das Borderline-Syndrom und Zwangsstörungen ein.
Was ist die Bindungstheorie?
Die Bindungstheorie untersucht die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung, wobei Muster wie sicher, unsicher-vermeidend oder unsicher-ambivalent unterschieden werden.
Was versteht man unter Resilienz?
Resilienz ist die psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern, die durch bestimmte Schutzfaktoren trotz hoher Belastungen gestärkt werden kann.
Welche Rolle spielt die Interaktionskompetenz der Eltern?
Psychisch kranke Eltern zeigen oft eine eingeschränkte Feinfühligkeit, was die gesunde emotionale Entwicklung des Kindes beeinträchtigen kann.
- Arbeit zitieren
- Claudia Arlt (Autor:in), 2012, Kinder psychisch kranker Eltern. Auswirkungen und Folgen für die kindliche Entwicklung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/211006