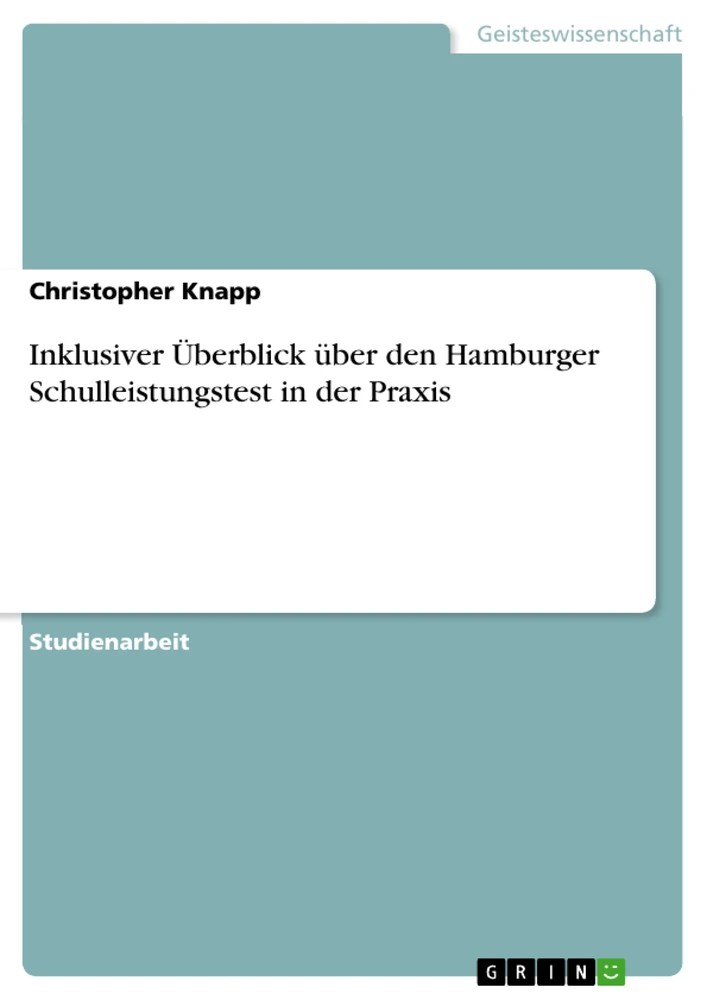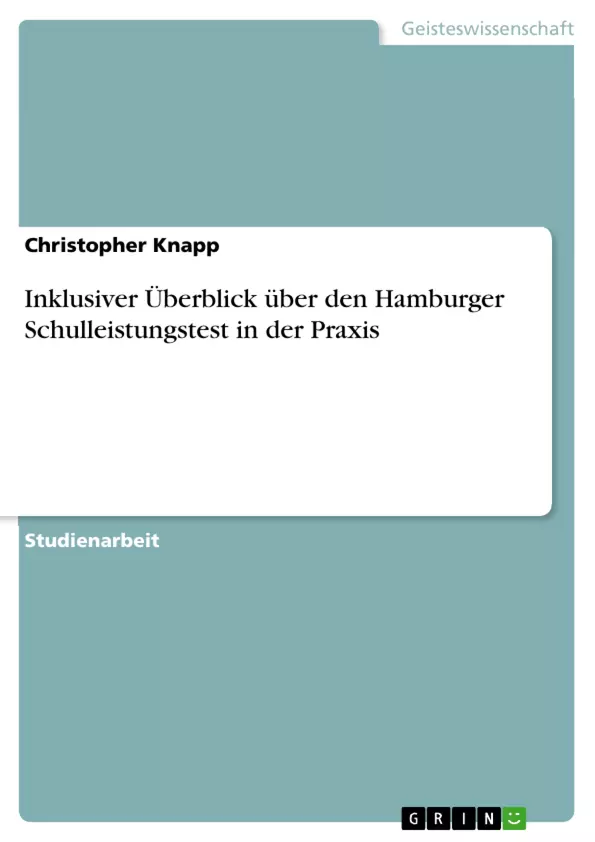Leistung in der Schule ist ein Thema, das nicht nur in der schulischen Ausbildung kontrovers diskutiert
wird. Auch im Lehreralltag wird häufig diskutiert über Ungerechtigkeiten schulischer Zensuren und
den Sinn von Leistungsmaßstäben in der kindlichen Erziehung. Befurchtet wird vor allem eine
klasseninterne soziale Ausgrenzung durch "miese Noten" und ein hoher Erwartungsdruck der Eltern
an ihre Kinder. Diese Beobachtungen waren eigentlich schon der reformwilligen Nachkriegsgeneration
bekannt und wurden zu Beginn der 70er Jahre ideologisch übertrieben zur Kritik am "System" genutzt:
Das Leistungsprinzip wurde sogar als "entartet" gebrandmarkt und somit auch zur Ersatzreligion einer
säkularisierten Modeme deklariert, während seine konservativen Befürworter es als wichtigstes
fundamentales Grundprinzip moderner demokratischer Gesellschaften anpriesen (Ingenkamp &
Lissmann 2008: 132).
Leistungsprinzip und Noten. In den letzten 20 Jahren ist diese Debatte deutlich pragmatischer
geworden. Auch wenn eine notenlose Erziehung im Prinzip dasselbe erreichen könnte, wird auf eine
Zensurgebung gerade wegen des mittlerweile globalisierten Leistungsprinzips nicht gern verzichtet.
Eine Zensurgebung muss gerecht sein, aber auch internationalen Vergleichsmaßstäben genügen. In
der Lehrerausbildung ist daher ein objektivierterer Anspruch an die Zensurgebung zu sehen, der das
Vergleichbare als das Nötige sieht - und ideologische Fallen vermeidet. Das modeme
Leistungsverständnis in der Schule ist aber auch vermehrt an dem Ideal eines vernünftigen
Zusammenlebens orientiert, bei dem Furcht vor sozialer Ausgrenzung eben zu der Integration sozialer
und emotionaler Faktoren in den Unterricht fuhrt: Die beiden Pole Leistung vs. Freiheit der von den
68ern angestoßenen Debatte werden dem modemen Leistungsverständnis der Schule auch hier wenig
gerecht. Dem Schulsystem soll so eine Qualifikations-, Integrations- und Selektions funktion
zukommen, die dem Erwerb kognitiver als auch affektiver, sozialer als auch psychomotorischer
Fähigkeiten dient (Lukesch 1998: 25). Es geht also längst nicht nur um maßvolle Selektion anhand
kognitive Fähigkeiten, sondern auch um Integration. In der Theorie (Ingenkamp & Lissmann 2008:
132) sollte deshalb hier ein besonderes Einverständnis zwischen Schulen und Kultusministerien
herrschen, das kognitive Leistungen mit sozialen und emotionalen Lernzielen zu einer
charakterformenden Kompetenzerfahrung verbindet. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort: Probleme der schulischen Leistungsbeurteilung
- Anspruch und Sinn von Schulleistungstests
- Aufbau, Qualität und Formen von Schulleistungstest
- Formen und Nebengütekriterien von Leistungstests
- Die Praxis: Durchführung, Auswertung und Interpretation
- Rückblick: Schulleistungstest für die Praxis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Thematik der Schulleistungstests und deren Einsatz in der Praxis. Ziel ist es, einen kompakten Überblick über die Grundprinzipien und Verfahren der pädagogischen Diagnostik zu geben und die Vorteile objektivierter schulischer Leistungsmessung aufzuzeigen. Dabei werden die Mängel herkömmlicher Zensurgebung und die Vorteile von praxisnahen Schulleistungstests beleuchtet.
- Probleme der traditionellen Zensurgebung und die Vorteile von Schulleistungstests
- Aufbau und Arten von Schulleistungstests
- Hauptgütekriterien und Nebengütekriterien von Schulleistungstests
- Praktische Durchführung, Auswertung und Interpretation von Schulleistungstests
- Der Einsatz von Schulleistungstests in der schulischen Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Probleme der schulischen Leistungsbeurteilung
Dieses Kapitel untersucht die kontroversen Diskussionen um schulische Leistungsbeurteilung und die Kritik an herkömmlichen Zensuren. Dabei werden die verschiedenen Beweggründe für diese Kritik beleuchtet und das Streben nach objektivierterer Leistungsmessung im Kontext der schulischen Praxis dargestellt.
Anspruch und Sinn von Schulleistungstests
In diesem Kapitel werden die Vorteile und die Bedeutung von Schulleistungstests im Vergleich zu herkömmlichen Zensurformen erläutert. Es wird betont, dass Schulleistungstests eine objektivere und zuverlässigere Methode der Leistungsmessung bieten und so zu einer gerechteren Beurteilung der Schüler beitragen können.
Aufbau, Qualität und Formen von Schulleistungstest
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Aufbau, den verschiedenen Arten und der Qualität von Schulleistungstests. Dabei werden die wichtigsten Gütekriterien, wie Objektivität, Reliabilität und Validität, vorgestellt und die Bedeutung dieser Kriterien für die Validität von Schulleistungstests erläutert.
Formen und Nebengütekriterien von Leistungstests
Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Formen von Leistungstests und deren Nebengütekriterien. Es werden wichtige Aspekte wie die Ökonomie, die Normierung und die Fairness von Schulleistungstests diskutiert.
Die Praxis: Durchführung, Auswertung und Interpretation
Dieses Kapitel befasst sich mit der praktischen Durchführung, Auswertung und Interpretation von Schulleistungstests. Es werden konkrete Beispiele aus der Praxis gegeben und hilfreiche Tipps zur Durchführung und Interpretation der Ergebnisse vorgestellt.
Schlüsselwörter
Schulleistungstests, pädagogische Diagnostik, Objektivität, Reliabilität, Validität, Nebengütekriterien, Leistungsmessung, Schulpraxis, Zensuren, Schulvergleichsstudien, Hamburger Schulleistungstest 4/5.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptprobleme herkömmlicher Schulnoten?
Kritisiert werden mangelnde Objektivität, Ungerechtigkeiten bei der Zensurgebung und die Gefahr sozialer Ausgrenzung durch schlechte Noten.
Welchen Vorteil bieten Schulleistungstests gegenüber Zensuren?
Sie ermöglichen eine objektivierte Leistungsmessung, die internationalen Vergleichsmaßstäben genügt und ideologische Fallen vermeidet.
Was sind die Gütekriterien eines guten Schulleistungstests?
Zentrale Kriterien sind Objektivität (Unabhängigkeit vom Prüfer), Reliabilität (Zuverlässigkeit) und Validität (Gültigkeit).
Was ist der „Hamburger Schulleistungstest 4/5“?
Ein spezifisches Diagnosewerkzeug, das in der Praxis eingesetzt wird, um kognitive Leistungen von Schülern objektiv zu erfassen.
Dienen Schulleistungstests nur der Selektion?
Nein, sie sollen auch der Integration dienen, indem sie soziale und emotionale Lernziele mit kognitiven Leistungen verknüpfen.
- Citation du texte
- M.A. Christopher Knapp (Auteur), 2012, Inklusiver Überblick über den Hamburger Schulleistungstest in der Praxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/211011