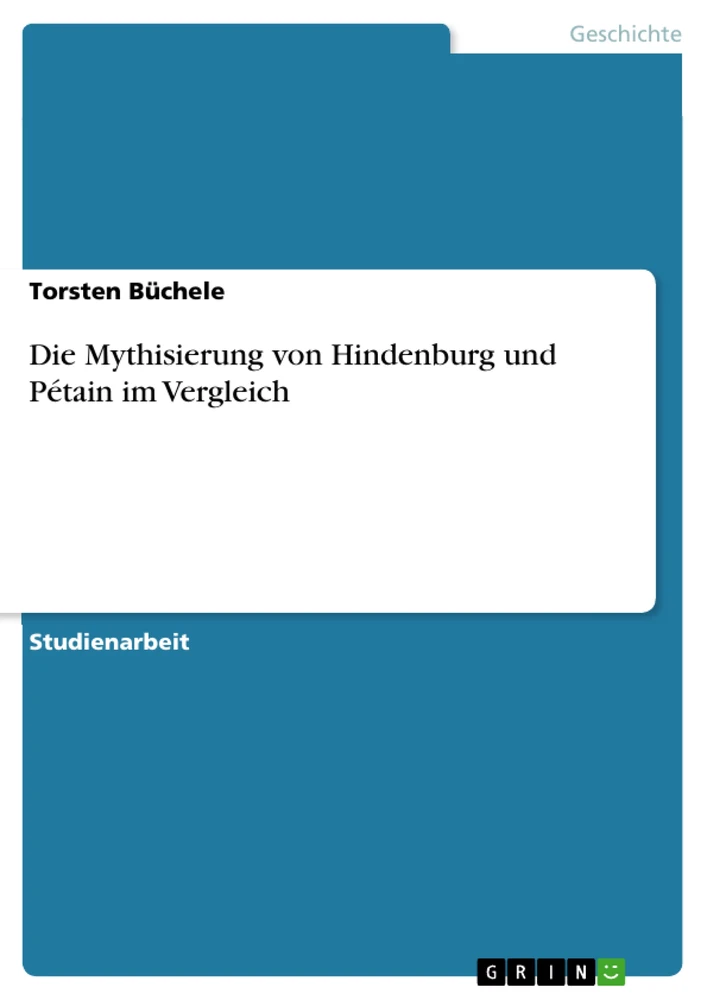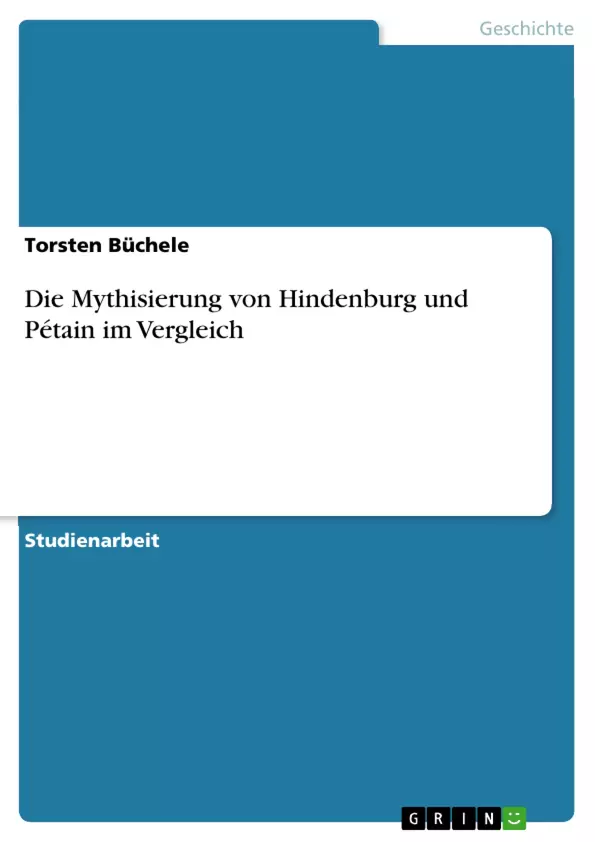Keine Determinante bestimmt unsere heutige Geschichte so sehr wie der Zweiten Weltkrieg. Dabei wird viel zu oft vergessen, dass das 20. Jahrhundert nicht nur aufgrund dieser Katastrophe „das deutsche Jahrhundert“ genannt wird. Als „Urkatastrophe“ gilt vielmehr der Erste Weltkrieg, dem in Frankreich wesentlich mehr Raum in der Forschung und im Bewusstsein eingeräumt wird. Um dieses Kapitel unserer Geschichte hierzulande stärker ins Bewusstsein zu rücken, lud das Historische Institut der Universität Stuttgart im Frühjahr 2012 den französischen „grand guerre“-Forscher Nicolas Beaupré zu einer Gastdozentur ein. In Stuttgart tobte zuletzt ein heftiger Disput über die Deutung des Handelns Pauls von Hindenburg, eines Generals des Großen Kriegs:
Dem Hindenburg-Bau gegenüber dem Hauptbahnhof wurde der Name entzogen. Der Schriftzug wurde 2010 abmontiert, nachdem der Stadtrat dem Reichspräsidenten von 1925 bis 1934 die Ehrenbürgerwürde entzogen hatte. Der Feldherr des 1. Weltkriegs sei als aktiver Wegbereiter Hitlers eine Symbolfigur für Demokratiefeinde. Die Debatte entzündete sich an Wolfram Pytas neuen Erkenntnissen in der Hindenburgforschung aus dem Jahr 2007. In Frankreich existiert eine Persönlichkeit mit auffälligen Parallelen: Philippe Pétain (1856-1951) war ein Zeitgenosse Hindenburgs, ebenfalls ein Held des Großen Krieges. Er mutierte im 2. Weltkrieg zum Gewaltherrscher. Auch um ihn rankt sich der Mythos des Triumphes, auch sein Andenken erregt die Gemüter. Diese Arbeit thematisiert den Mythos Paul von Hindenburg. Wie gelangte Hindenburg mit seinem Mythos zu politischer Macht? Wie instrumentalisierten ihn die Nazis? Ist Hindenburg heute noch ein Erinnerungsort? Darüber hinaus wird der Werdegang Hindenburgs mit dem Leben und Mythos Pétains in analogen Fragestellungen verglichen.
„Hindenburg und Pétain“ beleuchtet die Karriere zweier Generäle des Großen Krieges und ergründet, wie sich aus eigenem Handeln und fremden Zuschreibungen zwei Mythen entwickelten, die die politischen Geschehnisse noch auf Jahrzehnte hinaus bestimmten.
Pünktlich ein Jahr vom dem „Centenaire“, dem hundertsten Jahrestag des Ersten Weltkrieges, ermöglicht „Hindenburg und Pétain“ am Beispiel der Lichtgestalten der beiden großen Kriegsparteien vor allem Studierenden einen kompakten Einstieg in die Prosopografie des Krieges, untermauert sowohl durch Quellenstellen (v.a. Zeitungsberichte) wie auch auf einer breiten Basis an Literatur.
Inhaltsverzeichnis
- Pyta und der Streit im Stadtrat: Die aktuelle Brisanz Hindenburgs und Pétains
- Hindenburg und Pétain im Ersten Weltkrieg
- Hindenburg als Held von Tannenberg
- Paul von Hindenburg als Held der nationalen Einheit
- Philippe Pétain im ersten Weltkrieg und davor
- Die Zwischenkriegszeit
- Hindenburg in der Zeit des Übergangs zur Republik
- Hindenburgs erste Amtszeit als Reichpräsident 1925-1932
- Pétain in der Zwischenkriegszeit
- Unter dem Einfluss des Nationalsozialismus
- Hindenburgs zweite Amtszeit 1932-1934
- Pétain und Vichy im Zweiten Weltkrieg und darüber hinaus
- Militär, Mythos, Macht: Ein vergleichendes Fazit Hindenburgs und Pétains
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert den Mythos von Paul von Hindenburg und vergleicht dessen Entwicklung mit dem Leben und dem Mythos von Philippe Pétain. Sie untersucht, wie beide Persönlichkeiten zu politischer Macht gelangten, wie der Nationalsozialismus ihren Mythos instrumentalisierte und ob sie heute noch als Erinnerungsorte relevant sind. Die Arbeit fokussiert sich auf die drei Epochen Großer Krieg, Zwischenkriegszeit und Nationalsozialismus und analysiert chronologisch das Verhalten beider Personen auf mythologische Deutung hin.
- Die Entstehung und Entwicklung des Mythos von Paul von Hindenburg
- Die Instrumentalisierung des Hindenburg-Mythos durch den Nationalsozialismus
- Die Relevanz des Hindenburg-Mythos in der heutigen Zeit
- Der Vergleich des Mythos von Hindenburg mit dem Leben und dem Mythos von Philippe Pétain
- Die Bedeutung von Mythenbildung in der Geschichte und Politik
Zusammenfassung der Kapitel
Pyta und der Streit im Stadtrat: Die aktuelle Brisanz Hindenburgs und Pétains
Dieses Kapitel beleuchtet die Kontroverse um die Ehrenbürgerwürde von Paul von Hindenburg und die Umbenennung des Hindenburg-Baus in Stuttgart. Es zeigt die Aktualität der Debatte um Hindenburg und dessen Rolle im Aufstieg des Nationalsozialismus auf.
Hindenburg und Pétain im Ersten Weltkrieg
Hindenburg als Held von Tannenberg
Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung des Hindenburg-Mythos im Zusammenhang mit der Schlacht von Tannenberg. Es untersucht, wie Hindenburg durch strategisches Geschick und mediale Inszenierung zum „Helden von Tannenberg“ wurde.
Paul von Hindenburg als Held der nationalen Einheit
Dieses Kapitel befasst sich mit der Popularität von Hindenburg als Symbolfigur der nationalen Einheit im Ersten Weltkrieg. Es zeigt, wie Hindenburg durch seine Person und seine Taten die deutsche Kriegsmoral stärkte und sich zum Idol der Nation entwickelte.
Philippe Pétain im ersten Weltkrieg und davor
Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die militärische Karriere von Philippe Pétain vor und während des Ersten Weltkriegs. Es setzt Pétain in Relation zu Hindenburg und beleuchtet Parallelen und Unterschiede in ihren Karrieren und ihren Rollen im Krieg.
Die Zwischenkriegszeit
Hindenburg in der Zeit des Übergangs zur Republik
Dieses Kapitel beschreibt die Rolle von Hindenburg im Übergang von der Monarchie zur Republik. Es untersucht, wie sich Hindenburgs politische Positionen im Kontext der politischen und gesellschaftlichen Veränderungen der Zeit entwickelten.
Hindenburgs erste Amtszeit als Reichpräsident 1925-1932
Dieses Kapitel analysiert Hindenburgs politische Tätigkeit als Reichspräsident. Es beleuchtet seine Politik gegenüber den politischen Strömungen der Weimarer Republik und die Spannungen zwischen ihm und dem wachsenden Einfluss des Nationalsozialismus.
Pétain in der Zwischenkriegszeit
Dieses Kapitel beleuchtet die politische und militärische Rolle von Pétain in der Zwischenkriegszeit. Es untersucht, wie sich Pétain als Militär und als politischer Akteur in der instabilen Situation Frankreichs positionierte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Mythenbildung, Heldenverehrung, politische Instrumentalisierung, Nationalsozialismus, Erster Weltkrieg, Zwischenkriegszeit, Vergleichende Biografie, Paul von Hindenburg, Philippe Pétain. Sie befasst sich mit der Entstehung, Entwicklung und Relevanz von Mythen in der Geschichte und Politik und untersucht die Rolle historischer Persönlichkeiten in der Mythenbildung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Parallelen gibt es zwischen Hindenburg und Pétain?
Beide waren gefeierte Helden des Ersten Weltkriegs, die später in ihren Ländern zu politischen Führungspositionen aufstiegen und mit autoritären Regimen kollaborierten.
Wie entstand der Mythos Hindenburg?
Der Mythos begründete sich vor allem auf dem Sieg in der Schlacht von Tannenberg und wurde als Symbol der nationalen Einheit inszeniert.
Wie instrumentalisierten die Nationalsozialisten Hindenburg?
Sie nutzten sein hohes Ansehen beim Volk und beim Militär, um die Machtübernahme Hitlers zu legitimieren (z.B. am Tag von Potsdam).
Was war die Rolle von Philippe Pétain im Zweiten Weltkrieg?
Er wurde zum Chef des Vichy-Regimes, das mit Nazi-Deutschland kollaborierte, was seinen früheren Ruhm als „Held von Verdun“ überschattete.
Warum ist Hindenburg heute noch ein Thema in der Politik?
Es gibt anhaltende Debatten über seine Rolle als Wegbereiter Hitlers, was oft zur Aberkennung von Ehrenbürgerwürden oder Umbenennung von Gebäuden führt.
Was bedeutet „Prosopografie des Krieges“?
Es ist die Erforschung von Biographien historischer Personen, um größere gesellschaftliche und politische Zusammenhänge einer Epoche zu verstehen.
- Quote paper
- Torsten Büchele (Author), 2012, Die Mythisierung von Hindenburg und Pétain im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/211049