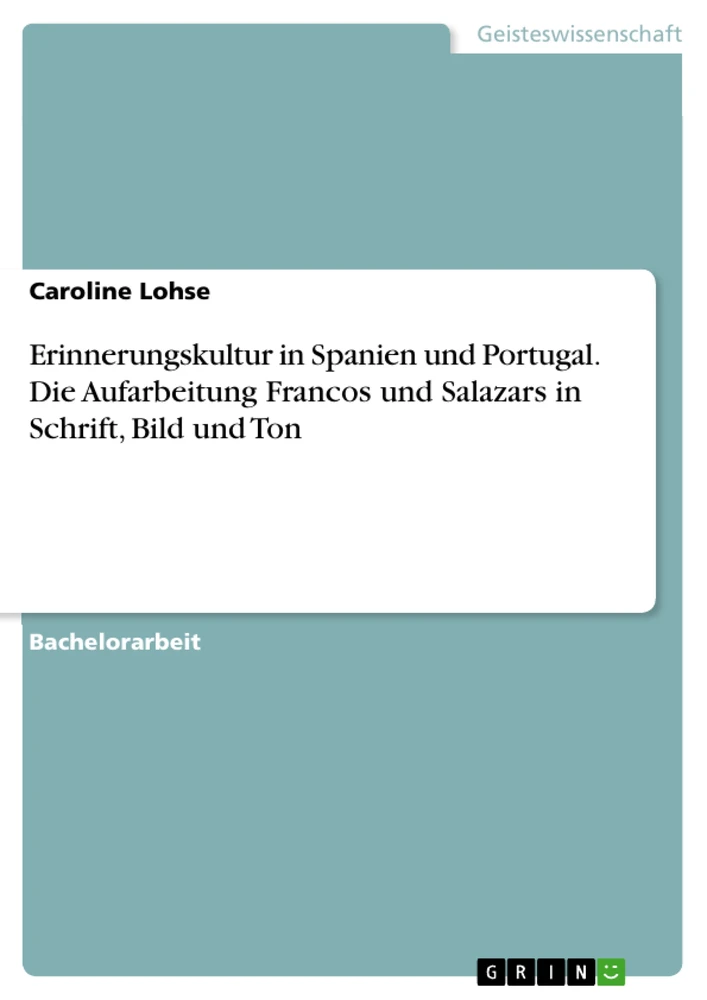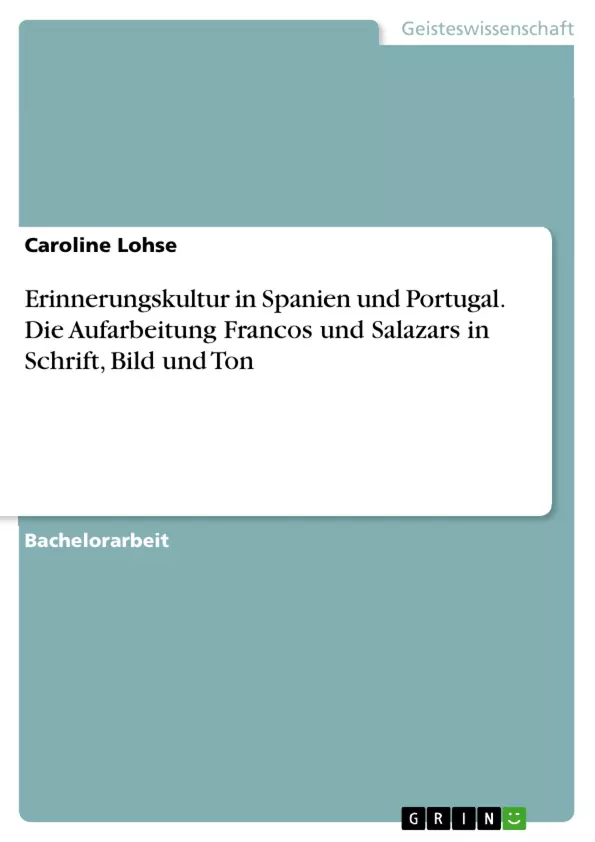Am 30. August 2012 titelte die überregionale Wochenzeitung DIE ZEIT „Wann
vergeht Vergangenheit?“ und widmete sich damit der Frage, welche politische und
gesellschaftliche Verantwortung den Deutschen aufgrund ihrer historischen Rolle
zukommt. Ausschlaggebend für diese Überlegung waren unterschiedliche
Anspielungen auf die einstmals dominierende deutsche Schreckensherrschaft, die vor
dem Hintergrund der aktuellen Finanzkrise innerhalb der europäischen Presse
aufgekommen sind. Zudem wird in dem Artikel darüber nachgedacht, welche
Auswirkungen die Verbrechen des Dritten Reichs auf die nationale Identität der
jüngeren deutschen Generationen haben kann oder sollte.
Es zeigt sich also deutlich, dass das geschichtliche Erbe eines Staates auch
Jahrzehnte nach einschneidenden Ereignissen ein wesentlicher Punkt für aktuelle
politische, soziale und kulturelle Entwicklungen im eigenen Land sowie im Dialog mit
anderen Nationen bleibt. Dieses Phänomen lässt sich hierbei nicht auf einige,
vereinzelte Beispiele beschränken, sondern ist eine allgemeingültige,
länderunabhängige Erscheinung. Allerdings ist an dieser Stelle hervorzuheben, dass
unser Kontinent aus heterogenen Nationalstaaten besteht und diese komplexe
Zusammensetzung trotz der Bestrebungen nach immer mehr europäischer Integration
auch zukünftig von Bestand sein wird. Dieser Umstand soll jedoch kein Hindernis für
die politische Bemühung um eine tief greifende Verzahnung sein. Dennoch macht er
deutlich, wie wichtig eine Aufarbeitung der Vergangenheit ist, damit ein friedliches Mit- und Nebeneinander auf nationaler und schließlich europäischer Ebene möglich ist.
Nationale Geschichten rücken damit in den Fokus einer gesamteuropäischen
Aufmerksamkeit. Die Beschäftigung mit verschiedenen Identitäten und mit den
unterschiedlichen Arten von Erinnerung hat in Anbetracht dessen in den vergangenen
20 Jahren an wissenschaftlicher Bedeutung gewonnen.[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Gedächtnis und Erinnerung
- 2.1. Kollektives und kulturelles Gedächtnis
- 2.2. Nationales Gedächtnis und Erinnerungspolitik
- 2.3. Medien der Erinnerung
- 3. Spanien, der Bürgerkrieg und der Franquismo
- 3.1. Franquistische Erinnerungspolitik
- 3.2. Die Aufarbeitung des Bürgerkriegs und der Militärdiktatur
- a) Literatur am Beispiel von Dulce Chacons „La voz dormida“
- b) Kino am Beispiel „Mambrú se fue a la guerra“ von Fernando Fernán Gómez
- c) Bildende Künste am Beispiel von Picassos „Guernica“
- 4. Portugal, Salazar und der Novo Estado
- 4.1. Die Aufarbeitung der portugiesischen Militärdiktatur
- a) Prosa von Manuel Alegre: „No meu país há uma palavra proibida“
- b) Der Fado aus Coimbra am Beispiel von Zeca Afonsos „Grândola vila morena“
- 4.2. Die Aufarbeitung der Kolonialkriege
- 4.1. Die Aufarbeitung der portugiesischen Militärdiktatur
- 5. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Erinnerungskultur auf der Iberischen Halbinsel im Fokus der Aufarbeitung der spanischen und portugiesischen Militärdiktaturen. Sie analysiert den kulturell-künstlerischen Bereich als maßgeblichen Aspekt der Ausbildung eines nationalen Gedächtnisses. Die Untersuchung umfasst literarische Werke, bildende Künste, Film und Musik, und betrachtet sowohl die Darstellung der Diktaturen durch Zeitzeugen als auch deren Rezeption durch nachfolgende Generationen.
- Die Rolle kulturellen Schaffens in der Ausbildung eines nationalen Gedächtnisses
- Die Aufarbeitung der spanischen und portugiesischen Militärdiktaturen in verschiedenen Medien
- Der Vergleich der spanischen und portugiesischen Erinnerungskultur
- Die Bedeutung von kollektivem, kulturellem und nationalem Gedächtnis
- Der Einfluss der Erinnerungskultur auf die nationale und europäische Identität
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz der Auseinandersetzung mit nationaler Geschichte und Erinnerungskultur dar, insbesondere im europäischen Kontext. Sie argumentiert, dass die Aufarbeitung vergangener Ereignisse, wie der spanischen und portugiesischen Militärdiktaturen, essentiell für ein friedliches Zusammenleben auf nationaler und europäischer Ebene ist. Die Arbeit fokussiert auf die kulturell-künstlerische Auseinandersetzung mit diesen Diktaturen und deren Kontext (Bürgerkrieg in Spanien, Kolonialkriege in Portugal), unter Einbezug verschiedener Medien und Generationen. Die Bedeutung der Forschung von Aleida und Jan Assmann im Bereich Gedächtnisforschung wird hervorgehoben.
2. Gedächtnis und Erinnerung: Dieses Kapitel führt in die zentrale Thematik der Erinnerungs- und Gedächtnisforschung ein. Es differenziert zwischen kollektivem, kulturellem und nationalem Gedächtnis, basierend auf den Arbeiten von Aleida und Jan Assmann. Die Bedeutung des politischen Aspekts der Erinnerungskultur und die Rolle verschiedener Medien in der Vermittlung und Speicherung von Wissen werden ebenfalls erörtert. Das Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die anschließende Analyse der Fallstudien.
3. Spanien, der Bürgerkrieg und der Franquismo: Dieses Kapitel analysiert die Aufarbeitung des spanischen Bürgerkriegs und der Franco-Diktatur anhand von Literatur (Dulce Chacón, „La voz dormida“), Film („Mambrú se fue a la guerra“ von Fernando Fernán Gómez) und bildender Kunst (Picassos „Guernica“). Es untersucht, wie diese Werke die franquistische Erinnerungspolitik reflektieren und zur kritischen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit beitragen. Die Kapitel analysiert die verschiedenen künstlerischen Herangehensweisen und deren Wirkung auf die Erinnerungskultur.
4. Portugal, Salazar und der Novo Estado: Analog zu Kapitel 3, untersucht dieses Kapitel die portugiesische Erinnerungskultur im Kontext der Salazar-Diktatur und der Kolonialkriege. Es analysiert die Werke von Manuel Alegre („No meu país há uma palavra proibida“) und Zeca Afonso („Grândola vila morena“) um die verschiedenen Aspekte der Aufarbeitung der Diktatur und ihrer Folgen zu beleuchten. Der Fado als Medium des Widerstands und der Erinnerung wird hier besonders hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Erinnerungskultur, Militärdiktaturen, Spanien, Portugal, Franquismo, Salazar, Bürgerkrieg, Kolonialkriege, nationales Gedächtnis, kollektives Gedächtnis, kulturelles Gedächtnis, Literatur, Film, Bildende Kunst, Musik, Vergangenheitsbewältigung, Identität, Europa.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Erinnerungskultur auf der Iberischen Halbinsel
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Erinnerungskultur auf der Iberischen Halbinsel, insbesondere die Aufarbeitung der spanischen und portugiesischen Militärdiktaturen. Der Fokus liegt auf der Rolle kultureller und künstlerischer Ausdrucksformen bei der Gestaltung eines nationalen Gedächtnisses.
Welche Medien werden analysiert?
Die Analyse umfasst literarische Werke, Filme, bildende Kunst und Musik. Es werden sowohl die Darstellungen der Diktaturen durch Zeitzeugen als auch deren Rezeption durch nachfolgende Generationen betrachtet.
Welche konkreten Beispiele werden untersucht?
Für Spanien werden Dulce Chacons „La voz dormida“ (Literatur), „Mambrú se fue a la guerra“ von Fernando Fernán Gómez (Film) und Picassos „Guernica“ (Bildende Kunst) analysiert. Für Portugal werden Manuel Alegres „No meu país há uma palavra proibida“ (Prosa) und Zeca Afonsos „Grândola vila morena“ (Fado) untersucht.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf der Gedächtnisforschung von Aleida und Jan Assmann, die zwischen kollektivem, kulturellem und nationalem Gedächtnis differenziert. Die Bedeutung der Erinnerungspolitik und die Rolle verschiedener Medien in der Vermittlung und Speicherung von Wissen werden ebenfalls berücksichtigt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Rolle kulturellen Schaffens in der Ausbildung eines nationalen Gedächtnisses, die Aufarbeitung der Diktaturen in verschiedenen Medien, einen Vergleich der spanischen und portugiesischen Erinnerungskulturen, die Bedeutung von kollektivem, kulturellem und nationalem Gedächtnis und den Einfluss der Erinnerungskultur auf die nationale und europäische Identität.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Gedächtnis- und Erinnerungsforschung, Kapitel zu Spanien (Bürgerkrieg und Franquismo) und Portugal (Salazar-Diktatur und Kolonialkriege) sowie ein Fazit und Ausblick. Jedes Kapitel analysiert die Aufarbeitung der jeweiligen Diktatur anhand konkreter Beispiele aus Literatur, Film, bildender Kunst und Musik.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Erinnerungskultur, Militärdiktaturen, Spanien, Portugal, Franquismo, Salazar, Bürgerkrieg, Kolonialkriege, nationales Gedächtnis, kollektives Gedächtnis, kulturelles Gedächtnis, Literatur, Film, Bildende Kunst, Musik, Vergangenheitsbewältigung, Identität, Europa.
- Citation du texte
- Caroline Lohse (Auteur), 2012, Erinnerungskultur in Spanien und Portugal. Die Aufarbeitung Francos und Salazars in Schrift, Bild und Ton, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/211271