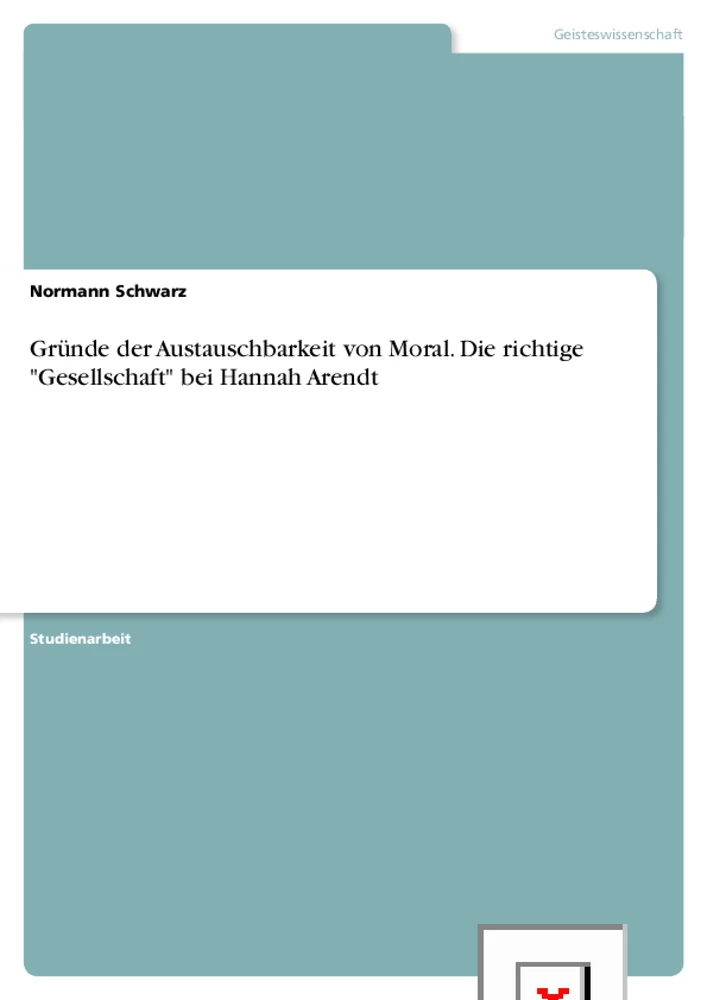Hannah Arendt geht in Ihrer Vorlesung „Some Questions of Moral Philosophy“, die sie 1965 an der New School for Social Research hielt, der Frage nach der Austauschbarkeit von Moralvorstellungen nach. Sie, als deutsch-jüdische Philosophin und Beobachterin des Eichmann-Prozesses, erhoffte sich va durch die Beobachtung dieses Prozesses mehr über die moralischen Antriebsgründe dieser Verbrechen zu erfahren. Die Abstreitung jeglicher Verantwortung durch die Täter mit dem Argument, dass sie lediglich Befehle befolgt hätten, arbeitete Arendt in ihrer Vorlesung „Some Questions of Moral Philosophy“ auf und versuchte sie anhand philosophiegeschichtlicher Beispiele moralisch einzuordnen.
Die genannte Vorlesung „Some Questions of Moral Philosophy“ erschien postum aus ihrem Nachlass unter dem deutschen Titel „Über das Böse. Eine Vorlesung über Fragen der Ethik“.
Durch die gesamte Vorlesung zieht sich zur Beantwortung der Frage was gut oder schlecht ist, die Frage nach der richtigen Gesellschaft. Sei es die Gesellschaft mit sich selbst oder mit anderen.
Im vorliegenden Paper möchte ich der Frage nach den Gründen der Austauschbarkeit von Moral mit Hilfe von Arendts Vorschlägen nachspüren. Ich möchte herausstreichen, wieso Arendt der Meinung war, dass es keine absolute Moral geben kann und wie wir moralische Urteile fällen, ob wir dazu überhaupt in der Lage sind und was dies mit unserer Gesellschaft - unserem Umgang - zu tun hat.
Inhaltsverzeichnis
1. ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
2. EINLEITUNG
3. WER HANNAH ARENDT WAR UND WARUM SIE DIE FRAGE NACH DEM BÖSEN INTERESSIERT
4. ALLGEMEINES
4.1. Ein neuer Wertekanon im Dritten Reich
5. VON DER RICHTIGEN GESELLSCHAFT
5.1. Von der Gesellschaft mit dem Selbst
„Zwei-in-Einem" bei Sokrates
Einsamkeit vs Verlassenheit
Das Böse führt kein Zwiegespräch
Das Böse als höchstpersönliche Angelegenheit
5.2. VonderGesellschaft mitVorbildern
Vom Willen und Urteilen
Vom Urteilen bei Immanuel Kant
Gemeinsinn bei Kant
6. RESÜMEE
7. LITERATURVERZEICHNIS
RECHTS- UND GENDERHINWEIS
Vorliegende Arbeit wurde von mir selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet. Alle Stellen, die wörtlich oder inhaltlich den angegebenen Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht.
Aus sprachlichen Gründen werden geschlechtsbezogene Bezeichnungen manchmal nur in einer Form verwendet. Damit ist keinerlei diskriminierende Wertung verbunden.
1. Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2. Einleitung
Das vorliegende Paper entstand im Rahmen eines Seminars über das Böse. Während des Seminars versuchten wir uns einen philosophisch-literarischen Zugang zum Begriff des Bösen zu erarbeiten. Mit Hilfe von Texten ua von Neiman Susan, Levi Primo, Nietzsche Friedrich, De Sade Marquis sowie Arendt Hannah haben wir unterschiedliche Zugänge zum Begriff des Bösen erarbeitet. Das Böse kann, wie wir gesehen haben, in Naturkatastrophen, als auch im menschlichen Handeln gesehen werden. Naturkatastrophen oder persönliche Unglücksfälle wurden lange Zeit im Gefolge der christlichen Doktrin als Strafe Gottes angesehen.
Mit der Aufklärung begann ein Umdenken, das sich vom Kniefall vor der Religion und ihren Glaubensüberzeugungen abwandte. Spätestens Nietzsche war es, der in seinem Zarathustra die Zerschmetterung der überkommenen Werte forderte. Trotz Säkularisierung und der Loslösung von christlichen Werten blieb das Böse in der Welt bestehen und manifestierte sich letztlich im Nationalsozialismus in einem ungeahnten und bis dorthin undenkbaren Ausmaß.
Hannah Arendt geht in Ihrer Vorlesung „Some Questions of Moral Philosophy", die sie 1965 an der New School for Social Research hielt, der Frage nach der Austauschbarkeit von Moralvorstellungen nach. Sie, als deutsch-jüdische Philosophin und Beobachterin des Eichmann-Prozesses, erhoffte sich va durch die Beobachtung dieses Prozesses mehr über die moralischen Antriebsgründe dieser Verbrechen zu erfahren. Die Abstreitung jeglicher Verantwortung durch die Täter mit dem Argument, dass sie lediglich Befehle befolgt hätten, arbeitete Arendt in ihrer Vorlesung „Some Questions of Moral Philosophy" auf und versuchte sie anhand philosophiegeschichtlicher Beispiele moralisch einzuordnen.
Die genannte Vorlesung „Some Questions of Moral Philosophy" erschien postum aus ihrem Nachlass unter dem deutschen Titel „Über das Böse. Eine Vorlesung über Fragen der Ethik".
Durch die gesamte Vorlesung zieht sich zur Beantwortung der Frage was gut oder schlecht ist, die Frage nach der richtigen Gesellschaft. Sei es die Gesellschaft mit sich selbst oder mit anderen.
Im vorliegenden Paper möchte ich der Frage nach den Gründen der Austauschbarkeit von Moral mit Hilfe von Arendts Vorschlägen nachspüren. Ich möchte herausstreichen, wieso Arendt der Meinung war, dass es keine absolute Moral geben kann und wie wir moralische Urteile fällen, ob wir dazu überhaupt in der Lage sind und was dies mit unserer Gesellschaft - unserem Umgang - zu tun hat.
3. Wer Hannah Arendt war und warum sie die Frage nach dem Bösen interessiert
Hannah Arendt wurde am 14.10.1906 in Hannover als Tochter einer wohlhabenden jüdischen Familie geboren. Die jüdische Tradition spielte in ihrer Familien nur mehr eine nebensächliche Rolle. Bereits mit 17 Jahren besuchte sie als Gasthörerin an der Universität Berlin philosophische sowie theologische Vorlesungen. Sie begann 1924 in Marburg Philosophie, Theologie und klassische Philologie zu studieren, wobei sie vom damals noch jungen Philosophieprofessor Martin Heidegger sehr beeindruckt war. Aufgrund ihres schwierigen Liebesverhältnisses zu Heidegger verließ sie die marburger Universität und landete über Umwege in Heidelberg. Arendt promovierte im Alter von 22 Jahren (1928) bei Kurt Jaspers über den Liebesbegriff bei Augustinus mit „magna cum laude".[1]
Bereits 1932 spielte sie mit dem Gedanken ihrer Emigration. 1933 wurde sie von der Gestapo für acht Tage in Haft genommen, da sie jüdischen Flüchtlingen in ihrer Wohnung Unterschlupf gewährte. 1933 emigrierte sie über Tschechien, Italien und die Schweiz nach Frankreich. 1937 wurde ihr die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt. 1940 wurde Arendt mit vielen anderen Emigranten in Südfrankreich interniert, weil sie als feindliche Ausländer galten. Nach rund einem Monat gelang ihr mit weiteren 200 Frauen die Flucht. 1941 gelang es Arendt über Portugal nach New York zu flüchten. Sie war dort als Kolumnistin tätig und setzte sich intensiv mit ihrem jüdischen Hintergrund auseinander.[2]
Adolf Eichmann, der für die Deportation von drei Million Juden verantwortlich war, wurde 1960 in Argentinien verhaftet. Er war 1942 Protokollführer der WannseeKonferenz, die 1942 zur „Endlösung der Judenfrage"[3] geführt hat. Arendt nahm am Gerichtsprozess gegen ihn als Berichterstatterin für die Zeitschrift The New Yorker teil, da sie sich gegenüber ihrer Vergangenheit dazu verpflichtet gefühlt hat. Über den Prozess verfasste sie das Buch „Report on the Banality of Evil". Darin versuchte sie die Geschehnisse des Prozesses und das Neue, das mit dem NS über die Welt gekommen war, in Worte zu fassen. Sie verstand Eichmann nicht als Inbegriff des Bösen, sondern als einen durchschnittlichen Menschen, der keinerlei Weitblick für die Folgen seiner Handlungen hatte. Das Todesurteil gegen ihn empfand sie dennoch als gerecht. Ihr Buch löste eine große Kontroverse über die NS-Vergangenheit sowie einen Sturm der Entrüstung gegen sie aus: mit dem Wort „banal" würde Eichmanns Schuld verharmlost werden; ihr wurde Verleumdung vorgeworfen, da sie aufgrund der getätigten Zeugenaussagen die Kollaboration der jüdischen Selbstverwaltung bei den Deportationen aus den Ghettos thematisiert hatte. Mit einer solchen Welle an Kritik von jeder nur erdenklichen Seite, eben auch von jüdischer, hatte Arendt nicht gerechnet. Sie war schockiert. Der Hass der ihr ihm Zuge der Eichmann-Debatte entgegengebracht wurde, ließ ua die Fragen nach dem Zusammenhang von Denken und Moral in ihr keimen.
Im Rahmen ihrer Lehrtätigkeit an verschiedenen Universitäten hielt sie Vorlesungen über den fraglichen Zusammenhang. So erschien ihre Vorlesung über Denken, Wollen und Urteilen postum drei Jahre nach ihrem Tod unter dem Titel „The Life of the Mind".
[...]
[1] Sonnleitner, Hannah Arendt. S 21ff. Wild, Hannah Arendt. S 11ff.
[2] Wild, Hannah Arendt. S 22ff.
[3] Wild, Hannah Arendt. S 47.
Häufig gestellte Fragen
Warum interessierte sich Hannah Arendt für den Eichmann-Prozess?
Arendt wollte die moralischen Antriebsgründe für die Verbrechen des Nationalsozialismus verstehen und untersuchen, wie Menschen ihre Verantwortung durch den Verweis auf „Befehl und Gehorsam“ abstreiten konnten.
Was bedeutet der Begriff „Banalität des Bösen“?
Arendt beschrieb damit Adolf Eichmann nicht als Monster, sondern als einen erschreckend durchschnittlichen Menschen, der unfähig war, über die Folgen seiner Handlungen nachzudenken.
Wie erklärt Arendt die Austauschbarkeit von Moral?
Sie beobachtete, wie schnell etablierte moralische Werte im Dritten Reich durch neue Normen ersetzt wurden, was sie zu der Frage führte, ob es überhaupt eine absolute Moral gibt.
Was ist das Konzept des „Zwei-in-Einem“?
Es beschreibt das stille Zwiegespräch des Menschen mit sich selbst (Denken). Wer dieses Gespräch nicht führt, verliert laut Arendt die Fähigkeit zum moralischen Urteilen.
Welchen Unterschied macht Arendt zwischen Einsamkeit und Verlassenheit?
Einsamkeit ist der Zustand des Denkens mit sich selbst, während Verlassenheit die totale Isolation des Individuums in totalitären Systemen beschreibt, die moralisches Handeln verhindert.
- Quote paper
- MMag. Normann Schwarz (Author), 2011, Gründe der Austauschbarkeit von Moral. Die richtige "Gesellschaft" bei Hannah Arendt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/211370