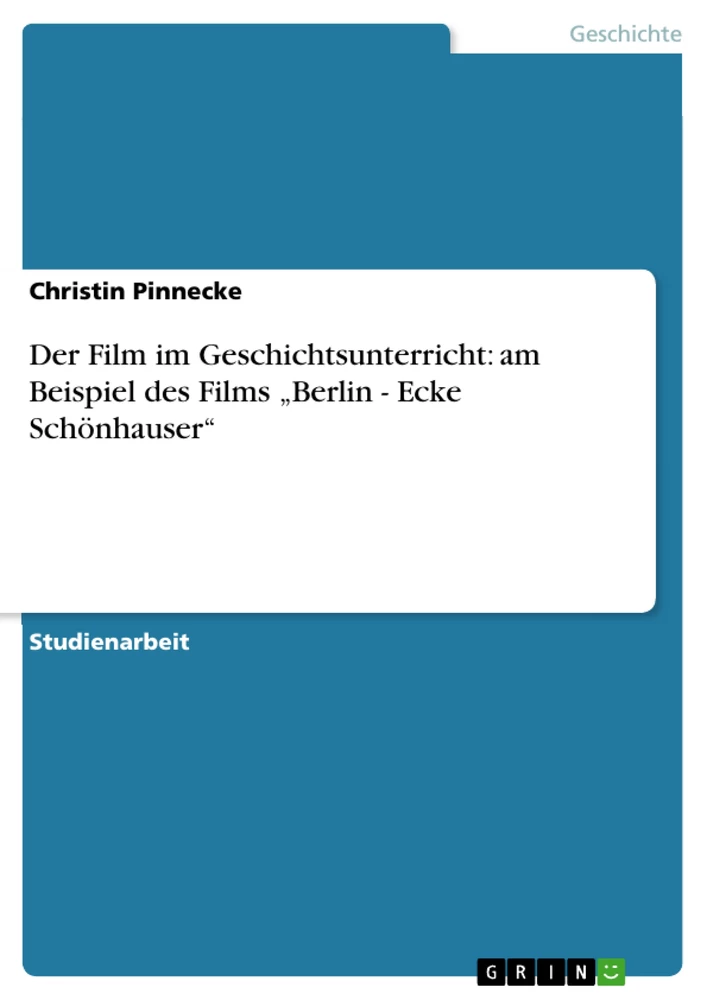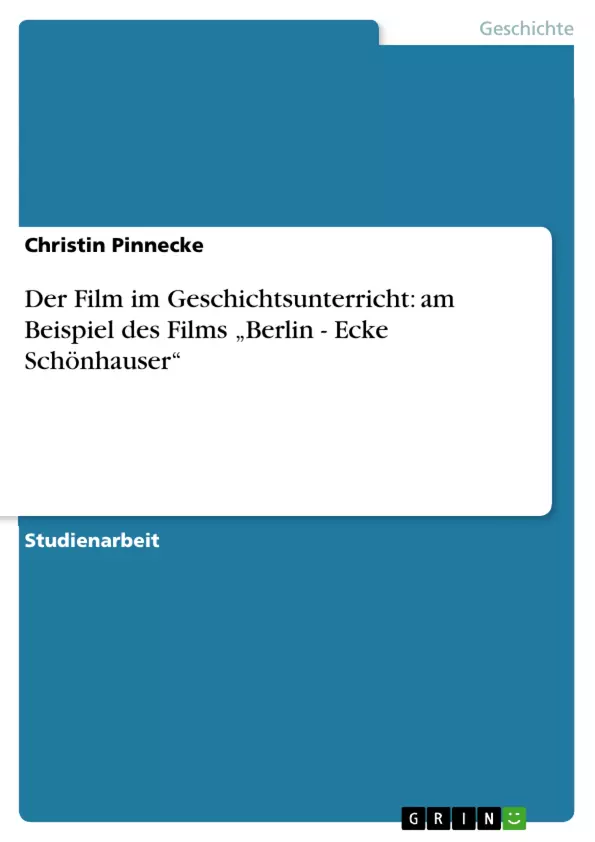Der Zusammenbruch der Deutschen Demokratischen Republik ist mittlerweile fast 22 Jahre her. Umso wichtiger ist die Aufarbeitung der Geschichte dieses Staates. Ziel des Geschichtsunterrichts ist es, den Schülern und Schülerinnen die vielfältigen und komplexen Ereignisse aus der Vergangenheit näher zu bringen. Der Fokus, der deutschen Aufarbeitung lag bis zu diesem Zeitpunkt eher auf das 19. und die erste Hälfte des 20. Jahrhundert. Die Aufarbeitung der deutsch-deutschen Geschichte erscheint mir immer noch nicht ausreichend. Aus diesem Grund habe ich mir als angehende Geschichtslehrerin das Ziel gesetzt, gerade diese Aspekte der deutschen Geschichte genauer zu beleuchten. Die nachkommenden Generationen kennen die DDR nur noch aus den Erzählungen der Eltern und Großeltern. Dabei besteht die Gefahr, dass Erlebnisse und Ereignisse nicht objektiv berichtet werden. Aus solchen Situationen können dann Vorurteile und Abneigungen entstehen.
Inhalt
Einleitung
Sachanalyse
Didaktische Analyse
Methodisches Vorgehen
Quellenverzeichnis
Literatur
Internetquellen
Filmquellen
Einleitung
Der Zusammenbruch der Deutschen Demokratischen Republik ist mittlerweile fast 22 Jahre her. Umso wichtiger ist die Aufarbeitung der Geschichte dieses Staates. Ziel des Geschichtsunterrichts ist es, den Schülern und Schülerinnen die vielfältigen und komplexen Ereignisse aus der Vergangenheit näher zu bringen. Der Fokus, der deutschen Aufarbeitung lag bis zu diesem Zeitpunkt eher auf das 19. und die erste Hälfte des 20. Jahrhundert. Die Aufarbeitung der deutsch-deutschen Geschichte erscheint mir immer noch nicht ausreichend. Aus diesem Grund habe ich mir als angehende Geschichtslehrerin das Ziel gesetzt, gerade diese Aspekte der deutschen Geschichte genauer zu beleuchten. Die nachkommenden Generationen kennen die DDR nur noch aus den Erzählungen der Eltern und Großeltern. Dabei besteht die Gefahr, dass Erlebnisse und Ereignisse nicht objektiv berichtet werden. Aus solchen Situationen können dann Vorurteile und Abneigungen entstehen.
Ich erlebte die DDR bis zu meinem vierten Lebensjahr und wuchs im einheitlichen Deutschland auf. Doch auch ich erlebte Schmähungen gegen meine Person. Diese basierte auf Vorurteilen, weil ich ein „Ossi“ bin. Ich möchte, dass in der Zukunft die Mauer auch aus den Köpfen der Menschen verschwindet. Denn nur so kann zusammen wachsen, was zusammen gehört. Dies funktioniert nur dann, wenn man aufklärt und erklärt. Die Schüler und Schülerinnen sollen verstehen, dass es ein Unrechtsstaat war, aber die Menschen, die in ihm lebten nicht schlechter waren als andere Menschen.
Ein Mittel für diese Arbeit ist das Medium „Film“. Laut Gerhard Schneider gibt es „keine Quelle, kein Medium, das hinsichtlich seiner Intensität und seiner Faszination, Suggestivität, Ausdrucksstärke und Erlebnisqualität, aber auch seiner Genauigkeit und Realitätsnähe dem Film gleichkäme.“ Diese Meinung vertrete ich auch. Aus diesem Grund möchte ich den Film stark in meinem Unterricht mit einbinden. Für die Aufarbeitung der Deutsch- deutschen Beziehung habe ich den Film „Berlin - Ecke Schönhauser“ gewählt. In diesem Film wird das Lebensgefühl und der Zeitgeist der Jugendlichen in den fünfziger Jahren der DDR sehr gut nachgestellt. Auch ist die Entstehungsgeschichte ein interessanter Punkt für sich.
Ziel dieser Hausarbeit ist es, den Film „Berlin - Ecke Schönhauser“ näher zu betrachten und abschließend seine didaktische Anwendbarkeit zu prüfen. Im Zuge dessen werde ich in der Sachanalyse allgemein zum Thema „Film“ eingehen. Auch werde ich dort den ausgewählten Film analysieren. Danach folgt die didaktische Analyse, in der ich die Gründe für die Wahl dieses Filmes erläutern werden. Diese Überlegung endet mit der methodischen Überlegung. Dabei werde ich ein Unterrichtsszenario skizzieren, in dem ich den Film einbetten würde. Zum Schluss folgt mein Fazit, in dem ich die Vor- und Nachteile nochmals zusammen fassen und beurteilen werde.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Warum eignet sich der Film „Berlin - Ecke Schönhauser“ für den Unterricht?
Der Film stellt das Lebensgefühl und den Zeitgeist der Jugendlichen in den 1950er Jahren der DDR authentisch dar.
Was ist das Ziel des Geschichtsunterrichts bei der DDR-Aufarbeitung?
Schüler sollen verstehen, dass die DDR ein Unrechtsstaat war, ohne dabei die Lebenswirklichkeit der Menschen abzuwerten oder Vorurteile zu verfestigen.
Welche Vorteile bietet das Medium Film als historische Quelle?
Filme besitzen eine hohe Intensität, Suggestivität und Erlebnisqualität, die Schülern komplexe Ereignisse näherbringen können.
Was wird in der Sachanalyse des Films untersucht?
Die Arbeit analysiert den Film selbst sowie seine Entstehungsgeschichte im Kontext der deutsch-deutschen Beziehungen.
Wie wird der Film methodisch in den Unterricht eingebettet?
Die Hausarbeit skizziert ein konkretes Unterrichtsszenario, um die didaktische Anwendbarkeit des Mediums zu prüfen.
- Quote paper
- Christin Pinnecke (Author), 2012, Der Film im Geschichtsunterricht: am Beispiel des Films „Berlin - Ecke Schönhauser“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/211377