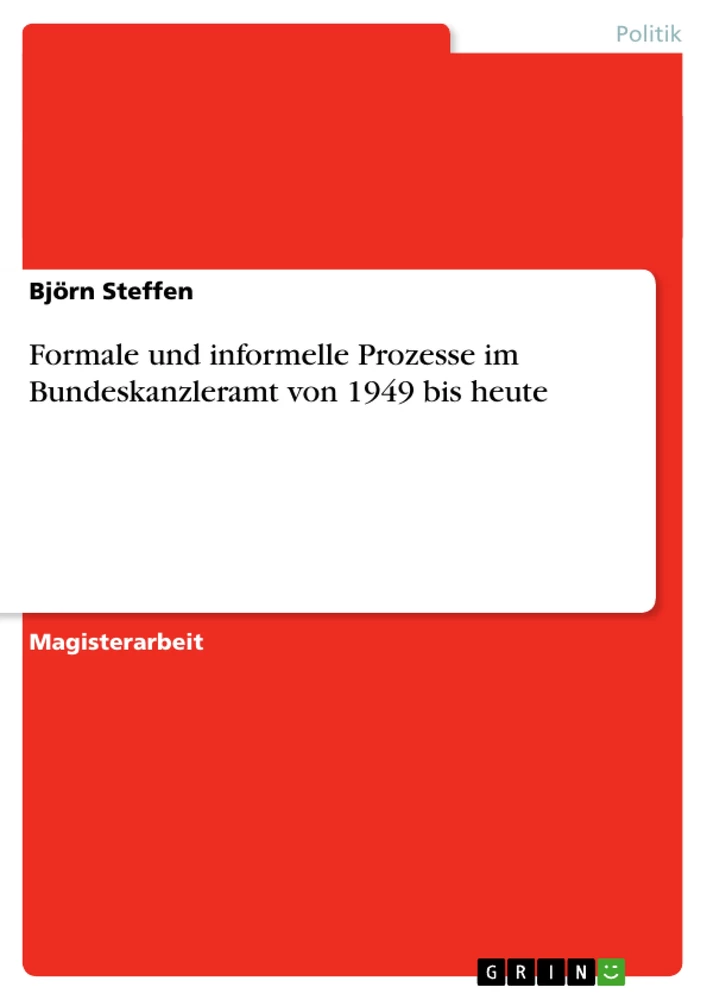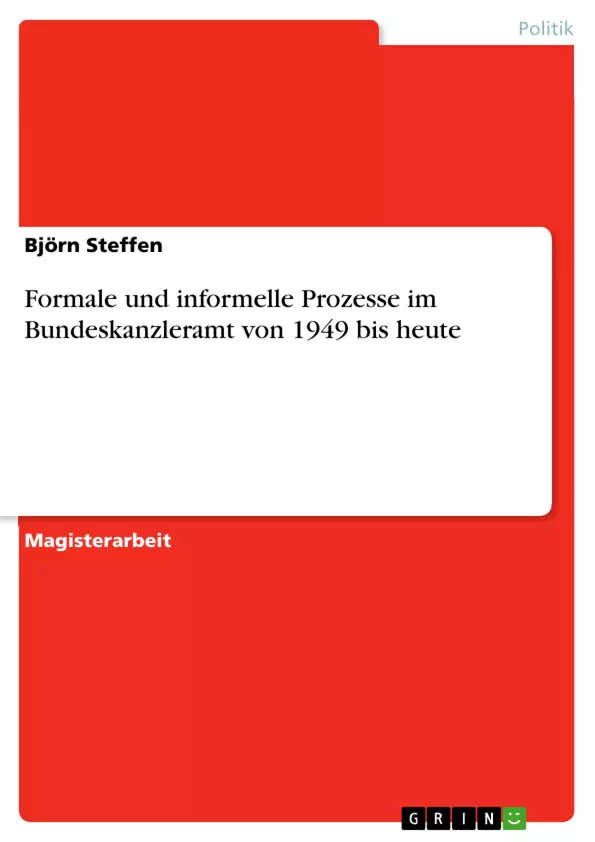[...] Ziel dieser Arbeit ist es, zu beleuchten, wie das Bundeskanzleramt seine Aufgaben seit
1949 wahrgenommen hat. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf formale und informelle
Prozesse gelegt und deren Bedeutung für die Arbeitsweise des Amtes untersucht.
Geht man davon aus, daß im „Gerüst (verwaltungs-)rechtlicher und formeller Kompetenzen
und Befugnisse in einer bürokratischen Organisation … mannigfaltige (i.d.R. unvorhergesehene)
informelle Prozesse“ wirken2, so stellen sich in bezug auf die Organisation und
Arbeitsweise des Kanzleramtes folgende Fragen: Wie war das Amt in den einzelnen Kanzlerschaften
formal organisiert bzw. aufgebaut? Wie entwickelt sich seine Organisationsstruktur
von 1949 bis heute?3 Inwiefern wirken sich in dem formalen Aufbau des Amtes
informelle Prozesse auf dessen Arbeitsweise aus? Welche Bedeutung haben informelle
Prozesse für die Informations- und Koordinierungstätigkeit des Bundeskanzleramtes? Trägt
das informelle Moment zu einer Verbesserung der Aufgabenerfüllung des Amtes bei? Außerdem ist ein ständiges Augenmerk auf informelle Vorabklärungen und ihre Wirkung auf
die formal zu treffenden Entscheidungen zu legen.
Um all diese Fragen beantworten zu können, ist es zunächst notwendig, die Bedeutung
der Begriffe ‚formal’ und ‚informell’ für den Gebrauch in dieser Untersuchung genau zu
bestimmen (Kapitel 1.1). Die so gegebene Grundlage bildet das Hintergrundgerüst der Kapitel
zu den jeweiligen Kanzlerschaften (Kapitel 5. bis 11.). Bevor jedoch auf die formalen
und informellen Prozesse im Bundeskanzleramt eingegangen werden kann, müssen die entscheidenden
grundgesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt werden, die überhaupt erst
die zentrale Stellung des Bundeskanzlers begründen (Kapitel 2.). Dabei spielt vor allem
Artikel 65 GG eine Rolle, der auch die Grundlage der Errichtung des Amtes darstellt.
Die Kapitel zu den jeweiligen Kanzlerschaften sind, um eine gute Vergleichsmöglichkeit
zu geben, prinzipiell gleich aufgebaut. [...]
2 Schulze-Fielitz, Helmuth: Der informale Verfassungsstaat. Berlin 1984, S. 12.
3 Der Untersuchungszeitraum der Arbeit endet mit der Bundestagswahl 2002.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärungen: „formal“, „formell“, „informal“, „informell“
- Forschungsstand und Materialbasis
- Methodik
- Normative Voraussetzungen für die hervorgehobene Stellung des Bundeskanzlers in der Bundesregierung
- Organisationsgewalt, Vertrauensfrage und Konstruktives Mißtrauensvotum als Verstärker der Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers
- Die Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers als Katalysator der Errichtung und Funktion des Bundeskanzleramtes
- Vorüberlegungen vor der Errichtung des Amtes
- Das Bundeskanzleramt als formal organisierte Verwaltungsbehörde
- Formale und informelle Prozesse im Bundeskanzleramt in der Ära Adenauer
- Der organisatorische und personelle Aufbau des Amtes 1949/50
- Die organisatorische und personelle Entwicklungen im Kanzleramt ab 1950
- Personalpolitik als Voraussetzung informeller Prozesse
- Die Wichtigkeit von Personalentscheidungen in der Aufbauzeit der Bundesregierung und der Bundesverwaltung
- Personalpolitische Entscheidungen von 1951 bis 1963 – Sicherung der Begleitung des formalen Kommunikationsweges durch informelle Kontakte
- Die Arbeitsweise des Bundeskanzleramtes in der Ära Adenauer
- Der Weg zur Geschäftsordnung – angewandte Arbeitsweise vor ihrer eigentlichen Formalisierung
- Die Wahrnehmung der Sekretariatsfunktion
- Beratung, Information und Unterstützung Adenauers
- Koordinierung im Sinne der Richtlinien der Politik und Entscheidungsvorbereitung
- Fazit: Vereinigung von Formalität und Informalität – Nutzung informeller Prozesse zur funktionalen Unterstützung der formalen Ordnung / Prozesse
- Formale und informelle Prozesse im Bundeskanzleramt in der Regierungszeit Ludwig Erhards
- Die organisatorische und personelle Entwicklung des Amtes von 1963 bis 1966
- Personalpolitik Erhards
- Die Arbeitsweise des Bundeskanzleramtes in der Regierungszeit Erhards
- Beratung, Information und Unterstützung Erhards
- Koordinierung im Sinne der Richtlinien der Politik und Entscheidungsvorbereitung
- Fazit: Die mangelhafte Nutzung des Bundeskanzleramtes als ein Grund für das frühe Scheitern Erhards
- Formale und informelle Prozesse im Bundeskanzleramt in der Regierungszeit Kiesingers
- Die organisatorische und personelle Entwicklung des Bundeskanzleramtes von 1966 bis 1969
- Personalpolitik Kiesingers
- Die Arbeitsweise des Bundeskanzleramtes in der Regierungszeit Kiesingers
- Beratung, Information und Unterstützung Kiesingers
- Koordinierung im Sinne der Richtlinien der Politik und Entscheidungsvorbereitung
- Fazit: Informelles Vorabklären als Voraussetzung formalen Erfolgs
- Formale und informelle Prozesse im Bundeskanzleramt in der Regierungszeit Brandts
- Die organisatorische und personelle Entwicklung des Bundeskanzleramtes von 1969 bis 1974
- Personalpolitik in der Regierungszeit Brandts
- Das Rotationsprinzip - Formalisierung der informellen Kontakte
- Die Arbeitsweise des Bundeskanzleramtes in der Regierungszeit Willy Brandts
- Beratung, Information und Unterstützung Brandts
- Planung
- Koordinierung im Sinne der Richtlinien der Politik und Entscheidungsvorbereitung
- Fazit: Das Bundeskanzleramt in der Regierungszeit Willy Brandts: Personalprozesse als Hindernis effizienter Arbeit
- Formale und informelle Prozesse in der Regierungszeit Helmut Schmidts
- Die organisatorische und personelle Entwicklung im Bundeskanzleramt von 1974 bis 1982
- Die „Wiedernutzbarmachung“ des personalen Moments – eine nähere Betrachtung der Personalpolitik Schmidts und Schülers
- Die Arbeitsweise des Bundeskanzleramtes in der Regierungszeit Schmidts
- Beratung, Information und Unterstützung Schmidts
- Koordinierung im Sinne der Richtlinien der Politik und Entscheidungsvorbereitung
- Das Ende der Koalition als Beispiel für die eingeschränkte Rolle der Geschäftsordnung
- Fazit: Das Bundeskanzleramt in der Regierungszeit Schmidts: Rückkehr zu den Wurzeln
- Formale und informelle Prozesse in der Regierungszeit Helmut Kohls
- Die organisatorische und personelle Entwicklung des Bundeskanzleramtes von 1982 bis 1998
- Personalpolitik Kohls – Parteiämter und Persönliche Beziehungen als Sprungbrett ins Kanzleramt
- Die Arbeitsweise des Bundeskanzleramtes in der Regierungszeit Kohls
- Beratung, Information und Unterstützung Kohls
- Zwischen Information, Beratung und Koordination – die Tätigkeit Horst Teltschiks als Beispiel für die informelle Durchdringung der formalen Ordnung
- Koordinierung im Sinne der Richtlinien des Bundeskanzlers und Entscheidungsvorbereitung
- Fazit: Das Bundeskanzleramt in der Ära Kohl: Informelle Durchdringung der formalen Ordnung
- Formale und informelle Prozesse im Bundeskanzleramt in der Regierungszeit Schröders von 1998 bis 2002
- Die organisatorische und personelle Entwicklung im Kanzleramt von 1998
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die formalen und informellen Prozesse im Bundeskanzleramt von 1949 bis 2002. Ziel ist es, die Entwicklung und das Zusammenspiel dieser Prozesse in den verschiedenen Kanzlerregierungen zu analysieren und deren Einfluss auf die Effizienz und Politikgestaltung aufzuzeigen.
- Entwicklung des Bundeskanzleramtes als Institution
- Zusammenspiel von formalen und informellen Machtstrukturen
- Einfluss der Kanzlerpersönlichkeit auf die Arbeitsweise des Amtes
- Rolle von Personalpolitik bei der Gestaltung informeller Prozesse
- Beziehung zwischen formalen Regeln (Geschäftsordnungen) und informellen Praktiken
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung definiert die zentralen Begriffe "formal" und "informal" im Kontext der Arbeit und skizziert den Forschungsstand sowie die angewandte Methodik. Sie legt den Fokus auf die Analyse des Zusammenspiels formeller Strukturen und informeller Prozesse innerhalb des Bundeskanzleramtes.
Normative Voraussetzungen für die hervorgehobene Stellung des Bundeskanzlers in der Bundesregierung: Dieses Kapitel untersucht die verfassungsrechtlichen Grundlagen der Machtposition des Bundeskanzlers und wie diese die Rolle und den Aufbau des Bundeskanzleramtes beeinflusst. Es analysiert die Richtlinienkompetenz des Kanzlers und deren Auswirkungen auf die Organisation des Amtes.
Das Bundeskanzleramt als formal organisierte Verwaltungsbehörde: Hier wird die formelle Struktur des Bundeskanzleramtes als Verwaltungsbehörde beleuchtet. Es wird die rechtliche Grundlage, die Hierarchien und die Aufgabenverteilung innerhalb des Amtes untersucht.
Formale und informelle Prozesse im Bundeskanzleramt in der Ära Adenauer: Dieses Kapitel analysiert die Arbeitsweise des Bundeskanzleramtes unter Konrad Adenauer, untersucht den Aufbau, die Personalpolitik und das Zusammenspiel formaler und informeller Prozesse. Es zeigt, wie Adenauer informelle Netzwerke zur Unterstützung seiner Politik nutzte und wie sich diese Prozesse auf die Entscheidungsfindung auswirkten.
Formale und informelle Prozesse im Bundeskanzleramt in der Regierungszeit Ludwig Erhards: Im Gegensatz zu Adenauer wird hier die weniger effektive Nutzung informeller Prozesse unter Erhard beleuchtet. Das Kapitel untersucht die Ursachen für das Scheitern Erhards im Amt, insbesondere die mangelnde Nutzung des Potenzials des Bundeskanzleramtes.
Formale und informelle Prozesse im Bundeskanzleramt in der Regierungszeit Kiesingers: Dieses Kapitel analysiert die Regierungszeit Kiesingers und betont die Bedeutung informeller Vorabklärungen für den Erfolg formeller Prozesse. Es untersucht die Rolle von informellen Kontakten und deren Beitrag zur effektiven Regierungsarbeit.
Formale und informelle Prozesse im Bundeskanzleramt in der Regierungszeit Brandts: Das Kapitel untersucht die Regierungszeit Willy Brandts, mit einem Fokus auf der Einführung des Rotationsprinzips als Versuch, informelle Kontakte zu formalisieren. Es analysiert die Herausforderungen der Personalpolitik und deren Auswirkungen auf die Effizienz des Amtes.
Formale und informelle Prozesse in der Regierungszeit Helmut Schmidts: Dieses Kapitel analysiert die Regierungszeit Schmidts und beschreibt die Rückkehr zu einer stärker auf die formalen Strukturen konzentrierten Arbeitsweise. Es untersucht die Personalpolitik und deren Einfluss auf die Prozesse im Kanzleramt.
Formale und informelle Prozesse in der Regierungszeit Helmut Kohls: Das Kapitel befasst sich mit der Regierungszeit Helmut Kohls und analysiert die informelle Durchdringung der formalen Ordnung. Es untersucht die Rolle persönlicher Beziehungen und informeller Netzwerke in der Politikgestaltung und Entscheidungsfindung.
Formale und informelle Prozesse im Bundeskanzleramt in der Regierungszeit Schröders von 1998 bis 2002: Dieses Kapitel bietet einen kurzen Überblick über die Entwicklungen im Bundeskanzleramt während der frühen Jahre der Schröder-Regierung. Es wird die organisatorische und personelle Entwicklung betrachtet.
Schlüsselwörter
Bundeskanzleramt, formale Prozesse, informelle Prozesse, Richtlinienkompetenz, Personalpolitik, Regierungsarbeit, Kanzler, Adenauer, Erhard, Kiesinger, Brandt, Schmidt, Kohl, Schröder, Entscheidungsfindung, Machtstrukturen, Verwaltung, Organisation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Bundeskanzleramt 1949-2002
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die formalen und informellen Prozesse im Bundeskanzleramt der Bundesrepublik Deutschland von 1949 bis 2002. Sie untersucht die Entwicklung und das Zusammenspiel dieser Prozesse unter verschiedenen Bundeskanzlern und deren Einfluss auf die Effizienz und Politikgestaltung.
Welche Bundeskanzler werden untersucht?
Die Arbeit betrachtet die Regierungszeiten von Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Kurt Georg Kiesinger, Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl und Gerhard Schröder. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der Arbeitsweisen und der Nutzung formaler und informeller Prozesse unter diesen Kanzlern.
Was versteht die Arbeit unter „formalen“ und „informellen“ Prozessen?
Die Arbeit unterscheidet zwischen formalen Prozessen, die durch Gesetze, Verordnungen und Geschäftsordnungen geregelt sind, und informellen Prozessen, die auf persönlichen Beziehungen, Netzwerken und ungeschriebenen Regeln beruhen. Die Analyse konzentriert sich auf das Zusammenspiel beider Prozessarten.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung des Bundeskanzleramtes als Institution, das Zusammenspiel von formalen und informellen Machtstrukturen, den Einfluss der Kanzlerpersönlichkeit, die Rolle der Personalpolitik und die Beziehung zwischen formalen Regeln und informellen Praktiken.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Methodik und den Forschungsstand erläutert. Es folgen Kapitel zu den normativen Voraussetzungen der Kanzlermacht, der formalen Struktur des Bundeskanzleramtes und detaillierten Analysen der Regierungszeiten der einzelnen Bundeskanzler. Jedes Kapitel untersucht die spezifischen formalen und informellen Prozesse und deren Auswirkungen auf die Regierungsarbeit.
Welche Rolle spielt die Personalpolitik?
Die Personalpolitik wird als wichtiger Faktor für die Gestaltung informeller Prozesse betrachtet. Die Arbeit analysiert, wie die Kanzler durch ihre Personalentscheidungen informelle Netzwerke beeinflusst und geschaffen haben und wie diese die Effizienz der Regierungsarbeit beeinflussten.
Wie wird der Einfluss der Kanzlerpersönlichkeit dargestellt?
Die Arbeit zeigt, wie die Persönlichkeit und der Führungsstil jedes Kanzlers die Arbeitsweise des Bundeskanzleramtes und das Zusammenspiel von formalen und informellen Prozessen prägte. Der Vergleich der verschiedenen Regierungszeiten verdeutlicht diesen Einfluss.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen für die einzelnen Kanzlerperioden. Sie zeigt, wie die erfolgreiche Nutzung informeller Prozesse neben den formalen Strukturen die Effizienz der Regierungsarbeit steigern konnte, während ein Mangel an informellen Kontakten und deren Nutzung zu Problemen führen konnte. Die Arbeit betont die komplexe Interaktion von formalen und informellen Elementen im Bundeskanzleramt.
Welche Quellen wurden verwendet?
(Diese Frage kann nicht aus dem gegebenen HTML beantwortet werden. Die verwendeten Quellen sind nicht im HTML-Code aufgeführt.)
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, die sich mit der Geschichte und Organisation der Bundesregierung, der deutschen Politikwissenschaft, Verwaltungswissenschaft und dem Vergleich verschiedener Regierungsstile befassen. Sie ist auch für alle Interessierte an der deutschen Nachkriegsgeschichte und der Funktionsweise des Bundeskanzleramtes relevant.
- Quote paper
- Björn Steffen (Author), 2002, Formale und informelle Prozesse im Bundeskanzleramt von 1949 bis heute, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/21142