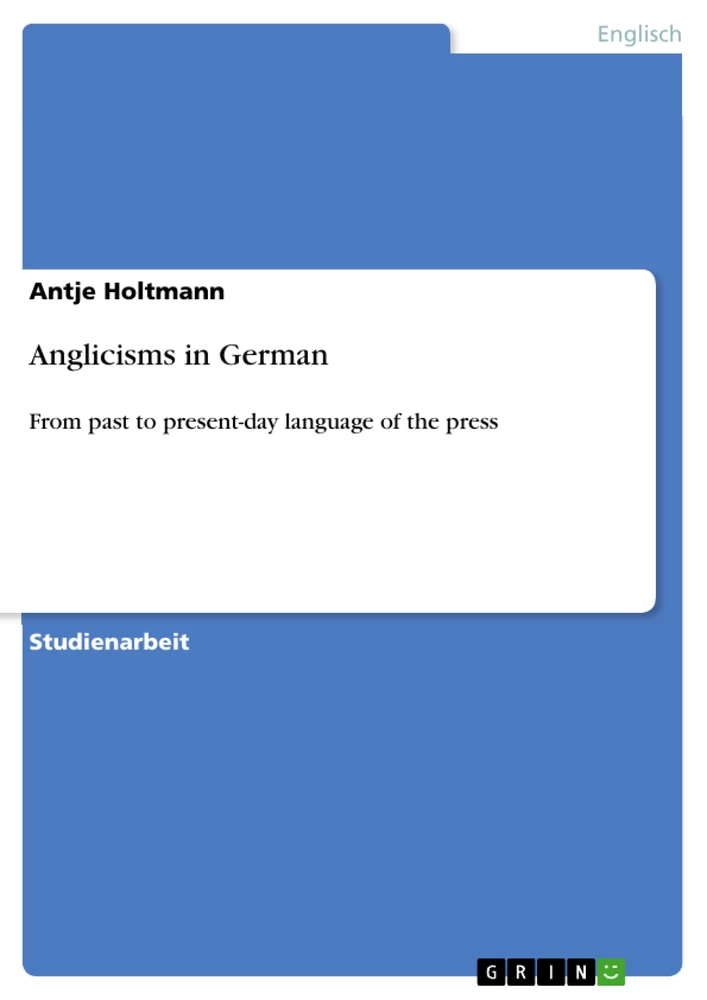[...] Language contact, however, is a normal phenomenon and "as a historical fact has been
acknowledged since antiquity, but not, however, as a phenomenon worthy of study [ ... ] But
only in the last decades of the nineteenth century did questions of language contact become
an area of scientific interest (Oksaar 1996; If.)" (Svetlana, 20). Most of the older studies
focus on the synchronic aspects whereas newer studies also take a diachronic view into
consideration (cf. Burmasova, 10). Furthermore, morphological and orthographic aspects
play a role in addition of the frequency of use (cf. Burmasova, 11).
Nowadays, there are a lot of critical voices which reject the use of anglicisms because they
fear a loss of German language heritage. There are even some initiatives providing
equivalents for every English word. The Verein deutscher Sprache (Association of the
German Language), for instance, emphasizes the importance of German equivalents Thus,
the question is whether it is possible to find equivalents for every anglicisms and if those
equivalents are suitable. Moreover, the question arises if anglicisms are on the rise to an
extend where they may threaten the German language.
In this term paper, I want to take a closer look on the use of anglicisms in the press in order
to find an answer to these questions. In the course of this, I want to refer to studies by
NICOLE PLUMER, ALEXANDRA ZURN and CHRISTIANE GOTZELER. I also want to provide some
samples from Stern and Bild and present my own results. Before that, a definition of the
term anglicism will be given. Moreover, I want to take historical developments into
consideration, including German reactions to certain changes. After that, a classification of
anglicisms will be provided in order to become aware of the different types. Furthermore, I want to present some linguistic changes connected to anglicisms. Lastly, I want to provide
some considerations concerning the language of the press and present my own little study
in this field before I come to my conclusion.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition
- 3. Historische Aspekte
- 3.1 Deutsche Reaktionen
- 3.2 Verwandte Entwicklungen
- 4. Klassifizierung
- 4.1 Lexikalische Entlehnung vs. semantische Entlehnung
- 4.2 Lehnübersetzungen, Exotismen und Hybride
- 5. Sprachliche Veränderungen
- 5.1 Bedeutungsänderung
- 5.2 Aussprache und Rechtschreibung
- 5.3 Morphologie
- 6. Anglizismen in deutschen Zeitungen
- 6.1 Die Sprache der Presse
- 6.2 Gründe für die Quellenwahl
- 6.3 Quellen
- 6.4 Methode
- 6.5 Ergebnisse
- 6.6 Ein genauerer Blick: Anglizismen und ihre deutschen Äquivalente
- 6.7 Gründe für den Gebrauch von Anglizismen in der Presse
- 7. Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verwendung von Anglizismen in der deutschen Presse. Das Hauptziel ist es, die Frage zu beantworten, ob Anglizismen die deutsche Sprache bedrohen und ob für jeden Anglizismus ein adäquates deutsches Äquivalent existiert. Die Arbeit stützt sich auf vorhandene Studien und eigene Ergebnisse, die auf einer Analyse von Texten aus ausgewählten Zeitungen basieren.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs "Anglizismus"
- Historische Entwicklung der Anglizismen im Deutschen
- Klassifizierung von Anglizismen und ihre sprachlichen Auswirkungen
- Analyse der Verwendung von Anglizismen in der deutschen Presse
- Bewertung der Notwendigkeit und des Ausmaßes der Anglizismen im Deutschen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Anglizismen im Deutschen dar, insbesondere im Kontext der globalen Dominanz der englischen Sprache und ihres Einflusses auf Alltagssprache und Fachgebiete. Sie hebt die Notwendigkeit einer diachronen und synchronen Betrachtungsweise hervor und erwähnt kritische Stimmen, die einen Verlust des deutschen Sprachguts befürchten. Die Arbeit kündigt die eigene Untersuchung der Anglizismen in der Presse an und benennt die zu verwendenden Quellen und Methoden.
2. Definition: Dieses Kapitel beleuchtet die Komplexität der Definition des Begriffs "Anglizismus". Es werden verschiedene Definitionen aus unterschiedlichen Quellen präsentiert und verglichen, die auf Form, Bedeutung und Herkunft basieren. Die Diskussion hebt die Unterschiede zwischen Anglizismen, Internationalismen und Fremdwörtern hervor und betont die Schwierigkeit, eine einheitliche Definition zu finden, was eine synchrone und diachrone Perspektive erfordert.
3. Historische Aspekte: Dieses Kapitel zeichnet die historische Entwicklung des Anglizismen-Eintrags im Deutschen nach, beginnend mit frühen Kontakten im fünften Jahrhundert bis hin zum intensiveren Austausch im 17. Jahrhundert, verbunden mit politischen Ereignissen und dem wachsenden Interesse an England. Es wird auf die schrittweise Übernahme englischer Lehnwörter eingegangen, deren Integration in die deutsche Sprache und deren fortschreitende Assimilation. Die sechs Schritte des lexikalischen Entlehnungsprozesses werden beschrieben.
Schlüsselwörter
Anglizismen, deutsche Sprache, Presse, Sprachwandel, Lexikologie, Entlehnung, semantische Entlehnung, lexikalische Entlehnung, historische Entwicklung, sprachliche Veränderungen, Zeitungsanalyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Anglizismen in der deutschen Presse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Verwendung von Anglizismen in der deutschen Presse. Sie untersucht, ob Anglizismen die deutsche Sprache bedrohen und ob für jeden Anglizismus ein adäquates deutsches Äquivalent existiert.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst die Definition und Abgrenzung des Begriffs "Anglizismus", die historische Entwicklung von Anglizismen im Deutschen, die Klassifizierung von Anglizismen und deren sprachliche Auswirkungen, sowie eine detaillierte Analyse der Verwendung von Anglizismen in ausgewählten deutschen Zeitungen. Es werden die Gründe für den Gebrauch von Anglizismen in der Presse untersucht und die Notwendigkeit und das Ausmaß der Anglizismen im Deutschen bewertet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung, Definition von Anglizismen, Historische Aspekte (inkl. deutscher Reaktionen und verwandter Entwicklungen), Klassifizierung von Anglizismen (inkl. lexikalische vs. semantische Entlehnung, Lehnübersetzungen, Exotismen und Hybride), Sprachliche Veränderungen (Bedeutungsänderung, Aussprache, Rechtschreibung, Morphologie), Anglizismen in deutschen Zeitungen (inkl. Methodenbeschreibung, Ergebnisse und detaillierte Analyse) und Schlussfolgerung.
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf vorhandene Studien und eigene Ergebnisse, die auf einer Analyse von Texten aus ausgewählten Zeitungen basieren. Die genauen Methoden der Quellenwahl und der Textanalyse werden im Kapitel über Anglizismen in deutschen Zeitungen detailliert beschrieben.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die konkreten Quellen werden im Kapitel "Anglizismen in deutschen Zeitungen" genannt. Die Arbeit bezieht sich sowohl auf existierende Studien als auch auf eine eigenständige Analyse von Zeitungstexten.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse der Analyse der Anglizismen in der deutschen Presse werden im Kapitel "Anglizismen in deutschen Zeitungen" vorgestellt. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich von Anglizismen und ihren deutschen Äquivalenten und der Begründung für die Verwendung von Anglizismen in der Presse.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerung fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen und bewertet die Auswirkungen von Anglizismen auf die deutsche Sprache. Sie beantwortet die Forschungsfragen nach der Bedrohung der deutschen Sprache durch Anglizismen und der Existenz adäquater deutscher Äquivalente.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Anglizismen, deutsche Sprache, Presse, Sprachwandel, Lexikologie, Entlehnung, semantische Entlehnung, lexikalische Entlehnung, historische Entwicklung, sprachliche Veränderungen, Zeitungsanalyse.
- Citation du texte
- Antje Holtmann (Auteur), 2012, Anglicisms in German, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/211630