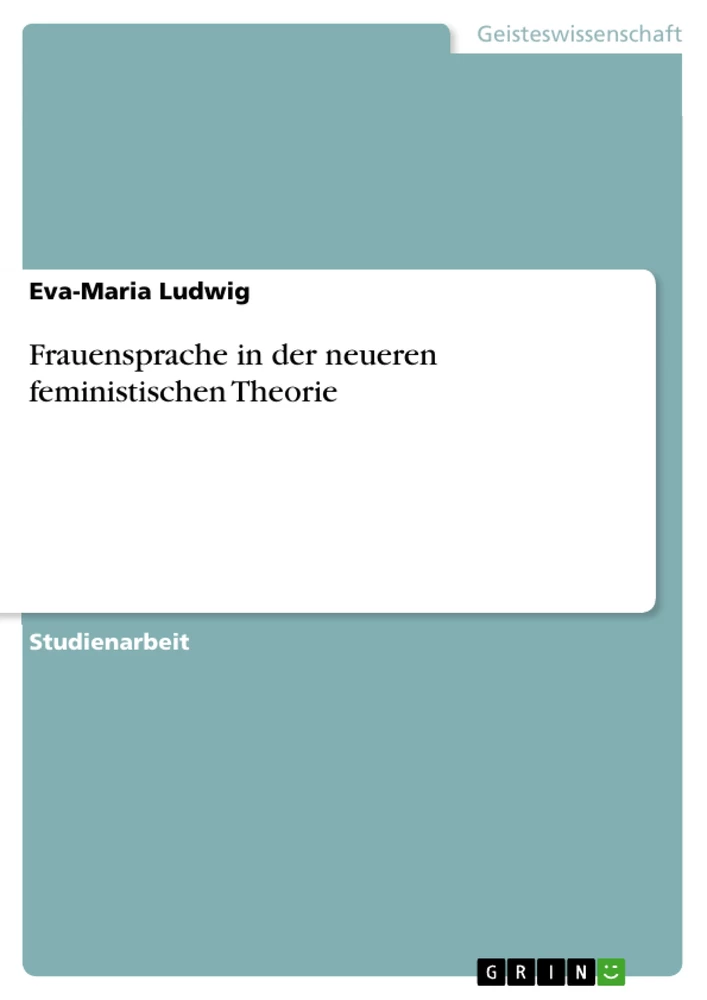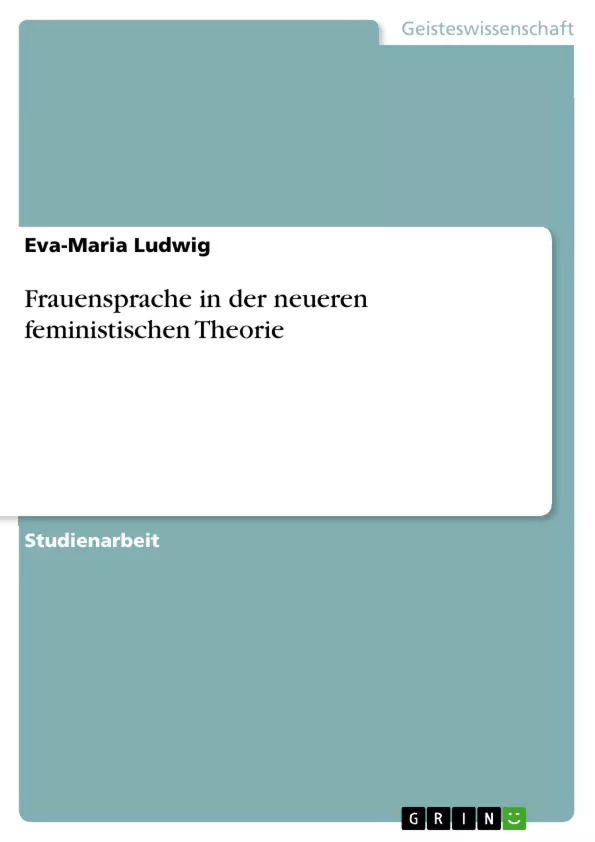„Sexismus war immer mehr als das, was in der nichtssagenen Geschmeidigkeit politischer Rhetorik „die Benachteiligung der Frau“ heißt oder was Soziologen verharmlosend mit „traditioneller Rollenverteilung“ bezeichnen. Sexismus war immer Ausbeutung, Verstümmelung, Vernichtung, Beherrschung, Verfolgung von Frauen. Sexismus ist gleichzeitig subtil und tödlich und bedeutet die Verneinung des weiblichen Körpers, die Gewalt gegenüber dem Ich der Frau, die Achtlosigkeit gegenüber ihrer Existenz, die Enteignung ihrer Gedanken, die Kolonialisierung und Nutznießung ihres Körpers, den Entzug der eigenen Sprache bis zur Kontrolle ihres Gewissens, die Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit, die Unterschlagung ihres Beitrags zur Geschichte der menschlichen Gattung.“ (Janssen-Jureit 1978, zit. in Samel 2000:15)
Inhaltsverzeichnis
1. Überblick über die Entstehung der feministischen Sprachwissenschaft
1.1. Historischer Abriss: Die Frauenbewegung(en).
1.2. Entstehung der Feministischen Linguistik
1.3. Die Idee von den „Frauensprachen“.
2. Kritik an Sprachsystem und Sprachgebrauch
2.1. Grundgedanken der feministischen Sprachkritik
2.2. Männlicher und weiblicher Sprachgebrauch: Unterschiede und Hintergründe
2.2.1. Feministische Forschungsergebnisse
2.2.1.1. Frauensprache bei Key und Lakoff
2.2.1.2. Charakteristika und Hypothesen zum weiblichen Sprachverhalten
2.2.1.3. Das Aufkommen des Begriffes Genderlect
2.2.2. Nicht-feministische Forschungsergebnisse: Geschlechtsbedingte Unterschiede im Sprachgebrauch
2.3. Diskriminierung der Frau in patriarchalischen Sprachen
2.3.1. Das generische Maskulinum
2.3.2. Genus und Sexus bei Personenbezeichnungen
3. Vorschläge für ein geschlechtergerechtes Deutsch
3.1. Beidbenennung
3.2. Das generische Femininum
3.3. Neutralisation
4. Schlussbetrachtung
4.1. Sprachwandel unter dem Einfluss der Frauenbewegung
4.1.1. Richtlinien für einen nichtsexistischen Sprachgebrauch
4.1.2. Einführung neutraler Berufsbezeichnungen
4.2. Kritik an der Feministischen Linguistik
5. Quellen
5.1. Bibliographie
5.2. Internetquellen
Häufig gestellte Fragen
Was ist feministische Linguistik?
Die feministische Linguistik untersucht die Benachteiligung und Diskriminierung von Frauen in der Sprache sowie geschlechtsspezifische Unterschiede im Sprachgebrauch.
Was wird am generischen Maskulinum kritisiert?
Es wird kritisiert, dass Frauen sprachlich nur „mitgemeint“ sind, was zu einer geringeren Sichtbarkeit von Frauen in der gesellschaftlichen Wahrnehmung führt.
Was versteht man unter dem Begriff „Genderlect“?
Genderlect bezeichnet die Hypothese, dass Männer und Frauen unterschiedliche Kommunikationsstile oder sprachliche Varietäten verwenden.
Welche Vorschläge gibt es für ein geschlechtergerechtes Deutsch?
Die Arbeit diskutiert Ansätze wie die Beidbenennung (Paarformen), das generische Femininum sowie die Neutralisation von Personenbezeichnungen.
Wie entstand die feministische Sprachkritik?
Sie entwickelte sich aus der Frauenbewegung der 1970er-Jahre als Reaktion auf Sexismus und die Ausbeutung von Frauen in patriarchalen Strukturen.
- Quote paper
- Eva-Maria Ludwig (Author), 2012, Frauensprache in der neueren feministischen Theorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/211746