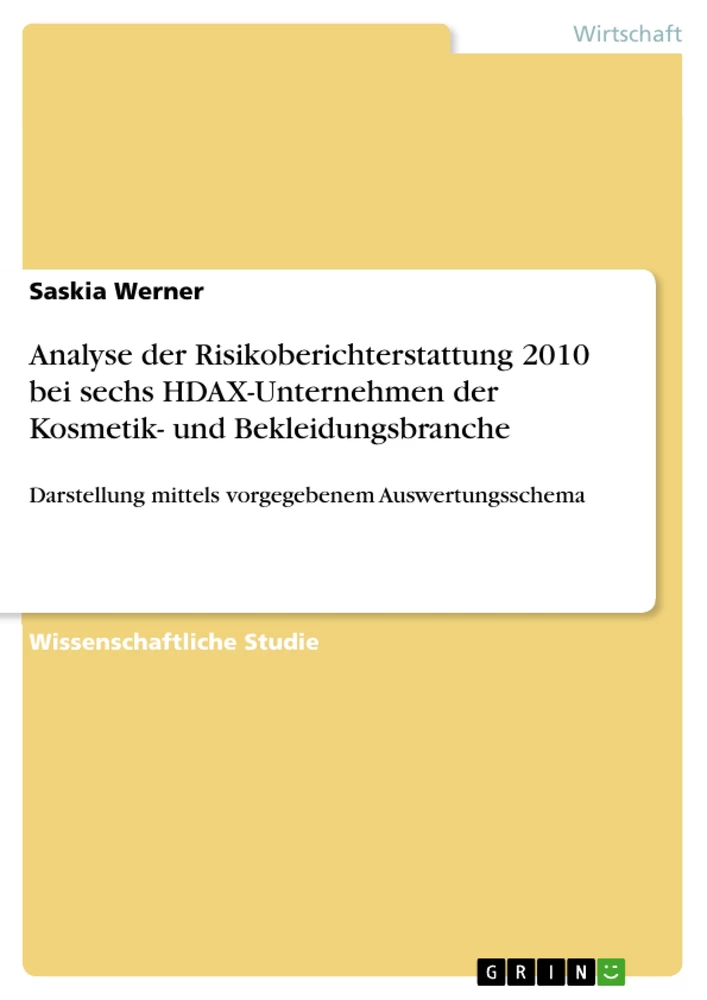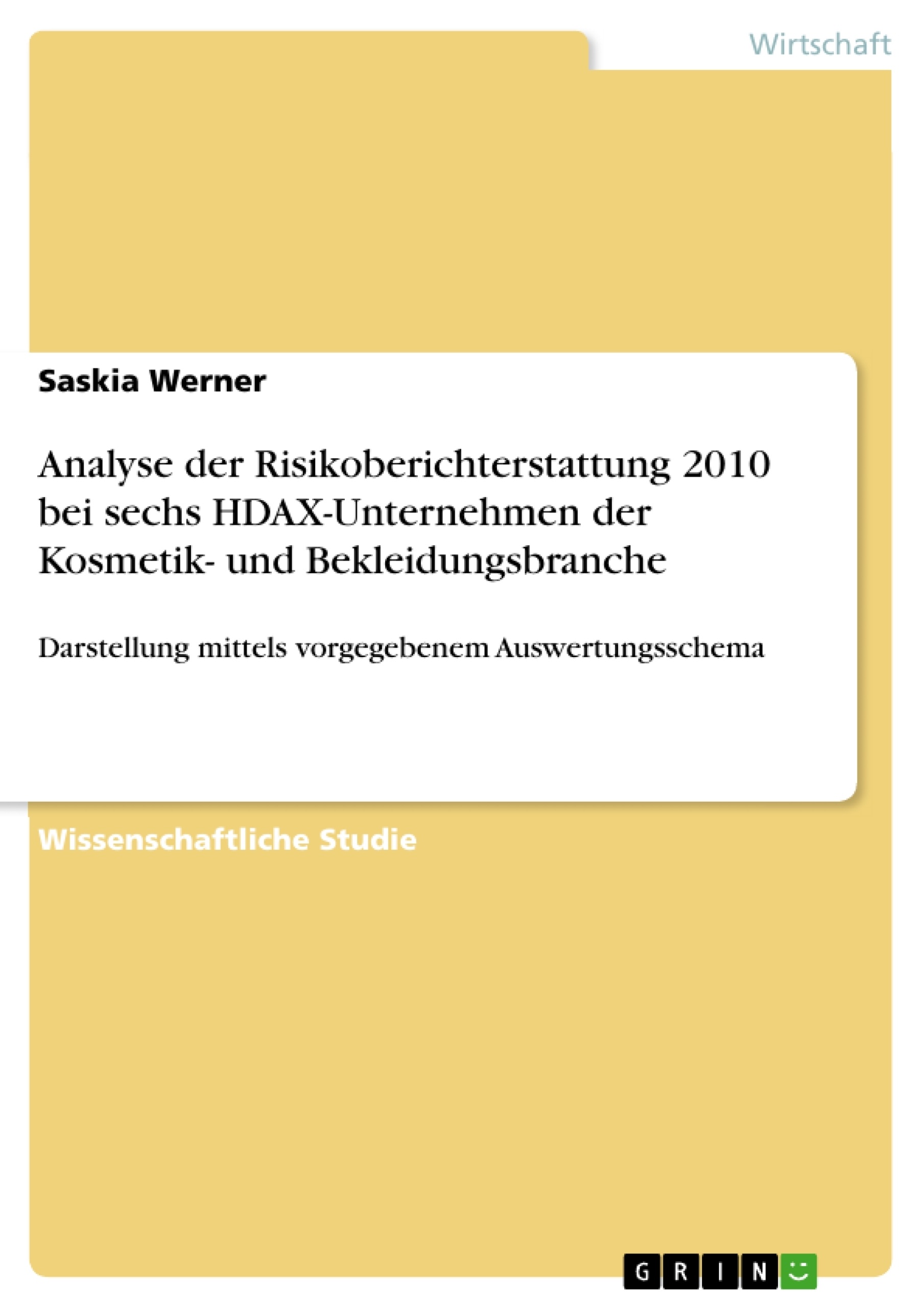Die Risikoberichterstattung im Jahr 2010 von sechs im HDAX gelisteten Unternehmen
wird in sechs Kapiteln fokussiert.
Im ersten Kapitel werden, wie zum Teil schon in 1.1 erwähnt, die Zielsetzung dieses
Praxisberichts und sein Aufbau (1.2) geschildert. Diesem Kapitel folgt die Darstellung
des theoretischen Hintergrunds des Risikomanagements und der Berichterstattung (2.1)
und der gesetzlichen Grundlagen, welche durch das KonTraG und den DRS 5 definiert
werden (2.2). Im dritten Kapitel wird die Funktionsweise der bei der Auswertung
angewendeten Methode – der Qualitativen Inhaltsanalyse - anhand des vorgegebenen
Auswertungsschemas demonstriert (3.1, 3.2). Die generierten Ergebnisse werden im
vierten Kapitel bzgl. des Risikomanagements (4.2), der Informationsqualität der
Risikoberichte (4.3), des Einflusses der Unternehmensgröße (4.4) und der
Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Konzern- und Branchenvergleich (4.5) erläutert.
Im Anschluss wird der Stand des Risikomanagements der Konzerne 2010 und die
resultierenden Optimierungspotenziale bzgl. der Berichterstattung (5.1) kritisch
hinterleuchtet und die angewandte Methodik bzgl. ihrer Subjektivität hinterfragt (5.2).
Abschließend wird im Schlusswort dargestellt, inwiefern die Zielstellung erreicht
worden ist und die Konzerne eine adäquate Risikoberichterstattung umgesetzt haben
(6.).
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1.Einleitung
1.1 Zielsetzung
1.2 Aufbau
2. Grundlagen der Risikoberichterstattung und des Risikomanagements
2.1 Theoretische Grundlagen
2.1.1 Risiko
2.1.2 Risikomanagement
2. 2 Gesetzliche Grundlagen
2.2.1 Gesetz zur Kontrolle und Transparenz (KonTraG)
2.2.1.1 Erweiterte Berichtspflichten
2.2.1.2 Geltungsbereich
2.2.2 Deutscher Rechnungslegungsstandard Nr. 5 (DRS5 5)
2.2.2.1 Konkretisierte Berichtspflichten
2.2.2.2. Geltungsbereich
3. Methode
3.1 Grundlagen der Inhaltsanalyse
3.2 Auswertungsmethode der bestehenden Studie
3.3 Anwendung des Auswertungsschemas
4. Ergebnisse
4.1 Risikodarstellung
4.2 Risikomanagement
4.2.1 Strategie/Philosophie/Politik
4.2.2 Risikoanalyse
4.2.3 Risikoaggregation
4.2.4 Aufbau- und Ablauforganisation
4.2.5 Risikosteuerung und –überwachung
4.3 Informationsqualität der Risikoberichte
4.3.1 Risikokategorien
4.3.2 Risikobeschreibung
4.3.3 Risikoquantifizierung
4.3.4 Risikobewältigung
4.3.5 Gesamtrisikoposition
4.4 Einfluss der Unternehmensgröße
4.5 Gemeinsamkeiten & Unterschiede
4.5.1 Konzernvergleich
4.5.2 Branchenvergleich
5. Diskussion
5.1 Grenzen der Risikoberichterstattung
5.2 Kritische Reflexion der Methodik
6. Schlusswort
Glossar
Anhang
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieses Berichts zur Risikoberichterstattung?
Ziel ist die Analyse der Risikoberichte von sechs HDAX-Unternehmen der Kosmetik- und Bekleidungsbranche aus dem Jahr 2010 hinsichtlich ihrer Informationsqualität und Gesetzmäßigkeit.
Welche gesetzlichen Grundlagen müssen Unternehmen beachten?
Wichtige Grundlagen sind das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) sowie der Deutsche Rechnungslegungsstandard Nr. 5 (DRS 5).
Welche Methode wurde für die Auswertung verwendet?
Es wurde die Qualitative Inhaltsanalyse angewendet, um die Risikomanagementsysteme und die Berichterstattung systematisch zu vergleichen.
Spielt die Unternehmensgröße eine Rolle bei der Berichterstattung?
Ja, die Arbeit untersucht explizit den Einfluss der Unternehmensgröße auf die Detailtiefe und Qualität der veröffentlichten Risikoinformationen.
Was sind typische Risikokategorien in diesen Berichten?
Dazu zählen strategische Risiken, Marktrisiken, finanzielle Risiken sowie operative Risiken, die quantifiziert und bewertet werden müssen.
- Citar trabajo
- Saskia Werner (Autor), 2013, Analyse der Risikoberichterstattung 2010 bei sechs HDAX-Unternehmen der Kosmetik- und Bekleidungsbranche, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/211784