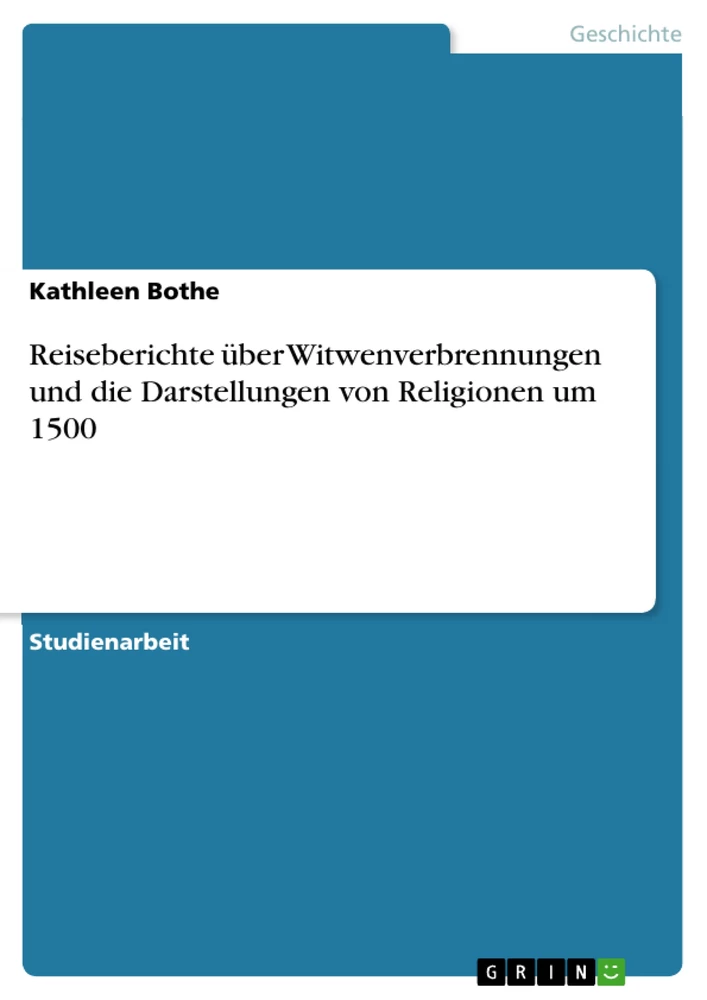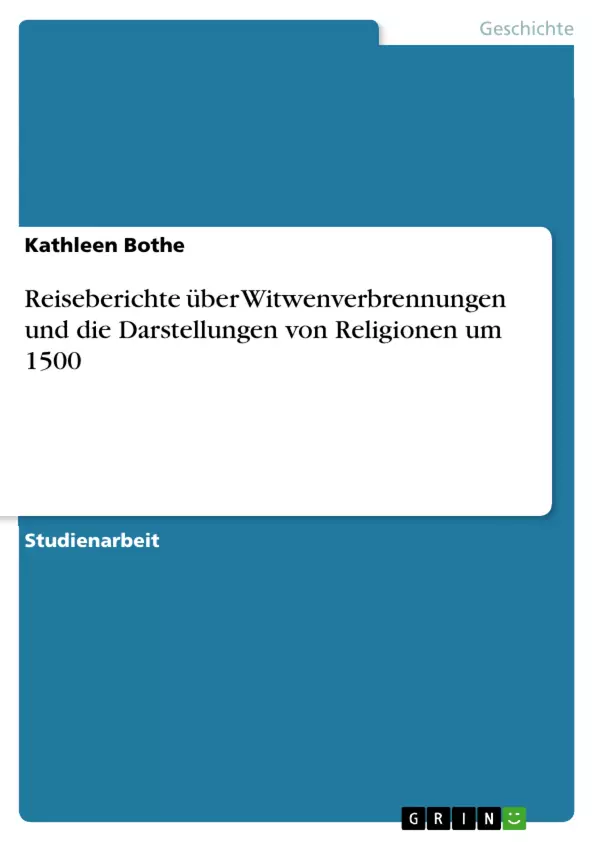[...] Es soll aufgezeigt werden, welche Funktion die Witwenverbrennung innerhalb der
Glaubenskultur der indischen Bevölkerung innehatte. Dazu werden exemplarisch Quellenstellen nach der Thematisierung des Bestattungsrituals untersucht. Die Grundlage
dafür bilden drei Reiseberichte, welche ungefähr um 1500 verfasst wurden: Ein Bericht
Balthasar Springers mit dem Titel Merfart in Faksimile – Die Meerfahrt und Entdeckung
neuer Seewege zu unbekannten Inseln und Königreichen9, Die Reisen des Niccolò
de Conti im Osten zu Beginn des 15. Jahrhunderts und Eine Beschreibung der Ostafrikanischen Küste und der Küste Malabars11 von Duarte Barbosa. Zur besseren Einordnung werden im ersten Teil der Arbeit Informationen über die Personen gegeben und in ihren historischen Kontext gebettet. Hier wird ihre unterschiedliche Intention deutlich werden. Danach werden exemplarisch Quellenstellen nach der Thematisierung des Bestattungsrituals untersucht. Interessant wird dann sein, wie die drei genannten Reisenden ihre Beobachtungen schildern und ob sich wertende Aussagen in den Quellen wiederfinden. Ziel dieser Arbeit wird die Analyse und der Vergleich der Quellenstellen und die Beantwortung der Frage nach der Funktion der Witwenverbrennung sein. Im Ergebnis
wird außerdem ein sehr ausführliches Bild über das Bestattungsritual vorliegen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Begriffsklärung
3. Über dieAutoren
3.1 Balthasar Springer
3.2 Niccolò de Conti beziehungsweise Poggio Bracciolini
3.3 Duarte Barbosa
4. Die Wahrnehmung der Witwenverbrennung in den Quellen
4.1 Der Reisebericht Balthasar Springers
4.2 Der Reisebericht von Bracciolini über die Reisen Niccolò de Contis
4.3 Der Bericht über die Reisen Duarte Barbosas
5. Fazit
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema der historischen Reiseberichte um 1500?
Die Arbeit analysiert die Darstellung und Wahrnehmung der indischen Witwenverbrennung (Sati) in den Berichten europäischer Reisender um das Jahr 1500.
Welche Autoren werden in der Arbeit untersucht?
Untersucht werden die Berichte von Balthasar Springer, Niccolò de Conti (aufgezeichnet von Poggio Bracciolini) und Duarte Barbosa.
Welche Funktion hatte die Witwenverbrennung in der indischen Kultur?
Die Arbeit geht der Frage nach, welche religiöse und soziale Bedeutung dieses Bestattungsritual innerhalb der damaligen indischen Glaubenskultur einnahm.
Wie werteten die europäischen Reisenden das Ritual?
Die Analyse vergleicht, ob die Schilderungen rein deskriptiv blieben oder ob sich moralische und religiöse Wertungen der christlichen Autoren in den Texten finden.
In welchem historischen Kontext entstanden diese Berichte?
Sie entstanden im Zeitalter der Entdeckungen, als Europäer begannen, neue Seewege nach Indien zu erkunden und erstmals detailliert über fremde Religionen und Bräuche berichteten.
- Citar trabajo
- Kathleen Bothe (Autor), 2012, Reiseberichte über Witwenverbrennungen und die Darstellungen von Religionen um 1500, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/211830