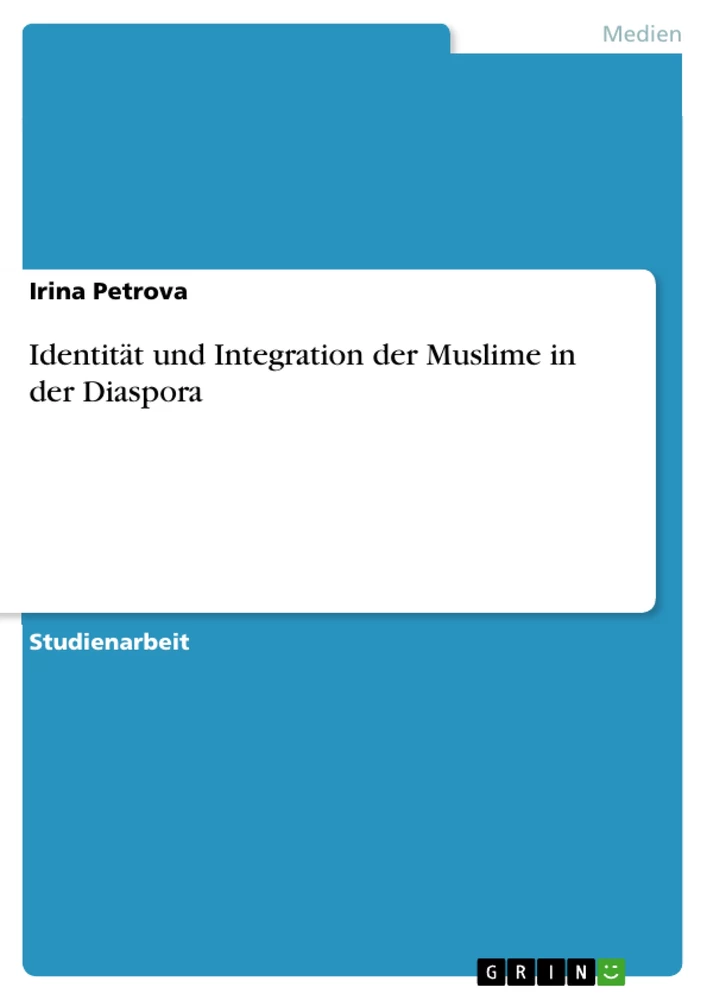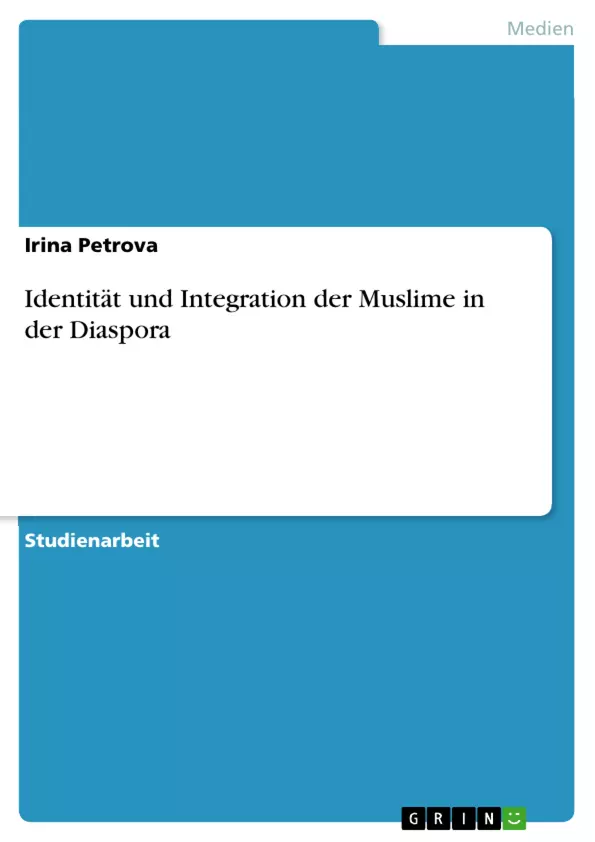Der Islam ist in den letzten Jahrzehnten zur zweitgrößten Religion Europas nach dem Christentum aufgestiegen. Alleine in Deutschland wird die Zahl der Muslime auf ca. 1,5 bis 3,3 Millionen geschätzt. Darunter sind fast 2,1 Millionen Muslime türkischer Staatsangehörigkeit; also zwei Drittel der Gesamtzahl.
Muslimische Zuwanderer stellen heute eine bedeutende Minderheit dar. Wenn die Mehrheit sie heute immer stärker und immer besorgter wahrnimmt, hat das im Wesentlichen drei Gründe: Erstens das Coming-Out der Muslime; also die schlichte Tatsache, dass Muslime zunehmend als Muslime erkennbar, sichtbar und hörbar in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten, vom alltäglichen Kopftuch bis hin zur Forderung nach dem Bau einer Moschee. Es liegt zum Zweiten an der gegenwärtigen Renaissance des Glaubens in der islamischen Welt und damit auch in der Diaspora. Und schließlich ist es ganz besonders der radikale Islamismus, der den Bürgern säkularer Staaten Sorgen bereitet: ein politischer Islam, der nach der Macht greift, und dies womöglich mit Gewalt, wie es etwa von der Islamischen Revolution im Iran 1979 bis hin zum globalen Terror des Dschihad-Islam ist.
In dieser Arbeit sollen die Grundlagen des Islam in Deutschland beschrieben werden. Besonderes Augenmerk soll hierbei auf die Identitätsfrage der Muslime in der Diaspora gerichtet werden. Persönliche Erfahrungen aus der Begegnung mit Muslimen im Geschäftsleben und im privaten Bereich, sowie die Lektüre von Fachliteratur lassen die folgenden Hypothesen der Arbeit zu: erstens: Islamische Einstellung, dass der Islam nicht in Frage gestellt werden kann, trifft zu, was wiederum bedeutet, dass es noch zu ‚früh’ ist vom Euro-Islam zu sprechen. Zweitens: Islamisch-fundamentalistische Orientierungen existieren aufgrund mangelnder Angebote der Mehrheitsgesellschaft zur Identitätsbildung der Migranten innerhalb der Gesellschaft.
Die dieser Arbeit zugrunde liegende Vorstellung der Diaspora-Situation der Muslime umfasst mehrere Aspekte. Zunächst geht um die Merkmale der muslimischen Diaspora. Dazu werden Fragen zu den religiösen Praktiken zur deren identitätssichernden Bedeutung in der alltäglichen, gemeinschaftlichen Lebensgestaltung untersucht. Im Weiteren konzentriere ich mich auf die Probleme der muslimischen Diaspora, die zu einer Identitätskrise führen. Dementsprechend sind Fragen nach dem radikalen Islamismus zu behandeln.
Inhaltsverzeichnis
1. Einführung
2. Muslimische Diaspora
2.1. Zum Begriff ‚Diaspora’
2.2. Merkmale der muslimischen Diaspora
2.3. Nicht streng religiöse Muslime
3. In Deutschland ‚außerhalb Deutschlands’ leben: Der Islam in der Fremde
3.1. Säkularismus
3.2. Das neue Heimatverständnis
4. Warum Muslime anders sind: Grundlage der muslimischen Identität
4.1. Die Frage der Bedeutung des Muslimseins ausgehend von den islamischen, spezifischen kulturellen Prinzipien
4.2. Die Frage nach einer europäischen islamischen Kultur. Euro-Islam
4.3. Das Kopftuch als Zeichen der Identität muslimischer Frauen
4.3.1. Ist das Kopftuch europäisch?
4.3.2. Das Kopftuch in der Schule
5. Zur Frage der Integration muslimischer Immigranten in Deutschland
5.1. Identitätskrise
5.1.1. Der radikale Islamismus
5.1.2. Lösungsvorschläge
6. Schlussfolgerung
Literatur:
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Muslime leben schätzungsweise in Deutschland?
Die Zahl wird im Text auf etwa 1,5 bis 3,3 Millionen geschätzt, wobei Muslime türkischer Staatsangehörigkeit die größte Gruppe bilden.
Was wird unter dem Begriff 'Muslimische Diaspora' verstanden?
Es beschreibt die Situation von Muslimen, die außerhalb der islamisch geprägten Herkunftsländer leben und dort ihre religiöse und kulturelle Identität bewahren oder neu definieren.
Was ist der 'Euro-Islam'?
Der Euro-Islam bezeichnet das Konzept einer islamischen Kultur, die mit europäischen Werten und dem Säkularismus vereinbar ist.
Welche Rolle spielt das Kopftuch in der Identitätsdebatte?
Das Kopftuch wird als sichtbares Zeichen der Identität muslimischer Frauen und als Streitpunkt im Kontext von Integration und Schule analysiert.
Welche Ursachen werden für radikalen Islamismus in der Diaspora genannt?
Die Arbeit stellt die Hypothese auf, dass mangelnde Angebote der Mehrheitsgesellschaft zur Identitätsbildung zur Hinwendung zu fundamentalistischen Orientierungen beitragen können.
- Arbeit zitieren
- Magister Artium Irina Petrova (Autor:in), 2006, Identität und Integration der Muslime in der Diaspora, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/211836