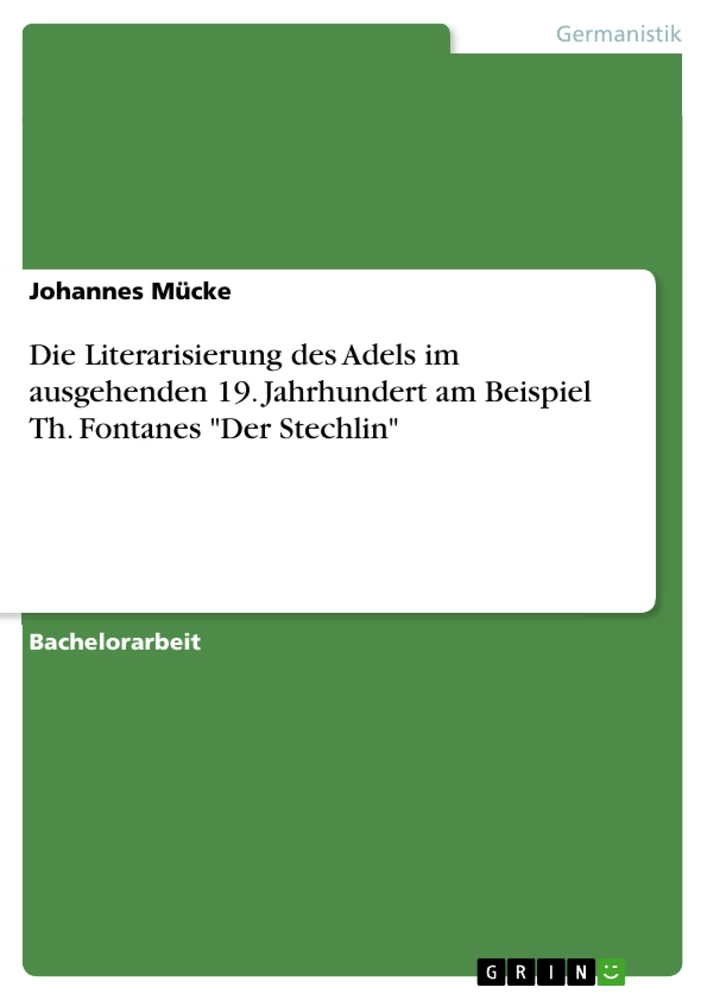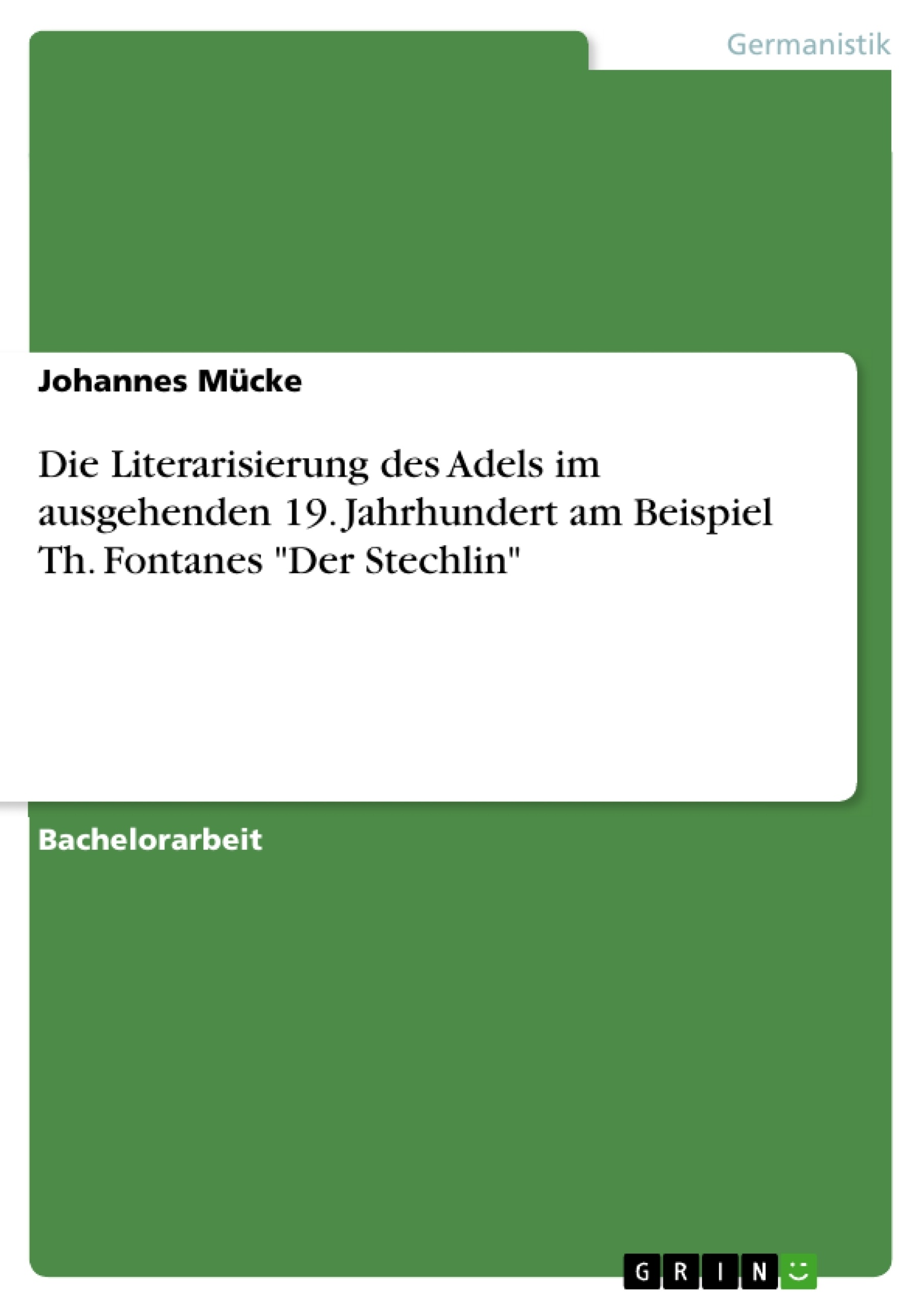Zum Schluß stirbt ein Alter und zwei Junge heiraten sich; – das ist so ziemlich alles, was auf 500 Seiten geschieht. Von Verwicklungen und Lösungen, von Herzenskonflikten oder Konflikten überhaupt, von Spannungen und Überraschungen findet sich nichts. (Brief an Adolf Hofmann vom Mai/Juni 1897)
Dieser Brief Fontanes an den Verleger der Zeitung Über Land und Meer, Adolf Hoffmann, bezüglich seines letzten Romans Der Stechlin macht deutlich, dass der Roman von einer gewissen Handlungsarmut geprägt ist. Interessant ist dennoch, dass Der Stechlin trotz dieser geringen Handlung keineswegs als ennuyant deklariert werden darf; die zahlreichen Dialoge, die hauptsächlich den Konflikt zwischen dem Alten und dem Neuen, der Tradition und der Moderne behandeln, verleihen dem Roman seine Einzigartigkeit und die Möglichkeit der vielseitigen Deutung. Die Thematisierung des gesellschaftlichen Lebens der Mark Brandenburg und Berlins sowie die politischen Gegebenheiten im ausgehenden 19. Jahrhundert machen den Stechlin zu einem „politischen Roman“2, der die „Gegenüberstellung von Adel, wie er […] sein sollte und wie er ist“3 beinhaltet. Fontane erkennt die Defizite seiner Zeit und berücksichtigt diese in der literarischen Darstellung des Stechlin. Diese wirklichkeitsgetreue Präsentation, im Besonderen die Darlegung der Schwächen des Adels, ist zweifelsohne im Sinne des Realismus.4
Im Folgenden soll nun untersucht werden, inwiefern der Adel im ausgehenden 19. Jahrhundert dargestellt wird. Unterliegt er der permanenten Kritik des Autors oder erfolgt ebenso eine Hervorhebung der Kompetenzen desselben? Ist der Stechlin ein Roman, der das Ende des Adels beschreibt und diesem faktisch im 20. Jahrhundert keine bedeutende Position mehr zuteilt? Ebenso ist von Interesse, in welcher Weise die etwaige zukünftige Rolle des Adels in der Gesellschaft und Politik im 20. Jahrhundert seitens des Autors realisiert würde. Beginnend soll der historische Kontext dargelegt werden, um anschließend die Präsentation des Adels im Roman sowie die Funktion desselben in der Politik und der Gesellschaft analysieren zu können.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Historischer Kontext
2.1 Die politischen Entwicklungen im Deutschen Kaiserreich
2.2 Die Gesellschaft im Deutschen Kaiserreich
3. Der Adel im Roman
3.1 Niederadel
3.1.1 Dubslav von Stechlin
3.1.2 Domina Adelheid von Stechlin
3.1.3 Rittmeister Woldemar von Stechlin
3.1.4 Sägemühlenbesitzer Gundermann
3.2 Hochadel
3.2.1 Graf Barby
3.2.2 Gräfin Melusine Barby
3.2.3 Comtesse Armgard Barby
4. Der Adel und die Politik
4.1 Die Wahl in Rheinsberg-Wutz
4.2 Die Rolle der Sozialdemokratie
4.3 Die Thematik der Revolution
5. Fontanes Einstellungen zum Adel
6. Abschließende Betrachtung
A Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema von Fontanes Roman „Der Stechlin“?
Der Roman thematisiert den Konflikt zwischen Tradition und Moderne sowie den Zustand des preußischen Adels im ausgehenden 19. Jahrhundert.
Warum wird „Der Stechlin“ als handlungsarm beschrieben?
Fontane selbst bemerkte, dass auf 500 Seiten kaum etwas geschieht außer dem Tod eines Alten und der Hochzeit zweier Jungen; der Fokus liegt stattdessen auf den Dialogen.
Welche Kritik übt Fontane am Adel?
Er stellt die Defizite und Schwächen des Adels wirklichkeitsgetreu dar, zeigt aber auch die Kompetenzen und die menschliche Wärme von Figuren wie Dubslav von Stechlin.
Welche Rolle spielt die Politik im Roman?
Der Roman behandelt politische Gegebenheiten wie die Wahlen in Rheinsberg-Wutz und das Aufkommen der Sozialdemokratie im Deutschen Kaiserreich.
Beschreibt der Roman das Ende des Adels?
Die Arbeit untersucht, ob Fontane dem Adel im 20. Jahrhundert noch eine bedeutende Rolle zuschreibt oder ob er dessen faktischen Niedergang literarisch vorwegnimmt.
- Quote paper
- Johannes Mücke (Author), 2012, Die Literarisierung des Adels im ausgehenden 19. Jahrhundert am Beispiel Th. Fontanes "Der Stechlin", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/211904