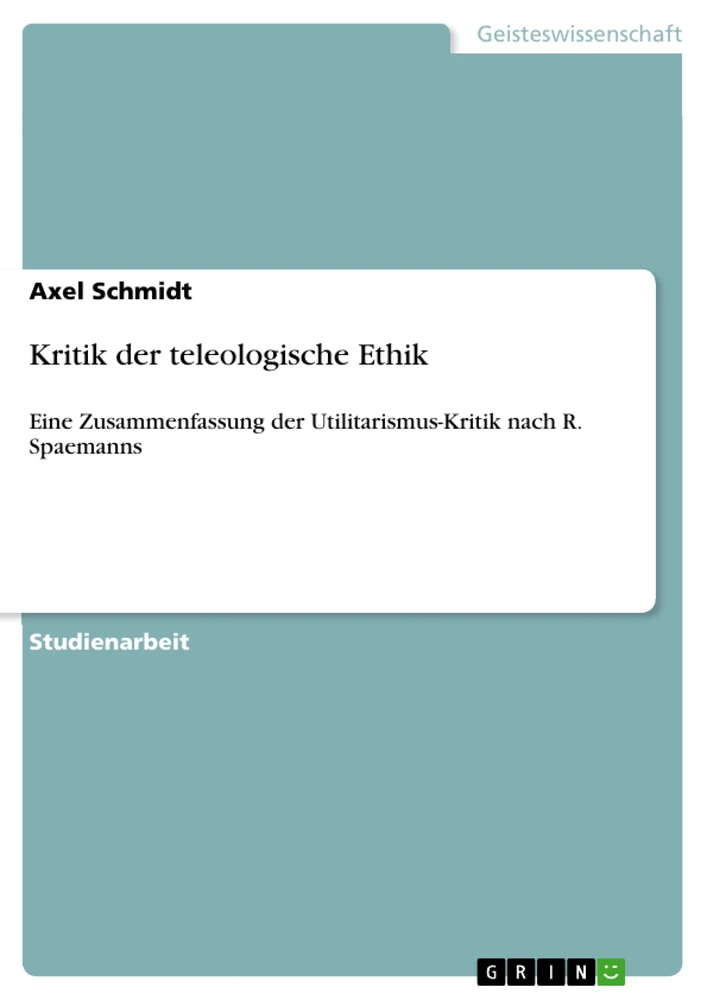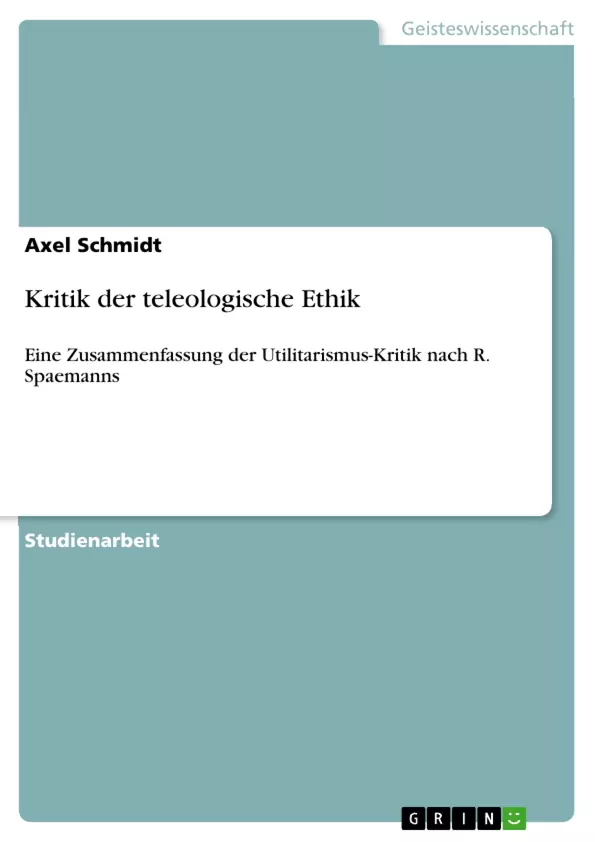Es geht hier um die Frage, ob die ethische Beurteilung von Handlungen sich allein an deren Folgen zu orientieren hat oder nicht. Ist zum Beispiel eine Falschaussage nur dann eine Lüge (d.h. ungerechtfertigt), wenn ihre Folge der Täuschung die einzig ethisch relevante ist, nicht aber, wenn eine ihrer Folgen z.B. die Verhinderung eines großen Ärgernisses oder gar die Rettung eines Menschen¬lebens ist?
Ethische Theorien sind so etwas wie die wissenschaftliche Rekonstruktion des sittlichen Bewusstseins.
Zur Präzisierung der Fragestellung trägt die sinnvolle Einteilung ethischer Theorien in Klassen bei. Eine solche Klasseneinteilung nimmt die Zuweisung ethischer Theorien zum deontologischen oder teleologischen Typus vor: aufgrund stipulativer Definition gewinnt man so ein kontradiktorisches Gegensatzpaar, so dass „deontologisch“ nichts anderes heißt als „nicht-teleologisch“.
Eine Kritik teleologischer Ethik ist somit zugleich eine prima-facie-Begründung deontologischer Ethik. Gleichwohl kann es sein, dass beide Typen normativer Ethik ihre Schwierigkeiten haben, die bisher noch nicht gelöst sind. Es soll darum in dieser Arbeit nicht die doppelte Aufgabe der Kritik der Teleologie und positiven Rechtfertigung der Deontologie geleistet werden. Obwohl definitionsgemäß nur eine der beiden Spielarten normativer Ethik richtig sein kann – sofern man überhaupt davon ausgeht, dass ethische Sätze wahrheitsfähig sind –, muss doch davon abgesehen werden, ein endgültiges Urteil über wahr und falsch zu fällen, solange man noch sinnvoll annehmen kann, gewisse Schwierigkeiten ließen sich mit der Zeit noch lösen.
Der Blick wird hier also ganz auf die Schwierigkeiten teleologischer Ethik gelenkt. Dabei wird sich herausstellen, dass die nominal definitorische Festlegung der Bedeutung von „teleologisch“ ihre Schwierigkeiten hat. Es ist darum eine These dieser Arbeit, dass Unklarheiten über den Begriff von „Teleologie“ ihre Abgrenzung von Deontologie zum Teil verwischen. Aber auch diese Frage kann nicht vollständig erörtert werden; insbesondere das Problem einer folgen-unabhängigen sittlichen Bewertung von Handlungen (in der sog. „harten“ Deontologie) kann nur andeutungsweise aufgegriffen werden.
Der umfangreichere zweite Teil ist folgt im wesentlichen den Ausführungen R. Spaemanns. Wichtige Argumente, die Spaemann gegen eine teleologische Ethik vorbringt, werden referiert und beurteilt.
Ein eigenes Problem stellt die Bedeutung der Ausdruckshandlung dar.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- EINLEITUNG
- Teil A: Klärung einiger terminologischer Vorfragen.
- 1. Mögliche Missverständnisse in der Terminologie.
- 2. Verschiedene Bedeutungen von „teleologisch“.
- Teil B: Diskussion der wichtigsten Einwände gegen eine teleologische Ethik.
- 1. Zur Frage der Beweislast in ethischer Argumentation.
- 2. Fünf Einwände Spaemanns gegen eine teleologische Ethik
- 2.1. Vorwurf der Inkohärenz
- 2.2. Vorwurf der Undurchführbarkeit.
- 2.3. Vorwurf der Reduktion in Technizismus.
- 2.4. Vorwurf der Unvollständigkeit.
- 2.5. Vorwurf der gleichzeitigen Unter- und Überforderung.
- 3. Die Berufung auf den Regelutilitarismus.
- 4. Die Ausdruckshandlung im Rahmen einer teleologischen Ethik.
- 5. Das Problem des Unterschiedes von Handeln und Unterlassen.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Kritik an der teleologischen Ethik, insbesondere die Argumente von R. Spaemann, und beleuchtet die Frage, ob die ethische Bewertung von Handlungen sich allein an deren Folgen orientieren sollte.
- Kritik an der Teleologie
- Bedeutung der Folgen in der ethischen Beurteilung
- Deontologische vs. Teleologische Ethik
- Spaemanns Argumentation gegen den Utilitarismus
- Bedeutung der Ausdruckshandlung
Zusammenfassung der Kapitel
- Vorwort: Einleitung in die Arbeit und Bezug auf die Seminararbeit „Einführung in die Moraltheologie: Ethische Normierungstheorien“ im Wintersemester 1984/85.
- EINLEITUNG: Darstellung der Fragestellung und Klärung der Begriffe „teleologisch“ und „deontologisch“ im Kontext der ethischen Diskussion.
- Teil A: Klärung einiger terminologischer Vorfragen.: Analyse der Begriffsdefinitionen von „teleologisch“ und mögliche Missverständnisse in der Terminologie.
- Teil B: Diskussion der wichtigsten Einwände gegen eine teleologische Ethik: Auseinandersetzung mit Spaemanns Kritik an der teleologischen Ethik, einschließlich seiner fünf Einwände: Inkohärenz, Undurchführbarkeit, Reduktion in Technizismus, Unvollständigkeit und gleichzeitige Unter- und Überforderung.
- 3. Die Berufung auf den Regelutilitarismus: Untersuchung der Gegenargumente, die sich auf den Regelutilitarismus berufen.
- 4. Die Ausdruckshandlung im Rahmen einer teleologischen Ethik: Betrachtung der Bedeutung der Ausdruckshandlung im Kontext der teleologischen Ethik.
- 5. Das Problem des Unterschiedes von Handeln und Unterlassen: Kurze Erörterung des Problems der Unterscheidung von Tun und Unterlassen in einer ethischen Theorie.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die teleologische Ethik, insbesondere auf die Kritik von R. Spaemann. Wichtige Schlüsselbegriffe sind deontologische Ethik, Utilitarismus, Folgenethik, Handlungsethik, Ausdruckshandlung, Beweislast und die Unterscheidung zwischen Handeln und Unterlassen.
- Quote paper
- Dr. Axel Schmidt (Author), 1985, Kritik der teleologische Ethik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/212309