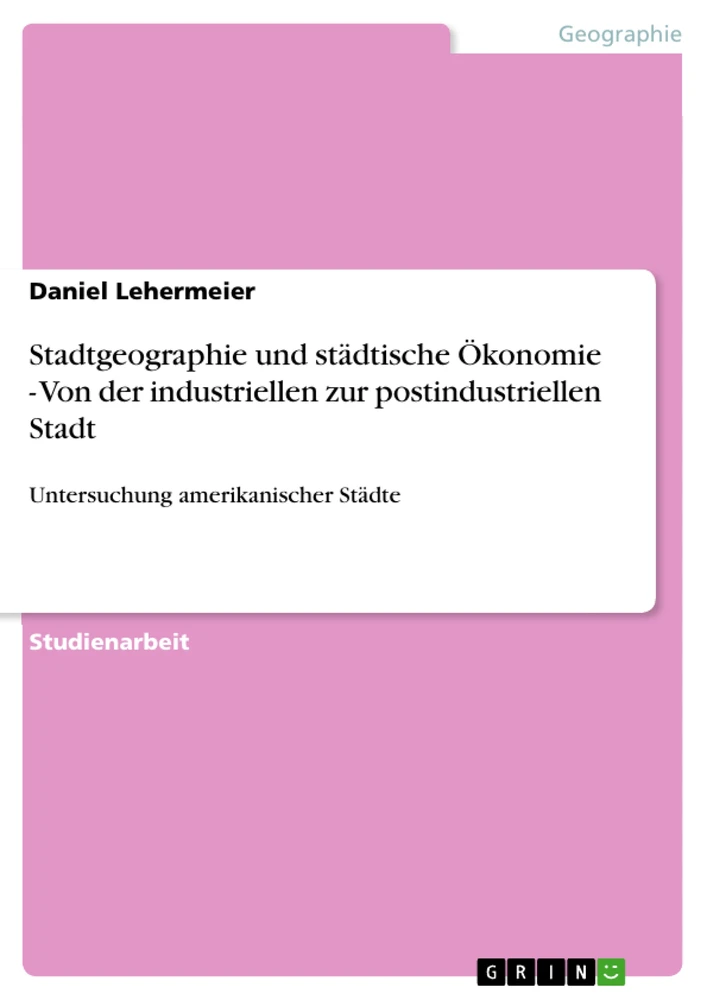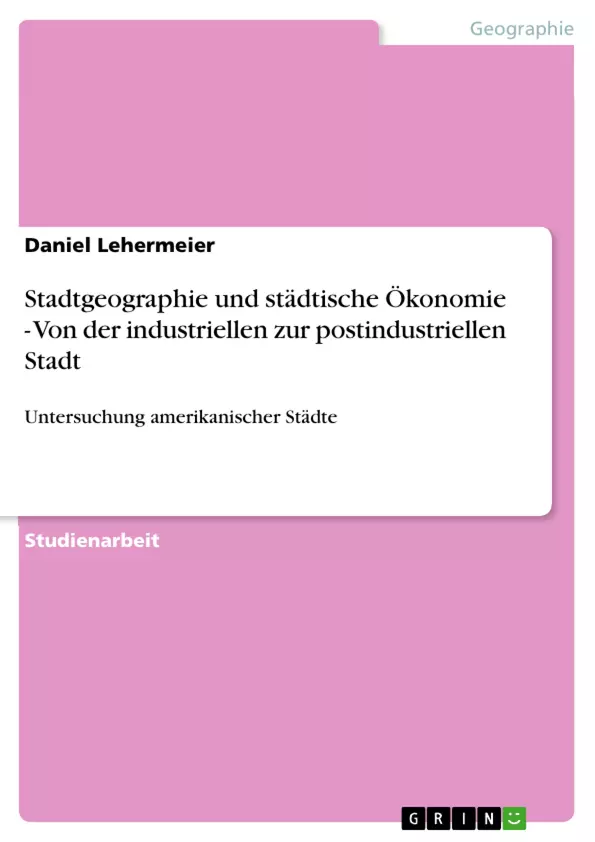Die gegenwärtige Umbruchsphase in unserer postmodernen, globalisierten Zeit – Wörter die heutzutage nahezu inflationär benutzt werden – ist mit einer Neuordnung räumlicher Gefüge und städtischer Hierarchien verbunden. Dazu gehört die Verschiebung von Industrie- und Wachstumszentren im weltweiten Maßstab. Früher bedeutende industrielle Zentren wirtschaftlichen Wachstums und stabiler Beschäftigung sind heute oft von industriellem Niedergang, also der Deindustrialisierung bestimmt. Die betroffenen Städte sind mit einer anhaltend hohen Arbeitslosigkeit, sinkenden Bevölkerungszahlen, brachliegenden Industrieflächen und einer verschärften Finanznot konfrontiert. Dem entgegengesetzt profitieren andere Stadtregionen von einer räumlich selektiven Konzentration der Wachstumspotentiale des modernen Kapitalismus (Krätke: 1995, S. 7).
Auf diese nur scheinbar ungeordneten und anarchischen Ansammlungen von Wachstumspolen neben aufgegebenen Quartieren in der Stadt, wie sie die Schule von Los Angeles beschreibt, soll in der Arbeit näher eingegangen werden. Außerdem werden auch die (globalen) Restrukturierungsprozesse im Städtesystem erklärt. Diese sind vor allem, neben der bereits erwähnten Deindustrialisierung, die Flexibilisierung von Produktion und Arbeit, sowie die Polarisierung im Arbeitsmarkt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Kennzeichen der Ökonomie in der industriellen Stadt
- 3. Wandel der Ökonomie – Probleme in der Stadt
- 3.1 Deindustrialisierung
- 3.2 Deregulierung
- 3.3 Flexibilisierung und Globalisierung
- 3.4 Entstehung neuer städtischer Ökonomien
- 3.5 Schlussfolgerung für die städtische Struktur
- 4. Sozialökonomische Spaltungen im Innern der Städte
- 4.1 Segmentierung der Stadt
- 4.2 Polarisierung des Arbeitsmarktes
- 4.3 Auf dem Weg zu einer vielfach geteilten Stadt
- 4.4 Die Ökonomie in „aufgegebenen“ Stadtquartieren
- 4.5 Zusammenfassende Bemerkung zur Spaltung
- 5. Transformationsprozesse der postmodernen Stadt
- 5.1 Von Chicago nach Los Angeles: Trendsetter USA?
- 5.2 Ökonomische Restrukturierung der Region von Los Angeles
- 5.3 Der postmoderne urbanisierte Raum
- 5.4 Alternatives Model der urbanen Struktur
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Wandel der städtischen Ökonomie vom industriellen zum postindustriellen Zeitalter. Sie analysiert die Herausforderungen, die sich durch diesen Wandel für Städte ergeben, und beleuchtet die damit verbundenen räumlichen und sozialökonomischen Veränderungen.
- Deindustrialisierung und ihre Folgen für städtische Strukturen
- Flexibilisierung und Globalisierung der Wirtschaft und deren Auswirkungen auf Städte
- Sozialökonomische Spaltungen und Segmentierung in postindustriellen Städten
- Transformationsprozesse in postmodernen Städten und alternative Stadtmodelle
- Räumliche Konzentration von Wachstumspotentialen neben vernachlässigten Stadtteilen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einführung beschreibt den tiefgreifenden Umbruch in der postmodernen, globalisierten Welt und die damit verbundene Neuordnung räumlicher Gefüge und städtischer Hierarchien. Sie hebt die Verschiebung von Industrie- und Wachstumszentren hervor und zeigt den Kontrast zwischen ehemals bedeutenden Industriezentren, die heute von Deindustrialisierung und Arbeitslosigkeit geprägt sind, und anderen Stadtregionen, die von der selektiven Konzentration von Wachstumspotenzialen profitieren. Die Arbeit fokussiert auf die scheinbar ungeordneten Ansammlungen von Wachstumspolen neben vernachlässigten Stadtteilen, wie sie beispielsweise in Los Angeles zu beobachten sind, und erklärt die globalen Restrukturierungsprozesse im Städtesystem, die neben der Deindustrialisierung die Flexibilisierung von Produktion und Arbeit sowie die Polarisierung des Arbeitsmarktes beinhalten.
2. Kennzeichen der Ökonomie in der industriellen Stadt: Dieses Kapitel beschreibt die industrielle Stadt als Integrationsmaschine, die trotz sozialer Ungleichheiten und Marginalisierung bestimmter Bevölkerungsgruppen auf ökonomische Integration ausgerichtet war. Der industrielle Arbeitsmarkt stellte die Integrationsfunktion sicher, indem er Arbeitskräfte, auch wenn sie ausgebeutet wurden, dennoch benötigte. Im Gegensatz dazu steht die postindustrielle Stadt, in der große Teile der Bevölkerung überflüssig geworden sind. Das Kapitel erklärt auch das Leitbild der zonierten Stadt als Begleiterscheinung der zunehmenden Industrialisierung und des Fordismus, mit seinen Merkmalen der industriellen Massenproduktion und der produktionsbasierten Wirtschaft. Der Arbeiter wurde als Konsument entdeckt, was auch die Stadtentwicklung beeinflusste, die sich auf die Ausweitung von Wohn- und Gewerbeflächen konzentrierte. Dies wird im Kontrast zu postfordistischen Stadtmodellen, wie dem des Keno-Kapitalismus, dargestellt.
3. Wandel der Ökonomie - Probleme in der Stadt: Dieses Kapitel betont die internationale Dimension der Stadtentwicklung und die Beeinflussung städtischer Entwicklungen durch die Stellung in der Weltökonomie. Es erklärt, dass die Prozesse, die Städte formen, oft weit über deren Grenzen hinaus liegen. Die zunehmende Bedeutung des internationalen Wettbewerbs und die wachsende Einflussnahme internationaler Organisationen werden als Faktoren der Stadtentwicklung im Kontext der Postmoderne hervorgehoben. Die Wechselwirkung ökonomischer, ökologischer und gesellschaftlicher Entwicklungen wird unterstrichen. Das Kapitel fokussiert sich auf die ökonomischen Entwicklungsprozesse wie Deindustrialisierung und Flexibilisierung.
3.1 Deindustrialisierung: Der Unterabschnitt 3.1, Deindustrialisierung, beschreibt den Übergang vom ausgeprägten Industrialisierungsprozess mit fordistischen Produktionsweisen im Westen Mitte der 70er Jahre. Der Dienstleistungssektor löste die Industrie als Wachstumsführer ab, und die Bedeutung der Industrie für die Beschäftigung nahm ab. Der Wandel bewirkte tiefgreifende Strukturveränderungen in den Städten, mit Verlagerungen und Schließungen von Unternehmen, ohne adäquate Ersatz durch Arbeitsplätze im tertiären Sektor. Anhand von Daten aus dem Vereinigten Königreich und Nordamerika wird der Rückgang der Beschäftigung im sekundären Sektor und der Anstieg im Dienstleistungssektor veranschaulicht, was den Wandel der Beschäftigungsstruktur als Folge der Deindustrialisierung aufzeigt.
4. Sozialökonomische Spaltungen im Innern der Städte: Dieses Kapitel befasst sich mit den sozialökonomischen Spaltungen innerhalb der Städte, die durch den Wandel der Ökonomie verstärkt wurden. Es analysiert die Segmentierung der Stadt in verschiedene Bereiche mit unterschiedlichen ökonomischen und sozialen Bedingungen, die Polarisierung des Arbeitsmarktes und den Prozess, der zu einer mehrfach geteilten Stadt führt. Ein Schwerpunkt liegt auf der wirtschaftlichen Situation in „aufgegebenen“ Stadtquartieren und der zusammenfassenden Betrachtung der Spaltungsphänomene.
5. Transformationsprozesse der postmodernen Stadt: Dieses Kapitel analysiert die Transformationsprozesse in der postmodernen Stadt, indem es den Vergleich zwischen dem traditionellen Modell der zonierten Stadt (Chicago) und dem dezentralisierten Modell von Los Angeles zieht. Es beschreibt die ökonomische Restrukturierung der Region Los Angeles als Beispiel für die neuen urbanen Strukturen und untersucht den postmodernen urbanisierten Raum mit seinen Charakteristika. Weiterhin stellt es ein alternatives Modell der urbanen Struktur vor, welches die zufälligen Ergebnisse kapitalistischer Prozesse berücksichtigt.
Schlüsselwörter
Deindustrialisierung, Postindustrielle Stadt, Globalisierung, Flexibilisierung, Sozialökonomische Spaltungen, Stadtentwicklung, Transformationsprozesse, Postmoderne Stadt, Regionale Ökonomie, Arbeitsmarkt, Agglomerationen.
Häufig gestellte Fragen zum Text über den Wandel der städtischen Ökonomie
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text analysiert den Wandel der städtischen Ökonomie vom industriellen zum postindustriellen Zeitalter. Er untersucht die Herausforderungen, die sich durch diesen Wandel für Städte ergeben, und beleuchtet die damit verbundenen räumlichen und sozialökonomischen Veränderungen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von der industriellen Stadt zur postmodernen, globalisierten Stadt und den damit einhergehenden Transformationsprozessen.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt folgende zentrale Themen: Deindustrialisierung und ihre Folgen für städtische Strukturen; Flexibilisierung und Globalisierung der Wirtschaft und deren Auswirkungen auf Städte; sozialökonomische Spaltungen und Segmentierung in postindustriellen Städten; Transformationsprozesse in postmodernen Städten und alternative Stadtmodelle; räumliche Konzentration von Wachstumspotenzialen neben vernachlässigten Stadtteilen.
Wie ist der Text aufgebaut?
Der Text ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einführung und endend mit einem Fazit. Die Kapitel behandeln die Kennzeichen der Ökonomie in der industriellen Stadt, den Wandel der Ökonomie mit Fokus auf Deindustrialisierung, Flexibilisierung und Globalisierung, die daraus resultierenden sozialökonomischen Spaltungen innerhalb der Städte und schließlich die Transformationsprozesse in postmodernen Städten am Beispiel Los Angeles im Vergleich zu Chicago. Jedes Kapitel wird zusammengefasst und Schlüsselwörter werden am Ende genannt.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse des Textes?
Der Text zeigt auf, dass der Wandel von der industriellen zur postindustriellen Stadt tiefgreifende räumliche und sozialökonomische Veränderungen mit sich bringt. Die Deindustrialisierung, die Flexibilisierung und die Globalisierung führen zu einer Segmentierung der Städte, einer Polarisierung des Arbeitsmarktes und zu einer Konzentration von Wachstumspotenzialen in bestimmten Stadtteilen, während andere vernachlässigt werden. Der Vergleich zwischen dem traditionellen Stadtmodell (Chicago) und dem dezentralisierten Modell (Los Angeles) verdeutlicht diese Entwicklungen. Der Text argumentiert, dass die Prozesse, die Städte formen, oft weit über deren Grenzen hinaus liegen und von internationalen Wettbewerbs- und Organisationsstrukturen beeinflusst werden.
Welche Rolle spielen Deindustrialisierung und Globalisierung?
Deindustrialisierung und Globalisierung sind zentrale Treiber des Wandels der städtischen Ökonomie. Die Deindustrialisierung führte zum Verlust von Arbeitsplätzen im Industriesektor und zu Strukturveränderungen in den Städten. Die Globalisierung verstärkt den internationalen Wettbewerb und beeinflusst die räumliche Verteilung von Wirtschaftsaktivitäten. Beide Prozesse tragen zur Flexibilisierung der Produktion und des Arbeitsmarktes bei und verstärken die sozialökonomischen Spaltungen innerhalb der Städte.
Wie werden sozialökonomische Spaltungen beschrieben?
Der Text beschreibt die Entstehung sozialökonomischer Spaltungen als Folge des Wandels der städtischen Ökonomie. Die Segmentierung der Stadt in verschiedene Bereiche mit unterschiedlichen ökonomischen und sozialen Bedingungen, die Polarisierung des Arbeitsmarktes und die Entstehung von „aufgegebenen“ Stadtquartieren sind zentrale Aspekte dieser Spaltungen. Diese Entwicklungen führen zu einer mehrfach geteilten Stadt mit großen Unterschieden in Wohlstand und Lebensqualität zwischen verschiedenen Stadtteilen.
Welches Beispiel wird zur Veranschaulichung der Transformationsprozesse verwendet?
Der Text verwendet den Vergleich zwischen Chicago als Beispiel für die traditionelle, zonierte industrielle Stadt und Los Angeles als Beispiel für eine dezentralisierte postmoderne Stadt, um die Transformationsprozesse zu veranschaulichen. Die ökonomische Restrukturierung der Region Los Angeles zeigt die neuen urbanen Strukturen und die zufälligen Ergebnisse kapitalistischer Prozesse auf, die zu einer räumlichen Konzentration von Wachstumspotenzialen neben vernachlässigten Stadtteilen führen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter, die den Inhalt des Textes prägnant zusammenfassen, sind: Deindustrialisierung, Postindustrielle Stadt, Globalisierung, Flexibilisierung, Sozialökonomische Spaltungen, Stadtentwicklung, Transformationsprozesse, Postmoderne Stadt, Regionale Ökonomie, Arbeitsmarkt, Agglomerationen.
- Quote paper
- M.A. Daniel Lehermeier (Author), 2006, Stadtgeographie und städtische Ökonomie - Von der industriellen zur postindustriellen Stadt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/212333