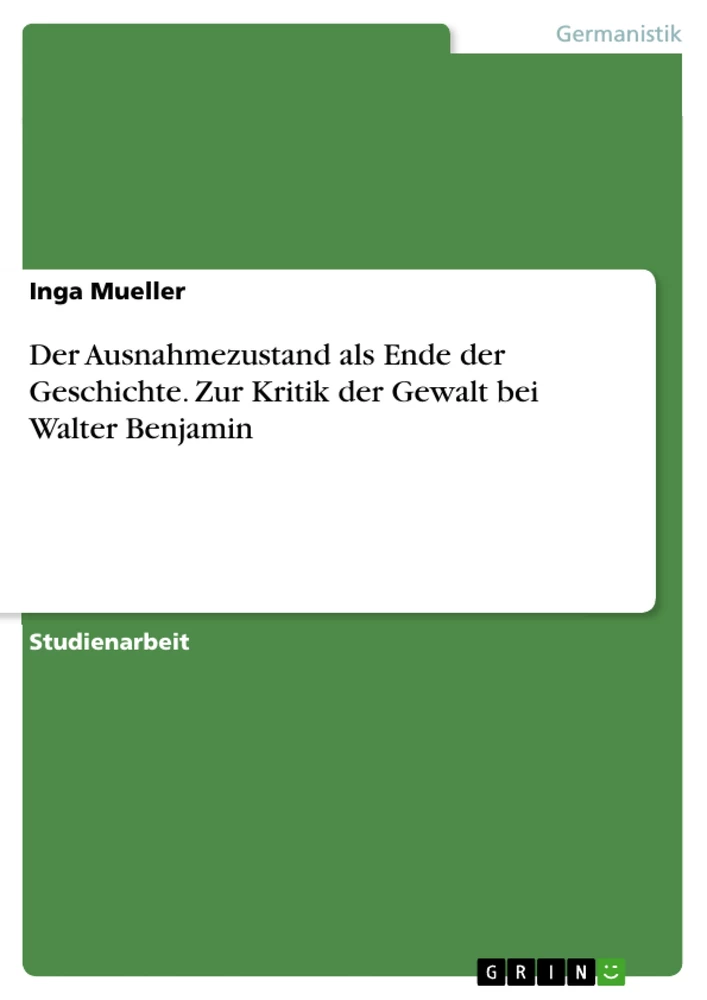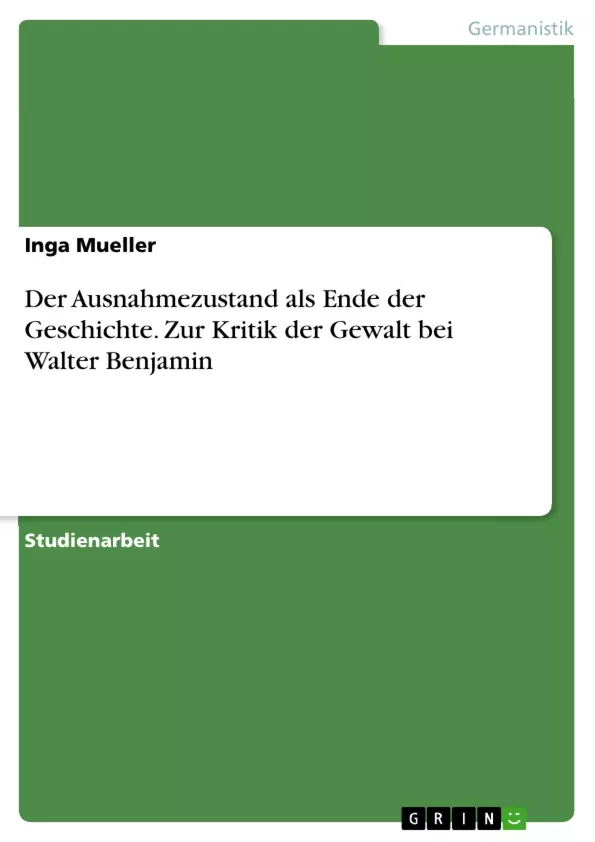Bei der Auseinandersetzung mit dem zwischen 1920 und 1921 erschienenen Aufsatz "Zur Kritik der Gewalt" von Walter Benjamin soll erarbeitet werden, welche gesellschaftlichen Umstände zum Ende der Rechtsordnung führen können, um die Metaphysik einer neuen Geschichtsphilosphie begründen zu können.
Die Zugehörigkeit zur Frankfurter Schule lässt sich nicht klären. Es wird allerdings schon bei Lektüre des Autors deutlich, dass man ihn der Aufklärung zuschreiben kann. In seinem Kritik- Aufsatz verweist er an mehreren Stellen auf den kategorischen Imperativ, er benennt Darwins Evolutionstheorie und argumentiert mit Sorel. Benjamin war ausserdem gut mit Adorno und Horkheimer befreundet. Adorno ist für die Publikation von Benjamins Schriften nach seinem Tod verantwortlich.
Sein Werk soll nicht als wissenschaftliche Auseinandersetzung oder Rezension verstanden werden, sondern die Kritik steht im Zentrum seines Selbstverständnisses und seiner philosophischen Praxis.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kritikbegriff bei Benjamin
- Zur Kritik der Gewalt bei Walter Benjamin
- Naturrecht und Positives Recht
- Arten von Gewalt im Recht
- rechtsetzende Gewalt
- rechtserhaltende Gewalt
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Walter Benjamins Aufsatz „Zur Kritik der Gewalt" und untersucht, wie gesellschaftliche Umstände zum Ende der Rechtsordnung führen können, um die Metaphysik einer neuen Geschichtsphilosophie zu begründen. Der Fokus liegt dabei auf dem „Ausnahmezustand" und der Rolle des revolutionären Generalstreiks. Die Arbeit erörtert die Positionen des Naturrechts und des Positivismus und untersucht, wie Benjamin die verschiedenen Arten von Gewalt im Recht differenziert.
- Die Rolle des „Ausnahmezustands" in der Geschichte und seine Bedeutung für Benjamins Kritik der Gewalt
- Die Unterscheidung zwischen Naturrecht und Positivem Recht und deren Einfluss auf die Anwendung von Gewalt
- Die verschiedenen Arten von Gewalt im Recht: rechtsetzende und rechtserhaltende Gewalt
- Die Frage nach der Legitimität von Gewalt und ihre Verbindung zur Moral und Gerechtigkeit
- Die Grenzen der Rechtsordnung und die Möglichkeit einer „apokalyptischen Legitimierung gewaltvoller Dezision" im Sinne Benjamins
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Aufsatz „Zur Kritik der Gewalt" von Walter Benjamin vor und erläutert den Kontext der Arbeit. Sie beleuchtet die Rolle des „Ausnahmezustands" in der Geschichte und die Bedeutung des revolutionären Generalstreiks für Benjamins Argumentation. Sie führt zudem die wichtigsten Themenfelder des Aufsatzes ein, darunter die Unterscheidung zwischen Naturrecht und Positivem Recht sowie die Analyse der verschiedenen Arten von Gewalt im Recht.
Der Abschnitt „Kritikbegriff bei Benjamin" beleuchtet Benjamins philosophische Position und seine Zugehörigkeit zur Frankfurter Schule. Er zeigt, wie Benjamin den Begriff der Kritik verwendet und wie er sich in seiner Argumentation auf die Aufklärung und den kategorischen Imperativ bezieht.
Im Kapitel „Zur Kritik der Gewalt bei Walter Benjamin" wird Benjamins Kritik der Gewalt im Detail betrachtet. Er betont die Bedeutung von Recht und Gerechtigkeit für die Anwendung von Gewalt und untersucht, wie die Gewalt in sittliche Verhältnisse eingreift.
Der Abschnitt „Naturrecht und Positives Recht" analysiert die beiden Traditionen des Rechts mithilfe des Zweck-Mittel-Schemas. Benjamin vergleicht das Naturrecht, das auf die Gerechtigkeit der Zwecke abzielt, mit dem Positiven Recht, das sich auf die Berechtigung der Mittel konzentriert. Er untersucht die Rolle der Gewalt in beiden Rechtstraditionen und zeigt, wie Benjamin die Gewalt als ein historisches Phänomen betrachtet, das durch die Rechtsordnung nicht unterdrückt, aber sanktioniert werden kann.
Das Kapitel „Arten von Gewalt im Recht" beschäftigt sich mit der Unterscheidung zwischen rechtsetzender und rechtserhaltender Gewalt. Benjamin argumentiert, dass die Anwendung von Gewalt im Recht dem Bereich der Mittel zugeordnet werden kann und dass sich die Mittel zur Erhaltung des Rechtsstaates in sanktionierte und nicht-sanktionierte Mittel differenzieren lassen. Er untersucht die Rolle der Gewalt in der Gesellschaft und die Bedeutung der sittlichen Umgangsformen für die soziale Ordnung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Kritik der Gewalt, Walter Benjamin, Naturrecht, Positives Recht, Ausnahmezustand, revolutionärer Generalstreik, Rechtsetzende Gewalt, Rechtserhaltende Gewalt, Sittlichkeit, Gerechtigkeit, Moral, Geschichte, Geschichtsphilosophie, Frankfurter Schule, Aufklärung, kategorischer Imperativ, Darwin, Sorel.
Häufig gestellte Fragen zu Walter Benjamins "Kritik der Gewalt"
Was ist der Kern von Walter Benjamins Aufsatz "Zur Kritik der Gewalt"?
Benjamin untersucht das Verhältnis von Gewalt, Recht und Gerechtigkeit. Er fragt nach der Legitimität von Gewalt außerhalb staatlicher Sanktionierung und analysiert, wie Gewalt Rechtsordnungen sowohl begründet als auch erhält.
Was unterscheidet rechtsetzende von rechtserhaltender Gewalt?
Rechtsetzende Gewalt ist die ursprüngliche Gewalt, die eine neue Rechtsordnung schafft (z. B. durch Revolution). Rechtserhaltende Gewalt ist die Gewalt des Staates (z. B. Polizei), die das bestehende Recht schützt.
Wie definiert Benjamin das Naturrecht im Vergleich zum Positiven Recht?
Das Naturrecht beurteilt Gewalt nach der Gerechtigkeit der Zwecke (Gewalt als Naturprodukt). Das Positive Recht beurteilt Gewalt nach der Berechtigung der Mittel (Gewalt als historisches Produkt).
Was bedeutet der "Ausnahmezustand" in Benjamins Werk?
Der Ausnahmezustand beschreibt eine Situation, in der die normale Rechtsordnung suspendiert ist. Benjamin sieht darin die Möglichkeit, die Kontinuität der Geschichte zu durchbrechen und eine neue Metaphysik der Geschichte zu begründen.
Welche Rolle spielt der revolutionäre Generalstreik?
Benjamin unterscheidet mit Sorel den politischen Streik (der das Recht ändern will) vom proletarischen Generalstreik, der die staatliche Gewalt als solche vernichten und eine gewaltfreie Ordnung herbeiführen will.
- Arbeit zitieren
- Inga Mueller (Autor:in), 2013, Der Ausnahmezustand als Ende der Geschichte. Zur Kritik der Gewalt bei Walter Benjamin, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/212475