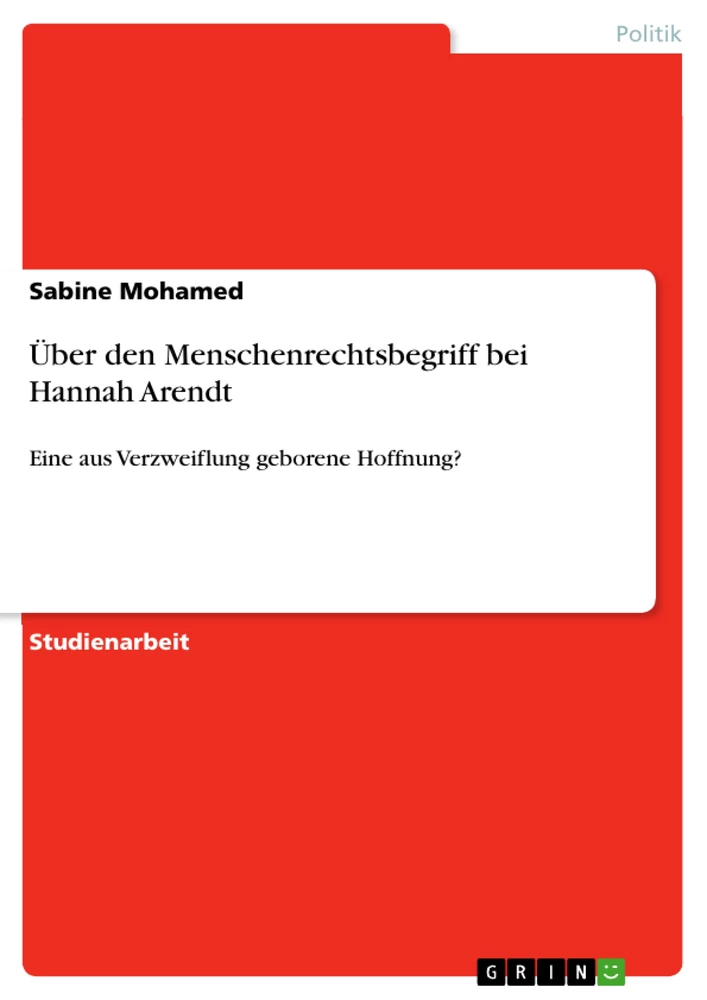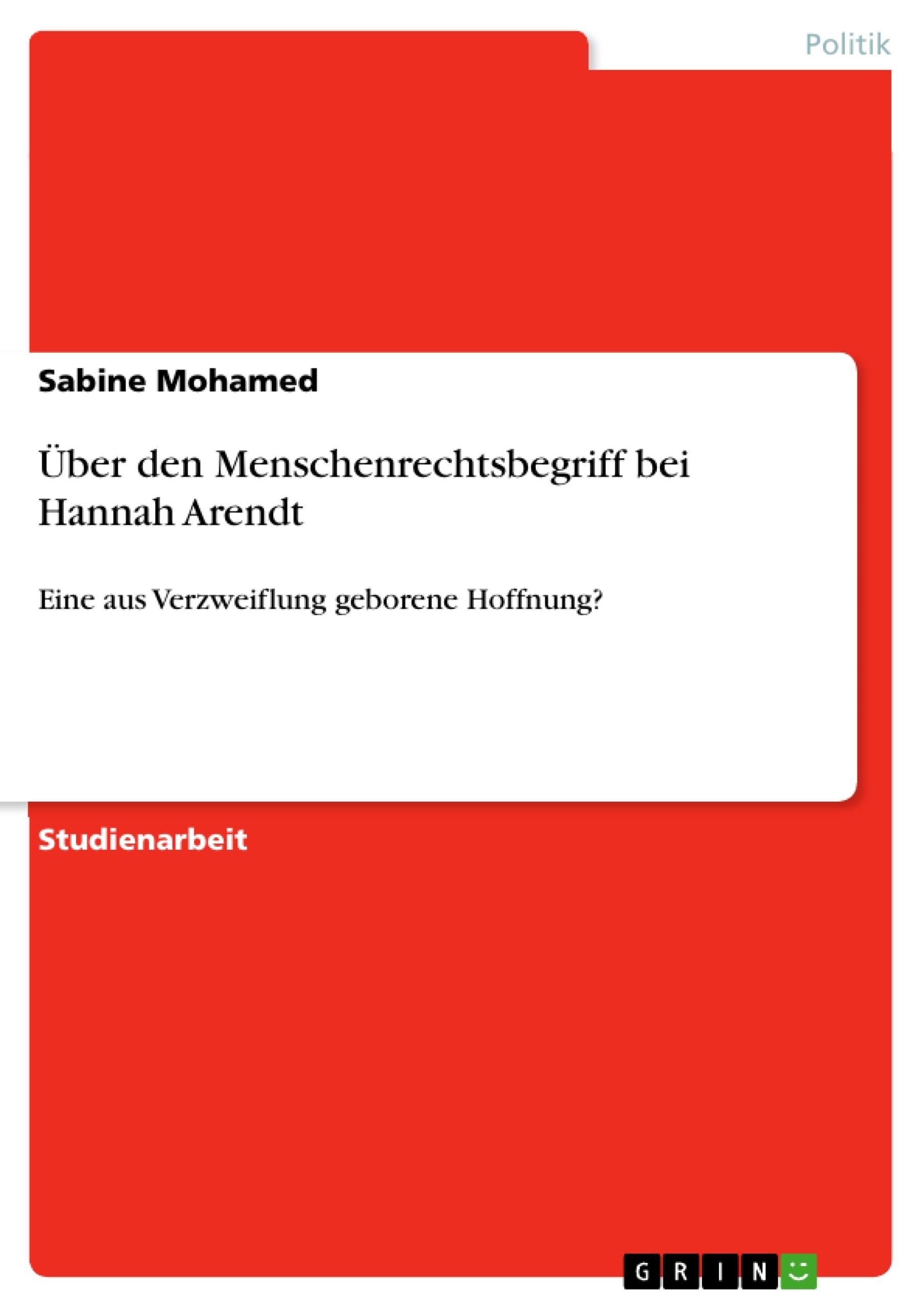Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (kurz: AEM), welche am 10. Dezember 1948 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet wurde gilt als eines der wichtigsten normativen Dokumente des 20. Jahrhunderts (Gospath/Lohmann 1998:7). Nichtsdestoweniger wurde auch in diesem Dokument eine klare Beantwortung einiger Fragen ausgelassen, so dass das Verhältnis zwischen „allgemeiner, tatsächlicher Anerkennung und Verwirklichung“ von Menschenrechten als ein schwieriger Prozess zu bezeichnen bleibt, haftend zwischen den Stricken nationaler und wirtschaftlicher Interessen (vgl. Gospath/Lohmann 1998:7). In politischen wie philosophischen Auseinandersetzungen löst die Frage nach den Menschenrechten noch immer Kontroversen aus, wenn es um die Begründbarkeit von Menschenrechten, die Durchsetzung (Humanitäre Interventionen der Vereinten Nationen), der Legitimität oder Begrenztheit des Geltungsbereichs von Menschenrechten geht. Ein wesentlicher Grund in der Begründbarkeit scheint eine Uneinigkeit darüber, welche Auffassungen aus moralischer und ethischer Argumentation im Verhältnis zu einer rechtlichen überzeugender sind (Gospath/Lohmann 1998:9). So bleibt die konzeptionelle Begründbarkeit einer Idee von und über Menschenrechte nach wie vor anfechtbar und strittig. Wann hat ein Mensch das Recht auf Menschenrechte, wie erhält er diese und was sind sie? Diese Fragestellungen hat die politische Philosophin Hannah Arendt (1906-1975) vor etwas mehr als sechzig Jahren aufgeworfen.
Arendts Konzeption von Menschenrechten ist aus politikwissenschaftlicher Sicht besonders relevant, weil sie in Disposition zur klassischen Menschenrechtsauslegung steht. Arendt argumentiert weder juridisch, moralisch noch ethisch, sondern politisch. In ihrem berühmt gewordenen Essay „Es gibt nur ein einziges Menschenrecht“ (1949) fordert Arendt ein radikales Verständnis von Menschenrechten, ihre Neuformulierung (die Fragestellung nach dem wie, müsse bei den Menschenrechten gedacht werden), eine Politisierung des Raumes und stellt eine marginalisierte Gruppe in den Fokus ihrer Überlegungen. (...).
Inhaltsverzeichnis
- EINE HISTORISCH-POLITISCHE ANALYSE DER MENSCHENRECHTE
- WELTLOSIGKEIT (HEIDEGGERS „WELT" -BEGRIFF)
- DAS GESPRÄCH
- NICHTS-ALS-MENSCH-SEIN
- EIN EINZIGES RECHT ZUM MENSCHENRECHT — „RECHT, RECHTE ZU HABEN"
- ARENDTS KONZEPTION AM BEISPIEL DER EUROPÄISCHEN FLÜCHTLINGSPOLITIK
- FAZIT
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit Hannah Arendts Konzeption von Menschenrechten und analysiert, inwiefern diese im Kontext der Geschichte des 20. Jahrhunderts und insbesondere im Hinblick auf die Problematik der Rechtlosigkeit von Flüchtlingen relevant ist. Die Arbeit untersucht, wie Arendt die Menschenrechte neu denkt und welche Bedeutung ihr "Recht, Rechte zu haben" für die politische Praxis hat.
- Die Kritik an der traditionellen Menschenrechtskonzeption und die Forderung nach einer Neuformulierung im Lichte der Erfahrungen des 20. Jahrhunderts
- Die Bedeutung des "Welt"-Begriffs bei Hannah Arendt und Martin Heidegger für die Frage der Rechtlosigkeit
- Die Rolle des Gesprächs und der politischen Gemeinschaft für die Konstituierung von Menschenrechten
- Die Analyse der Problematik der Rechtlosigkeit von Flüchtlingen im Kontext der europäischen Flüchtlingspolitik
- Die Herausarbeitung der zentralen Aporien in Arendts Konzeption von Menschenrechten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit Hannah Arendts historisch-politischer Analyse der Menschenrechte und zeigt auf, wie diese im Laufe der Geschichte des 18. und 19. Jahrhunderts zunehmend als ein Ausnahmerecht für Unterdrückte und Minderheiten im Kontext von Auflehnung und Widerstand verstanden wurden. Die Arbeit beleuchtet, wie die Erfahrungen des 20. Jahrhunderts, insbesondere die Entstehung von Millionen Staatenloser und Flüchtlingen, Arendts Denkansatz prägten.
Im zweiten Kapitel wird der Begriff der "Weltlosigkeit" im Kontext der Rechtlosigkeit von Flüchtlingen erörtert. Dabei wird Arendts Bezug auf Martin Heideggers "Wer-Begriff" und dessen Bedeutung für die Frage nach dem "In-der-Welt-Sein" des Menschen beleuchtet. Die Arbeit zeigt auf, wie die Entfremdung von der Welt und die Ausschließung aus der politischen Gemeinschaft die Rechtlosigkeit von Flüchtlingen charakterisieren.
Das dritte Kapitel widmet sich der Rolle des Gesprächs für die Konstituierung von Menschenrechten. Arendt argumentiert, dass die Welt erst durch die Begegnung im Gespräch menschlich wird und dass die Stimmen der Menschen zum Gegenstand des Gesprächs werden müssen. Die Arbeit beleuchtet, wie Arendt das aristotelische Konzept der Freundschaft und den Begriff der Isonomia in ihre Konzeption von Menschenrechten einbezieht.
Das vierte Kapitel analysiert die abstrakte Nacktheit des Menschseins und die Gefahr, die darin liegt, dass Menschen nur als bloße Menschenwesen betrachtet werden. Die Arbeit zeigt auf, wie Arendt die Privilegierung nationaler Rechte vor den natürlichen Rechten im Kontext des "Wilden" und des "Naturzustands" diskutiert. Die Arbeit beleuchtet die Gefahr der Regression der Zivilisation und die Bedeutung der öffentlichen Sphäre für die Gleichheit.
Das fünfte Kapitel behandelt Arendts These, dass es nur ein einziges Menschenrecht, das "Recht, Rechte zu haben", gibt. Die Arbeit zeigt auf, wie Arendt die AEM in ihren Aporien sieht und welche Bedeutung sie dem Recht auf Staatsbürgerschaft und der politischen Gemeinschaft beimisst. Die Arbeit beleuchtet die Gefahr der Verlustigung von Menschenrechten durch die "Ansammlung der Rechte" und die Notwendigkeit einer Neuformulierung der Menschenrechtskonzeption.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Menschenrechtsbegriff, die Rechtlosigkeit, die Staatsbürgerschaft, die Flüchtlingspolitik, die Europäische Union, die "Weltlosigkeit", das "Recht, Rechte zu haben", Hannah Arendt, Martin Heidegger, das Gespräch, die politische Gemeinschaft, die AEM, die "displaced persons", Frontex, die Rückführungsrichtlinie, die Europäisierung der Flüchtlingspolitik.
Häufig gestellte Fragen
Was meint Hannah Arendt mit dem „Recht, Rechte zu haben“?
Es ist die Forderung nach einem grundlegenden Recht auf Zugehörigkeit zu einer politischen Gemeinschaft, ohne die alle anderen Menschenrechte wertlos bleiben.
Warum kritisiert Arendt die klassische Menschenrechtsauslegung?
Weil diese oft moralisch oder juridisch argumentiert, während Arendt die Menschenrechte als rein politisches Problem im Kontext von Staatsbürgerschaft sieht.
Was bedeutet „Weltlosigkeit“ bei Arendt?
Es beschreibt den Zustand von Flüchtlingen und Staatenlosen, die aus dem schützenden Raum der politischen Gemeinschaft und damit aus der gemeinsamen Welt ausgeschlossen sind.
Wie wird Arendts Theorie auf die aktuelle Politik angewendet?
Die Arbeit nutzt Arendts Konzepte, um die europäische Flüchtlingspolitik und Organisationen wie Frontex kritisch zu analysieren.
Welche Rolle spielt Martin Heidegger in dieser Arbeit?
Sein Welt-Begriff dient als philosophischer Bezugspunkt, um Arendts Verständnis von Rechtlosigkeit und dem „In-der-Welt-Sein“ zu verdeutlichen.
- Quote paper
- Sabine Mohamed (Author), 2010, Über den Menschenrechtsbegriff bei Hannah Arendt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/212518