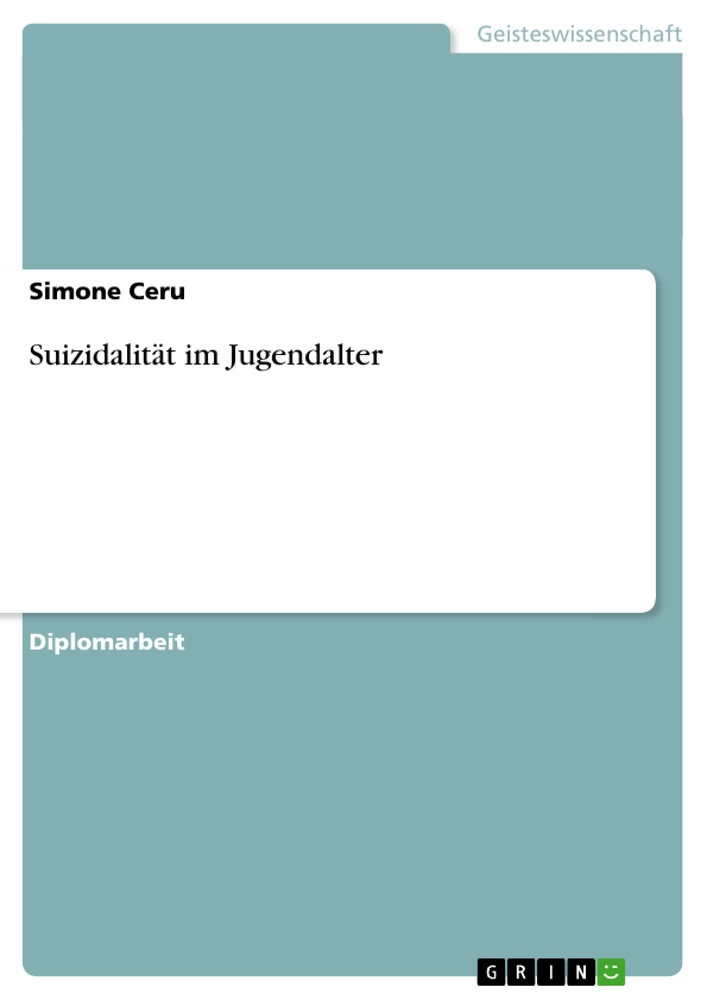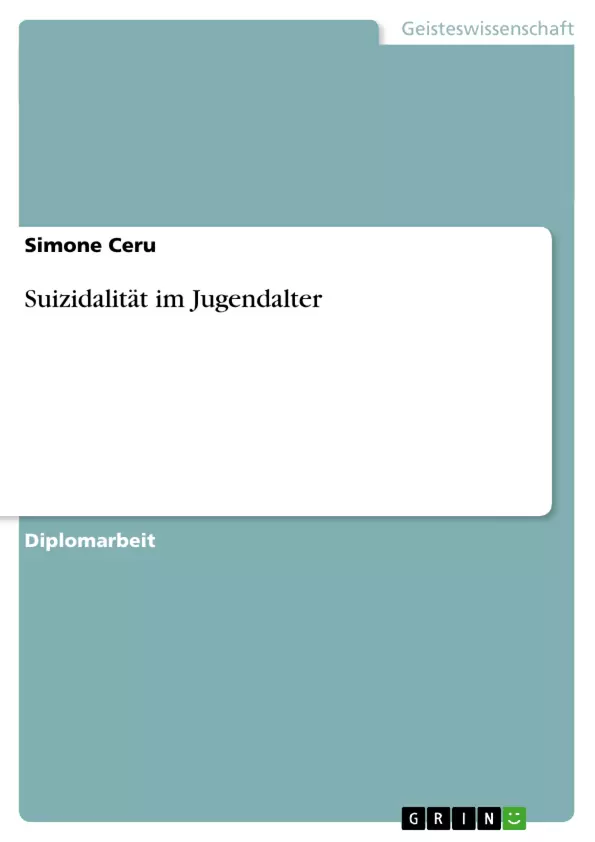Suizide stellen in Deutschland die zweithäufigste Todesursache bei Jugendlichen dar, wobei die Zahl der Suizidversuche Expertenschätzungen zufolge die Anzahl der vollendeten Suizide um ein mehrfaches übersteigt. Es handelt sich demnach nicht um eine gesellschaftliche Randerscheinung. Da die Thematik tabuisiert wird, erfolgt keine Aufarbeitung, sondern im Gegenteil Betroffene und ihre Angehörigen werden häufig stigmatisiert und ausgegrenzt.
2003 gab es kaum spezielle Hilfeeinrichtungen für suizidale Jugendliche. Meist werden suizidgefährdete Jugendliche stationär behandelt, oder von allgemeinen Kriseninterventions- und Beratungseinrichtungen mitgetragen.
Daher liegt der Schwerpunkt dieser Diplomarbeit auf der Fragestellung: Wie kann eine interdisziplinäre Herangehensweise an das Thema wie sie der Sozialarbeit zu eigen ist, die Fachdiskussion und vor allem die praktische Arbeit mit suizidgefährdeten Jugendlichen bereichern und erweitern.
Hierfür werden zunächst die Merkmale der Adoleszenz aus biologischer psychologischer und soziologischer Sicht grob erläutert, sowie ein kurzer Überblick über Krisen gegeben. Anschließend erfolgt eine kurze statistische Betrachtung der Problematik (Datenstand 2003) und verschiedene Ursachen und Risikofaktoren für Suizidalität im Jugendalter werden beleuchtet. Des Weiteren gibt die Arbeit einen kurzen Überblick über biologisch-medizinische, psychologische und soziologische Theorien zur Entstehung von Suizidalität. Nachdem mögliche Ursachen und Risikofaktoren für den Selbstmord von Adoleszenten vorgestellt werden, beschäftigt sich ein weiteres Kapitel mit Diagnosekriterien und Interventionsmöglichkeiten.
Zum Abschluss wird die Arbeit und das Konzept des Vereins „NEUhland“ (http://www.neuhland.net/) vorgestellt. Es ist eine der wenigen Einrichtungen, die sich auf suizidale Kinder und Jugendliche spezialisiert hat und sie arbeitet zudem mit einem interdiszipliären Team. Der Verein besteht seit 1984 und verfügt somit über viel Erfahrung in der Arbeit mit suizidalen Jugendlichen. Zunächst wird als Basis die Geschichte und das Konzept der Institution vorgestellt. Im weiteren wird das Konzept und der theoretische Rahmen von NEUhland erläutert. Anschließend wird das ambulante und das stationäre Angebot für Jugendliche dargelegt. Die Informationen beziehen sich auf den Stand von 2003. NEUhland besteht weiterhin und arbeitet mit suizidalen Jugendlichen und ihren Angehörigen.
Inhaltsverzeichnis
0 Einleitung
1 Definition und Charakteristika von Adoleszenz und Krisen
1.1 Adoleszenz
1.1.1 Charakteristika des Jugendalters
1.1.2 Biologische Perspektive
1.1.3 Psychologische Perspektive
1.1.4 Soziologische Perspektive
1.2 Krisen
1.2.1 Definition von Krise
1.2.2 Verlauf von Krisen
1.2.3 Schwierigkeiten und Chancen von Krisen
1.2.4 Typische Krisen der Adoleszenz
2 Suizidalität im Jugendalter
2.1 Definitionen
2.1.1 Suizidale Gedanken
2.1.2 Parasuizid
2.1.3 Suizid
2.1.4 Harte und weiche Methoden
2.2 Statistische Daten zur Suizidalität
2.2.1 Häufigkeit von Suiziden
2.2.2 Häufigkeit von Parasuiziden
2.2.3 Präferenzen bei der Methodenwahl
2.2.4 Ost- West Vergleich
3 Entstehung von Suizidalität
3.1 Theoriemodelle zur Erklärung
3.1.1 Biologisch-medizinische Ansätze
3.1.2 Psychologische Ansätze
3.1.3 Soziologische Ansätze
3.1.4 Kritische Betrachtung
3.2 Einfluss- und Risikofaktoren
3.2.1 Gesellschaftlicher Wandel
3.2.2 Soziodemographische Faktoren
3.2.3 Risikogruppen im Jugendalter
3.2.4 Akute Bedingungsfaktoren
4 Diagnostik und Methodik
4.1 Diagnostik von Suizidalität
4.1.1 Erkennung von Suizidalität
4.1.2 Psychosoziale Diagnostik
4.1.3 Einschätzung der aktuellen Suizidgefahr
4.1.4 Suizidale Entwicklung und das präsuizidales Syndrom
4.2 Methoden der Prävention und Intervention
4.2.1 Präventionsmöglichkeiten
4.2.2 Krisenintervention
4.2.3 Klientenzentrierte Einzelhilfe
4.2.4 Gruppenarbeit
5 Praxis einer Einrichtungen
5.1 Neuhland in Berlin
5.1.1 Vorstellung
5.1.2 Konzept
5.1.3 Ambulante Angebote
5.1.4 Stationäre Angebote
5.2 Diskussion
6 Zusammenfassung
7 Summary
8 Literaturverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Sterbefälle durch Suizid – Vergleich der Jahre 1971, 1981, 1991 und 2001
Tabelle 2: Sterbefälle durch Suizid – Vergleich der Jahre 1971, 1981, 1991 und 2001 nach Methodenwahl
0 Einleitung
Suizide stellen in Deutschland die zweithäufigste Todesursache bei Jugendlichen dar (vgl. Schmidtke, A., 1996, S 17), wobei die Zahl der Suizidversuche Schätzungen von Experten zufolge die Anzahl der vollendeten Suizide um ein mehrfaches übersteigt (vgl. Bronisch, T., 2002, S 5 f; Schmidtke, A. , 1996, S 31). Hier wird deutlich, dass es sich bei dieser Problematik nicht lediglich um eine gesellschaftliche Randerscheinung handelt. Hinzu kommt, dass dieses Thema in der westlichen Gesellschaft tabuisiert wird (vgl. Döring, G. H., 2001, S 18). Dies bewirkt, dass eine Aufarbeitung innerhalb der Gesellschaft durch informelle soziale Netzwerke kaum stattfinden kann.
Spezielle Hilfeeinrichtungen für suizidale Jugendliche sind in Deutschland kaum vorhanden. Meist werden suizidgefährdete Adoleszente stationär behandelt oder von allgemeinen Kriseninterventions- und Beratungseinrichtungen mitgetragen (vgl. Döring, G. H.; Witte, M., 2000, S 144).
Daher liegt der Schwerpunkt dieser Diplomarbeit auf der Fragestellung: Wie kann eine interdisziplinäre Herangehensweise an das Thema wie sie Sozialarbeit zu eigen ist, die Fachdiskussion und vor allem die praktische Arbeit mit suizidgefährdeten Jugendlichen bereichern und erweitern?
Zur Beantwortung dieser Frage wurde die Arbeit folgendermaßen gegliedert:
Das gesamte erste Kapitel dient dem grundlegenden Verständnis der Adoleszenz und der besonderen Belastung, der Jugendliche, auch ohne zusätzliche Bürden unterliegen. Dazu wird im ersten Teil zunächst Adoleszenz definiert, um dem Leser eine Orientierung zu ermöglichen. Anschließend wird ein grober Überblick über die biologische Entwicklung während dieser Zeit gegeben. Da diese Veränderungen auch gravierende psychische Wandlungen nach sich ziehen, werden diese in Abschnitt 1.1.3 dargestellt. Abschließend wird die soziale Position, die Jugendliche einnehmen, vorgestellt. Daraus ergibt sich ein Gesamtbild des Jugendalters. Die Adoleszenz ist die Zeit in der Veränderungskrisen gehäuft auftreten (vgl. Dross, M., 2001, S 54). Daher werden im zweiten Teil des Kapitels allgemein Krisen und ihre Verläufe allgemein dargestellt. Im letzten Abschnitt wird dann ein kurzer Überblick über typische Adoleszenzkrisen gegeben. Treten diese in schwerer Form oder gehäuft auf, oder verfügt der Jugendliche nicht oder nicht im angemessenen Rahmen über adäquate Bewältigungsmöglichkeiten, können diese allein schon zur Suizidalität führen (vgl. Dross, M., 2001, S 54).
Im zweiten Kapitel erfolgt zunächst die Definition und Erläuterung der Begriffe suizidale Gedanken, Parasuizid und Suizid. Auch die in der Literatur bezüglich der Methodenwahl meist benutzten Begriffe „hart“ und „weich“ werden hier bestimmt. Diese Darstellungen erleichtern dem Leser das Verständnis der weiteren Ausführungen.
In Kapitel 2.2 geht es um die konkrete statistische Darstellung des Ausmaßes der Problematik. Hier wird zuerst die Häufigkeit von Suiziden und von Suizidversuchen behandelt. Anschließend wird die Methodenwahl bei Suizidversuch und Suizid von Jugendlichen anhand statistischer Daten geschildert. Ferner wird auch das Thema Differenzen zwischen Ost- und Westdeutschland kurz angeschnitten. Hier wäre vorstellbar, dass die zusätzlichen Belastungen durch den massiven gesellschaftlichen Wandel zu erhöhter Suizidalität führen.
In der aktuellen Literatur herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass Suizide und Parasuizide multifaktorielle Ursachen haben (vgl. Steinhausen, H.-C., 2002, S 276; Maris, R. W. et al., 2000, S 3; Schmidtke, A.; Schaller, S., 2002, S 87). Es handelt sich also um ein vielschichtiges Problem, das nicht mit einfachen Erklärungsmodellen begründet werden kann. Daher wird im dritten Kapitel ein Überblick über biologisch-medizinische, psychologische und soziologische Theorien zur Entstehung von Suizidalität gegeben und kurz kritisch hinterfragt. Die Ansätze schliessen sich dabei nicht gegenseitig aus, da sie für nicht ausreichen, um der Komplexität des Problems gerecht zu werden. Viel mehr ergänzen sich die Theorien und ergeben ein Gesamtbild möglicher Erklärungen. Eine umfassende und vertiefende Auseinandersetzung mit den vielfältigen Theorien kann im Rahmen dieser Arbeit nicht geleistet werden. Daher wird lediglich eine Auswahl dieser in kurzer Form vorgestellt. Es wurden die Erklärungsmodelle ausgewählt, die in der Literatur als elementar angesehen werden.
Im zweiten Teil des Kapitels werden Risikofaktoren für Suizidalität speziell bei Jugendlichen herausgearbeitet. Diese Faktoren ergänzen die vorherigen Ausführungen. Ferner dienen sie dem Verständnis einiger Diagnosekriterien, die im nächsten Kapitel behandelt werden. Dabei wird zunächst der gesellschaftliche Wandel und seine Risiken und Vorzüge für Jugendliche beleuchtet. Vor dem Hintergrund dieser Darstellung werden im Anschluss soziodemographische Variablen, wie Religion, Schicht und Arbeitslosigkeit auf ihre möglichen Auswirkungen auf juvenile Suizidalität hin untersucht. In Abschnitt 3.2.3 geht es um spezielle Risikogruppen im Jugendalter, die anhand von empirischen Untersuchungen ausgemacht wurden. Im letzten Abschnitt sollen schliesslich akute Bedingungsfaktoren und Auslöser für suizidale Handlungen bei Adoleszenten vorgestellt werden, da sich diese häufig von denen der erwachsenen Suizidalen unterscheiden (vgl. Schier, E., 1986, S 65). Alle im dritten Kapitel behandelten Faktoren sind zusammenhängend und unter den in Abschnitt 1.2.4 beschriebenen Adoleszenzkrisen zu betrachten.
Nachdem nun mögliche Ursachen und Risikofaktoren für Suizidalität im Jugendalter erläutert wurden, befasst sich das vierte Kapitel mit Diagnosekriterien und Interventionsmöglichkeiten. Dafür soll die psychosoziale Diagnostik von Suizidalität vorgestellt werden. Die Erkennung von Suizidgefährdung an sich und dem Grad der Gefahr werden dann, obwohl sie Teil der Anamnese sind, in eigenen Abschnitten behandelt. Dasselbe gilt für die Beschreibung des präsuizidalen Syndroms und der suizidalen Entwicklung. Diese Aufteilung erscheint aus verschiedenen Gründen sinnvoll. Zunächst gibt es wenige Beratungs- und Kriseninterventionseinrichtungen, die auf Suizidale spezialisiert sind (vgl. Döring, G. H.; Witte, M., 2000, S 144). Das bedeutet, dass im Rahmen von allgemeiner Beratung eine Gefährdung erst evident werden kann. Da der professionelle Umgang mit der Thematik während des Studiums der Sozialarbeit kaum oder nicht gelehrt wird, kann angenommen werden, dass sich die komplexen Kriterien zur Diagnostizierung von Suizidalität und ihres Grades dem allgemeinen Fachwissen von Sozialarbeitern, welche keine spezielle Zusatzausbildung oder ausreichende Berufserfahrung in dem Bereich haben, entzieht. Daher sollen diese Aspekte als Hilfe für die Praxis in eigenen Abschnitten präziser erläutert werden.
Die Diagnosekriterien allein reichen in der praktischen Arbeit nicht aus, denn es stellt sich die Frage wie nun darauf reagiert werden kann. Dazu werden im Kapitel 4.2 professionelle Interventionsmöglichkeiten vorgestellt. Diese beziehen sich auf die Methodik der Sozialarbeit und versuchen diese auf die Bedürfnisse suizidaler Jugendlicher ausgerichtet, zu betrachten. So werden zunächst Begriffe der Prävention dargestellt, um dann auf die erste Form der Intervention einzugehen: die Krisenintervention. Diese ist deshalb so wichtig, weil sie meist die erste Maßnahme bei suizidalen Krisen darstellt. Hier soll der Klient zunächst soweit stabilisiert werden, dass die akute Gefährdung abgewendet werden kann und -je nach Fall- der Klient zu weitergreifenden Interventionen fähig wird (vgl. Sonneck, G.; Etzersdorfer, E., 1995, S 15). Diese sind dann aus sozialarbeiterischer Sicht die Einzelhilfe und die soziale Gruppenarbeit.
Im fünften Kapitel wird das Konzept und Angebot einer Hilfeeinrichtung für suizidale Jugendliche vorgestellt und diskutiert. Die Autorin hat sich für NEUhland, ein Modellprojekt des Vereins >Hilfen für suizidgefährdete Kinder und Jugendliche e. V.< entschieden. Hier waren folgende Kriterien ausschlaggebend: NEUhland ist eine der wenigen Einrichtungen, die sich auf suizidale Kinder und Jugendliche spezialisiert hat. Da Kinder nur einen sehr kleinen Anteil des Klientels ausmachen, weil suizidale Handlungen in diesem Alter sehr selten sind (vgl. Steinhausen, H.-C., 2002, S 273; Nissen, G.; 1994, S 319), ist diese Einrichtung zur Vorstellung im Rahmen dieser Arbeit geeignet. Ausserdem hat sich NEUhland konzeptionell und im Rahmen ihres Angebotes auf Jugendliche ausgerichtet und besteht bereits seit 1984, so dass auch Erfahrung in der Arbeit vorausgesetzt werden kann. Ein weiteres wichtiges Kriterium zur Auswahl dieser Organisation, stellt die interdisziplinäre Mitarbeiterstruktur dar.
Zunächst wird als Basis NEUhland und das Konzept der Einrichtung vorgestellt. Im weiteren wird das ambulante und das stationäre Angebot für Jugendliche dargelegt und erläutert. Diese Darstellung dient der Orientierung des Lesers, denn auf dieser Grundlage wird im Kapitel 5.2 die Einrichtung und vor allen Dingen das Angebot kritisch betrachtet. Hier wird die praktische Arbeit mit suizidalen Jugendlichen, anhand der dargelegten theoretischen Überlegungen in den vorhergehenden Kapiteln interpretiert.
1 Definition und Charakteristika von Adoleszenz und Krisen
1.1 Adoleszenz
1.1.1 Charakteristika des Jugendalters
Eine Darstellung der vielfältigen Theorieansätze zur Erklärung von Entwicklung, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht erfolgen. Hier wären beispielsweise die Sozialisationstheorie (vgl. dazu Hurrelmann, K. 1997, S 53 ff) und das Konzept der Entwicklungsaufgaben (vgl. Montada, L., 2002, S 41 ff; Oerter, R.; Dreher, E., 2002, S 268 f) als wesentlich zu benennen. Im folgenden beschränkt sich die Autorin auf die Beschreibung, der in der Literatur als relevant betrachteten Merkmale von Adoleszenz und den Veränderungen in dieser Phase.
Im Allgemeinen bezeichnet Adoleszenz die Phase vom zwölften oder dreizehnten bis etwa zum einundzwanzigsten oder fünfundzwanzigsten Lebensjahr (vgl. Fachlexikon der Sozialen Arbeit, 1997, S 792). Eine trennscharfe Begrenzung der Adoleszenz in Bezug auf das Alter ist nicht möglich, da der Beginn des Jugendalters durch den Einsatz der körperlichen Veränderungen noch relativ genau festzulegen ist, während das Ende dieses Lebensabschnitts weitaus stärker gesellschaftlichen Bedingungen unterliegt (vgl. Remschmidt, H., 1992a, S 4 f).
In der Literatur hat sich eine Zerlegung der Adoleszenz in zwei Phasen weitgehend durchgesetzt (vgl. Remschmidt, H., 1992a, S 4; Ausubel, D. P., 1970, S 83 f). Die erste Phase setzt mit den pubertären körperlichen Veränderungen ein. Durch die Situation nicht mehr Kind zu sein, jedoch auch noch keinen Anschluss an die Subkultur der Jugendlichen gefunden zu haben, kommt es zum Orientierungsverlust (vgl. Remschmidt, H., 1992a, S 4; Ausubel, D. P., 1970, S 83). In der zweiten Phase, der Spätadoleszenz, haben die Jugendlichen an Orientierung und Sicherheit gewonnen und Anschluss an die Peer-Group gefunden. Dabei haben sie noch nicht den Erwachsenenstatus inne und befinden sich in einer Phase der Identitätsfindung und Reorganisation (vgl. Remschmidt, H., 1992a, S 4; Ausubel, D. P.,1970, S 84). Aus sozialer Sicht ist das Jugendalter die Zeit, in der die soziale Platzierung stattfindet (vgl. Schäfer, B., 1998, S 99). Der Jugendliche muss seine Haltung zu „sich, dem anderen Geschlecht, zu den Werten seiner Kultur und Gesellschaft“ (ebd., 1998, S 99) finden.
Im nächsten Abschnitt werden kurz die biologischen Aspekte des Jugendalters vorgestellt. Sie sind die Basis für die im weiteren beschriebenen psychischen und sozialen Veränderungen und markieren den Beginn dieses Lebensalters.
1.1.2 Biologische Perspektive
Das Einsetzen der Adoleszenz ist durch eine Reihe physiologischer Veränderungen gekennzeichnet. Der Begriff Pubertät bezieht sich in erster Linie auf den Prozeß der körperlichen und sexuellen Reifung (vgl. Remschmidt, H., 1992a, S 1 f).
Die Pubertät beginnt mit einem Wachstumsschub und einer damit verbundenen Umgestaltung der Proportionen (vgl. Oerter, R.; Dreher, E., 2002, S 276). Ferner erfolgen beträchtliche endokrine Umstellungen, die vor allem zur Ausbildung der sekundären Geschlechtsmerkmale führen (vgl. ebd., 2002, S 279 f). Bei Mädchen setzt die pubertäre Entwicklung in der Regel früher ein als bei Jungen. In der Literatur wird dieser Vorsprung mit etwa zwei Jahren angegeben (vgl. Steinhausen, H.-C., 2002, S 11; Eggers, C., 1994, S 6).
Es besteht eine erhebliche Variabilität der körperlichen Entwicklung, die keine Normabweichung darstellt (vgl. Eggers, C., 1994, S 5; Remschmidt, H., 1992b, S 18). Die biologischen Vorgänge führen auch zu psychologischen und psychosozialen Veränderungen, die im nächsten Abschnitt näher behandelt werden.
1.1.3 Psychologische Perspektive
Zu den wichtigsten Aspekten zählen hierbei die Umstrukturierung der kognitiven Strukturen, die Ausbildung der Introspektionsfähigkeit sowie die Ich- Entwicklung und die Identitätsfindung, die in diesem Altersabschnitt wesentliche Aufgaben darstellen (vgl. Steinhausen, H.-C., 2002, S 11). Auch die Entfaltung und Erweiterung der Frustrationstoleranz erfolgt in diesem Altersabschnitt (vgl. Schäfer, B., 1998, S 89). Die moralische Entwicklung sowie die Umschichtung von Werten und Einstellungen (vgl. ebd., 2002, S 11), die sich in diesem Alter von den Vorstellungen und Werten der Eltern entfernt, während diese der Peer-Group an Bedeutung gewinnen (vgl. Remschmidt, H., 1992b, S 27), stellen wichtige Schritte auf dem Weg vom Kindheitsstatus zur Rolle des Erwachsenen dar.
Die somatischen Veränderungen in der Pubertät ziehen auch soziale Reaktionen darauf nach sich. Es erfolgt eine stärkere Hinwendung zum Körper, bedingt durch seine Umgestaltung und die Erwartungen des sozialen Umfelds an die Jugendlichen (vgl. Nissen, G., 1994, S 28; Remschmidt, H., 1992a, S 86). Da Adoleszente sich mit vielen Neuerungen auseinandersetzten müssen und sich selten der Variabilität der Entwicklung bewusst sind, neigen sie dazu sich innerhalb der Peer-Group zu vergleichen und vermeintliche sowie tatsächliche Rückstände überzubewerten (vgl. Remschmidt, H., 1992a, S 86 f).
Hinzu kommt, dass sie die körperlichen Wandlungen in ihr Körperschema integrieren müssen, das in diesem Alter häufig nicht objektiv, sondern verzerrt oder sogar konträr zum Urteil der Umwelt ist (ebd., 1992a, S 87). Dadurch kommt es zu Beeinträchtigungen der Selbsteinschätzung und des Selbstwertgefühls (Steinhausen, H.-C. 2002, S 11). Auch die sozialen Reaktionen auf die physiologischen Veränderungen, können hier schwere Krisen des Selbstwerts, etc. auslösen, da Abwertungen in diesem Alter schneller in das Selbstbild integriert werden (vgl. Remschmidt, H., 1992a, 87 f). Dies stellt im Zusammenhang mit dem in diesem Alter auftretenden Interesse an Sexualität und Partnerschaft einen zusätzlichen Krisenherd dar (vgl. Nissen, G. 1994, S 28).
1.1.4 Soziologische Perspektive
„Jugend ist eine biologisch mit-bestimmte, aber sozial und kulturell ‚überformte‘ Lebensphase, in der das Individuum die Voraussetzungen für ein selbständiges Handeln in allen gesellschaftlichen Bereichen erwirbt“ (Schäfers, B., 1998, S 21). Diese Definition macht deutlich, dass Zeitraum und Verlauf der Adoleszenz in hohem Maße von der jeweiligen Gesellschaft und Kultur geprägt sind. Durch die langen Ausbildungszeiten in der industrialisierten modernen Gesellschaft verlängert sich die Spätadoleszenz. Eine Übernahme des Erwachsenenstatus mit den darin beinhalteten Rechten und Pflichten wird verzögert (vgl. Hurrelmann, K., 1997, S 48 f).
Jugendliche müssen neue Rollen, Geschlechterrollen wie auch andere, übernehmen (vgl. Nissen, G., 1994, S 282) und fähig werden “mit diesen institutionellen Vielfältigkeiten umzugehen und die hierarchischen und horizontalen Spannungen, die zwischen den
einzelnen Rollenbereichen auftreten, auszugleichen“ (Hurrelmann, K., 1997, S 42).
Der Einfluss von Eltern auf die Sozialisation nimmt erheblich ab, da Jugendliche sich auch von deren Werten und Lebensvorstellungen abgrenzen, während Schule als Ort der Sozialisation an Bedeutung kaum abnimmt, da der Besuch weiterführender Schulen zu einem immer höherem Zeitaufkommen führt (vgl. Remschmidt, H., 1992a, S 128).
1.2 Krisen
1.2.1 Definition von Krise
Psychosoziale Krisen können definiert werden, als der „Verlust des seelischen Gleichgewichts, den ein Mensch verspürt, wenn er mit Ereignissen oder Lebensumständen konfrontiert wird, die er im Augenblick nicht bewältigen kann, weil sie von der Art und vom Ausmaß her seine durch frühere Erfahrungen erworbenen Fähigkeiten und erprobten Hilfsmittel zur Erreichung wichtiger Lebensziele oder zur Bewältigung seiner Lebenssituation überfordern“ (Goll, H.; Sonneck, G., 1995, S 31).
Dabei werden in der Regel zwei Formen von Krisen unterschieden. Traumatische Krisen werden vorwiegend durch unerwartet auftretende Schicksalsschläge, wie den Tod von nahestehenden Personen ausgelöst (vgl. Rausch, K., 1996, S 89). Veränderungskrisen dagegen treten in bestimmten Lebensphasen gehäuft auf und markieren den Übergang von einer Entwicklungsstufe zur nächsten oder ergeben sich wenngewohnte Abläufe sich ändern und Neuanpassungen erfordern (vgl. dazu Rausch, K., 1996, S 88; Wedler, H., 1994, S 57).
1.2.2 Verlauf von Krisen
In der Literatur herrscht Einigkeit darüber, dass Krisen in bestimmten Phasen verlaufen (vgl. Dross., M., 2001, S14; Aguilera, D. C., 2000, S 30; Rausch, K., 1996, S 89 f; Sonneck, G.; Etzersdorfer, E.,1995, S 15; Wedler, H., 1994, S 58 f). Da die angegebenen Autoren die Prozesse übereinstimmend beschreiben, wird hier vor allem auf die Ausführungen von Etzersdorfer und Sonneck zurückgegriffen.
Veränderungskrisen und traumatische Krisen unterscheiden sich prinzipiell in ihrem Verlauf (vgl. 1995, S 15). Das Modell der Entwicklung von Veränderungskrisen geht auf Caplan (1964) zurück (vgl. 1995, S 15).
Er unterscheidet vier Stadien und sieht den Krisenverlauf als stetig ansteigende innere Spannung, deren Ursache im Krisenanlass zu sehen ist (vgl. 1995, S 15).
Zunächst kommt es zur Konfrontation mit der Veränderung. Kann sich das Individuum nicht adäquat anpassen, folgt die zweite Phase, das Versagen (vgl. 1995, S 16). Hier stellt sich beim Betroffenen das Gefühl des Scheiterns ein, das durch die Unfähigkeit die Veränderung in sein Leben zu integrieren ausgelöst wird (vgl. 1995, S 16). Dadurch steigt der emotionale Druck weiter an und es kommt zum Stadium der Mobilisierung (vgl. 1995, S 16). In dieser Phase versucht das Individuum alle inneren und äußeren Hilfsmöglichkeiten zu nutzen, um die innere Anspannung und somit den Leidensdruck zu lösen (vgl. 1995, S 16). Zu diesem Zeitpunkt werden auch professionelle Hilfsangebote aufgesucht und angenommen (vgl. 1995, S 16). Sofern nun adäquate Hilfe erfolgt, wird die Krise bewältigt und endet; ist dies nicht der Fall, bildet sich das Vollbild der Krise aus (vgl. 1995, S 16 f). Es kommt zu einem Kulminationspunkt, der Desorientierung und tiefe Verwirrung auslöst, was eine Gefährdung durch Suizid oder andere impulsive Handlungen zur Folge haben kann (vgl. 1995, S 17). Auch in dieser letzten Phase ist eine abschließende Bearbeitung der Krise und eine anschließende Neuorientierung des Betroffenen möglich (vgl. 1995, S 17).
Die Krisenbewältigung erfolgt in diesem Modell durch Lösung der Anspannung mittels therapeutischer Intervention, Erprobung neuer Bewältigungsmuster oder der Hilfe des sozialen Umfeldes.
Der Verlauf von traumatischen Krisen wurde 1978 von Cullberg beschrieben (vgl. 1995, S 15). Auch er unterscheidet vier Stadien, wobei das erste der kurzzeitige Schock als Reaktion auf das traumatische Ereignis ist (vgl. 1995, S 16). Darauf folgt die Reaktionsphase, in der viele belastende Emotionen wie Wut, Trauer und Hoffnungslosigkeit, körperliche Begleitsymptome sowie starke Schwankungen der Gefühle von affektiven Turbulenzen bis hin zu Apathie auftreten (vgl. 1995, S 16). In der dritten Phase erfolgt die Bearbeitung des Traumas und schließlich kommt es zur vierten Phase, der Neuorientierung (vgl. 1995, S 16). Die letzten drei Stadien können nicht trennscharf voneinander abgegrenzt werden, da sie sich meist vermischen oder ineinander übergehen (vgl. 1995, S 16).
Veränderungskrisen, zu denen auch die typischen Adoleszenzkrisen zählen, können bis zur dritten Phase durch Konfrontation mit der Veränderung und Integration in das Leben unterbrochen werden, während traumatische Krisen meist alle Phasen durchlaufen bevor es zu einer Bewältigung kommen kann (vgl. 1995, S 15 ff).
1.2.3 Schwierigkeiten und Chancen von Krisen
Lebenskrisen sind nicht als Krankheit zu sehen, denn sie gehören zur Existenz des Menschen und dienen der seelischen Weiterentwicklung (vgl. Wedler, H., 1997, S 47). Bei der Bewältigung psychischer Krisen werden neue Bewältigungsstrategien erlernt und somit das Handlungsrepertoire in Bezug auf das Problemlöseverhalten erweitert (vgl. Aguilera, D. C., 2000, S 25; Ziegelbauer, B.; Roscher, M., 1995, S 115). Gerade Entwicklungskrisen stellen eine wichtige Erfahrung dar und machen den Übergang von einer Entwicklungsstufe in die nächste möglich (vgl. Rausch, K., 1996, S 88).
Problematisch werden krisenhafte Phasen dann, wenn sie einen pathologischen Verlauf nehmen (vgl. Dross, M., 2001, S 14; Aguilera, D. C., 2000, S 48; Rausch, K., 1996, S 90 f; Sonneck, G.; Etzersdorfer, E., 1995, S 16 f). Veränderungskrisen können vor allem in der Mobilisierungsphase krankhafte Prozesse der Fehlanpassung auslösen (vgl. Goll, H.; Sonneck, G., 1995, S 31). Hier sind insbesondere Rückzug und Resignation, sowie eine Chronifizierung der Krise zu nennen (vgl. ebd., 1995, 35; Rausch, K., 1996, S 90). Diese äußert sich unter anderem durch psychische Erkrankungen, Substanzmissbrauch, psychosomatische Störungen, Kriminalität oder auch Suizidalität (vgl. Aguilera, D. C., 2000, S 24; Rausch, K., 1996, S 90; Sonneck, G.; Etzersdorfer, E., 1995, S 16 f).
Traumatische Krisen bergen dieselben Risiken, die hier jedoch vorwiegend in der Reaktionsphase auftreten (vgl. Sonneck, G.; Etzersdorfer, E., 1995, S 15; Rausch, K., 1996, S 91). In beiden Fällen dienen diese pathologischen Reaktionen der Betäubung von Leidensdruck und Schmerz (vgl. Rausch, K., 1996, S 91). Adäquate Interventionsmethoden in suizidalen Krisen werden in Kapitel 4.2 erörtert.
1.2.4 Typische Krisen der Adoleszenz
Durch die vielfältigen Veränderungen, die eine Anpassung erfordern, fühlen sich die Jugendlichen überfordert und finden keine adäquaten Bewältigungsstrategien (vgl. Ziegelbauer, B.; Roscher, M., 1995, S 116; Nissen, G., 1994, S 21). Dies führt zu Überreaktionen, die sich als Adoleszenzkrise äußern. Diese umfassen vor allen Dingen die:
Störungen der Sexualentwicklung: Meist treten diese als Verunsicherung bezüglich der sexuellen Wünsche und Bedürfnisse und der körperlichen Entwicklung der Sexualorgane auf (vgl. Ziegelbauer, B.; Roscher, M., 1995, S 116; Remschmidt, H., 1992a, S 281). Auch der Vergleich mit anderen Jugendlichen und der dadurch auftretende „Leistungsdruck“ in Bezug auf die ersten sexuellen Kontakte oder die Regelmässigkeit dieser, führt zu Irritationen (vgl. Remschmidt, H., 1992a, S 281).
Identitätskrisen: Jugendliche leiden aufgrund der massiven körperlichen und psychologischen Umstellungen häufig unter grossen Verunsicherungen und Ängsten (vgl. Steinhausen, H.-C., 2002, S 12; Nissen, G. 1994, S 28). Die Adoleszenten befinden sich in der Phase der Identitätsfindung und müssen in diesem Alter viele wesentliche Änderungen in ihr Selbstbild integrieren. Dies führt häufig zu Krisen in Bezug auf Wertvorstellungen, Berufswahl, Freundeskreis, Sexualverhalten, Gruppen, Religion, langfristige Ziele, etc. (vgl. Ziegelbauer, B.; Roscher, M., 1995, S 117; Remschmidt, H., 1992a, S 282).
Entfremdungserlebnisse: Depersonalisation und Derealisation, die veränderte und verzerrte Wahrnehmung des eigenen Körpers, des Ichs oder der Umwelt, sind im Jugendalter häufig auftretende Phänomene. Solche Entfremdungserlebnisse können zu Ängstlichkeit, der Furcht verrückt zu werden und damit verbunden zu Einsamkeitsgefühlen führen (vgl. H. Remschmidt, 1992a, S 284).
Emanzipationskrisen: Solche Autoritätskrisen resultieren aus der Auseinandersetzung der Jugendlichen mit Normgefügen, Ordnung und Autorität (vgl. Nissen, G., 1994, S 27; Remschmidt, H., 1992a, S 283). Eine wichtige Aufgabe stellt hier die Ablösung vom Elternhaus dar (vgl. Nissen, G., 1994, S 28). Die Krisen äußern sich entweder als Auflehnung und Abwehrhaltung gegen Normen, Regeln und familiäre Grundsätze, oder als Flucht vor der Auseinandersetzung und Reglementierung durch weglaufen oder beispielsweise Suchtmittelmissbrauch (vgl. Remschmidt, H., 1992a, S 283).
Körperliche Selbstwertkonflikte: Wie in Kapitel 1.1.3 beschrieben, können sowohl tatsächliche körperliche Auffälligkeiten durch reversible oder bleibende Entstellungen, als auch vorübergehende tatsächliche oder angenommene Entwicklungsrückstände bei vielen Jugendlichen zu mehr oder minder schweren Selbstwertstörungen führen, die auch als Thersites-Komplex bezeichnet werden (vgl. Remschmidt, H., 1992a, S 285).
2 Suizidalität im Jugendalter
2.1 Definitionen
2.1.1 Suizidale Gedanken
Unter Suizidgedanken versteht man die gedankliche Beschäftigung mit dem eigenen Tod und der Selbsttötung. Das Phänomen ist unter Jugendlichen sehr weit verbreitet (vgl. Rausch, K., 1991, S 23; Committee on Adolescence, Group of the Advancement of Psychiatry, 1996, S 23). Nach Remschmidt trägt sich etwa die Hälfte aller Jugendlichen mit suizidalen Gedanken (vgl. 1992b, S 386). Suizidale Gedanken reichen von reinen Entlastungsphantasien über Verzweiflung, verbunden mit der Idee das eigene Leben sei nicht mehr lebenswert, zur ständigen gedanklichen Beschäftigung mit dem eigenen Suizid (vgl. Ringel, E., 1987, S 64). Die intensive Beschäftigung mit der Selbsttötung kann einen zwanghaften Charakter annehmen, so dass die Gedanken ständig um dieses Thema kreisen und die genaue Planung des Suizides in allen Einzelheiten beinhalten (vgl. Dick, A., 2002, S 326).
2.1.2 Parasuizid
Die allgemeine Definition für Parasuizid lautet: „Eine Handlung mit nicht-tödlichem Ausgang, bei der ein Individuum absichtlich ein nicht-habituelles Verhalten beginnt, das ohne Intervention von dritter Seite eine Selbstbeschädigung bewirken würde, oder absichtlich eine Substanz in einer Dosis einnimmt, die über die verschriebene oder im allgemeinen als therapeutisch angesehene Dosis hinausgeht, und die zum Ziel hat, durch die aktuellen oder erwarteten Konsequenzen Veränderungen zu bewirken“ (Schmidtke, A.; Weinacker, B.; Löhr, C., 2000, S 68).
Unter dem Begriff Parasuizid, werden alle nicht mit dem Tode endenden suizidalen Handlungen zusammengefasst. Darunter fallen missglückte Suizide, die als Parasuizidale Handlungen bezeichnet werden, Parasuizidale Gesten, die appelativen Charakter gegenüber der Umwelt haben und Parasuizidale Pausen, in denen der Wunsch nach einer Zäsur und Ruhe im Vordergrund steht und weniger der Wunsch zu sterben (vgl. Bronisch, T., 2002, S 10). Das bedeutet, dass zwischen Parasuizid und Suizid nicht nur der Unterschied des letalen Ausgangs besteht, sondern häufig völlig andere Dynamiken zugrunde liegen (vgl. Kerkhof, A J F. M., 2000, S 51).
Felber zufolge werden auch zum Teil nicht direkt suizidale Handlungen, wie selbstdestruktive Verhaltensweisen mit diesem Begriff belegt (vgl. 1993, S 23). Dies führt zu einer gewissen Unschärfe der Definition. Dennoch hat sich der Begriff als international neutraler Terminus durchgesetzt und unglückliche Begriffsbestimmungen wie Pseudo-Suizid, etc. abgelöst (vgl. ebd., 1993, S 23). Im folgenden werden die Begriffe Parasuizid und Suizidversuch synonym gebraucht.
2.1.3 Suizid
Als Suizid wird der „Todesfall, der das direkte oder indirekte Ergebnis einer Handlung darstellt, die von einem Individuum mit dem Wissen oder dem Glauben ausgeübt wird, dass die Handlung zum eigenen Tod führt“ (Dick, A., 2002, S 326) bezeichnet.
Die unterschiedlichen Bezeichnungen wie Selbstmord und Freitod beinhalten Wertungen. Selbstmord enthält den Terminus Mord, so dass dieser Begriff als negativ wertend betrachtet werden muss, während Freitod die freie willentliche Entscheidung sich selbst zu töten impliziert (vgl. dazu Seyfried, M., 1995, S 10 f; Dormann, W., 1991, S 25). Dies scheint jedoch sowohl in Anbetracht der Gefühlswelt von Suizidenten, als auch angesichts der Fälle psychisch Kranker, die sich suizidieren nicht automatisch gewährleistet zu sein. Daher werden in dieser Arbeit die Begriffe Suizid und Selbsttötung synonym verwand, während andere Bezeichnungen lediglich im Rahmen von wörtlichen Zitaten verwendet werden.
2.1.4 Harte und weiche Methoden
Man unterscheidet grundsätzlich zwischen harten und weichen Methoden der Selbsttötung und des Parasuizids. Zu den weichen Methoden zählen alle Formen von Intoxikationen, wie Überdosis von Schmerz- und Beruhigungsmitteln sowie Alkohol oder Gasvergiftungen (vgl. Bronisch, T., 2002, S 11). Harte Methoden sind Erhängen, Springen aus großer Höhe, Erschießen, Ertrinken, Sprung vor Verkehrsmittel sowie andere suizidale Verkehrsunfälle und schwere Stich- oder Schnittwunden (vgl. Steinhausen, H. – C., 2002, S 274; Bronisch, T., 2002, S 11). Die als weich bezeichneten Vorgehensweisen verursachen vergleichsweise wenig oder keine Schmerzen und führen seltener zum Tode (vgl. Bronisch, T., 2002, S 11) als die sogenannten harten Methoden. Weiche Methoden bewirken auch keine äußerlichen Verletzungen, während alle harten Methoden zu mehr oder weniger starken Schäden der Unversehrtheit des Körpers führen.
2.2 Statistische Daten zur Suizidalität
2.2.1 Häufigkeit von Suiziden
Die folgenden Aufstellungen stellen Zeitreihen dar, die in absoluten Zahlen einen Vergleich zwischen den Suizidziffern der betreffenden Altersgruppe der Jahre 1971, 1981, 1991 und 2001 herstellen.
Tabelle 1: Sterbefälle durch Suizid - Vergleich der Jahre 1971, 1981, 1991 und 2001 (Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Statistisches Bundesamt; Todesursachenstatistik)
a) 10 – 14Jährige
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
b) 15 –19 Jährige
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
c) 20 – 24 Jährige
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Andere Alterseinheiten, als die hier benutzten, sind laut Auskunft des statistischen Bundesamtes nicht erhältlich. Daher ist im ersten Teil von Tabelle 1 ein Anteil von Suiziden im Kindesalter enthalten. Nach Angaben des statistischen Bundesamtes sind für das Jahr 1971 und 1981 die Suizidziffern der ehemaligen DDR nachträglich einberechnet worden, um eine Vergleichsbasis zu schaffen (vgl. Statistisches Bundesamt, 2003).
Von 1971 bis 1981 ist ein deutlicher Anstieg der Suizidziffern zu verzeichnen. Ab 1981 sinken die Ziffern auf ein Niveau, das für alle dargestellten Altersgruppen unter dem von 1971 liegt. Für die Altersgruppe der 10 bis 14 jährigen Jugendlichen ist ein leichter Anstieg zwischen 1991 und 2001 zu registrieren. Bei den 15 bis 19 jährigen Adoleszenten stagnieren die Suizidziffern in diesem Zeitraum, während die Werte bei der ältesten Gruppe deutlich gesunken sind. Dabei ist deutlich erkennbar, dass männliche Jugendliche sich signifikant häufiger suizidieren als weibliche Jugendliche (vgl. auch Bronisch, T., 2002, S 5).
Insgesamt scheinen die Daten aufgrund verschiedener Tatsachen mit einer nicht abschätzbaren Dunkelziffer belastet zu sein, die sich als Unterschätzung auswirkt. (vgl. Schmidtke, A., 1995, S 17; Schmidtke, A.; Häfner, H., 1986, S 27). Dies liegt zum Einen darin begründet, dass eine unbestimmte Anzahl an Suiziden nicht als solche erkannt werden und zum Anderen, werden in vielen Familien die Umstände des Suizids aus Gründen wie beispielsweise Scham, Religiosität, etc. verschwiegen (vgl. Steinhausen, H.-C., 2002, S 278). Beide Möglichkeiten führen dazu, dass diese Fälle nicht in die Suizid- sondern in die Unfallstatistik, die Statistik der Drogentoten oder in die Rubrik Todesfälle unbekannter Ursache eingehen (vgl. ebd., 2002, S 278; Schmidtke, A., 1995, S 17; Welz, R., 1992, S 11).
Das Absinken der Suizidziffern seit 1981 ist nach Schmidtke vorsichtig zu bewerten, da ein gleichzeitiger Anstieg der Drogentoten, der Unfallstatistik und der Tode durch unbekannte Ursache zu verzeichnen ist (vgl. Schmidtke, A.,1995, S 17 ff). Somit ist auch eine Verschiebung der statistisch erfassten Suizide gegenüber der ohnehin vorhandenen Fehlervarianz durch die Dunkelziffer denkbar (vgl. ebd.,1995, S 17 ff). Daher sprechen die zum Teil gesunkenen Raten in den letzten Jahrzehnten nicht zweifelsfrei für die sinkende Relevanz des Problems.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Wie häufig ist Suizidalität unter Jugendlichen in Deutschland?
Suizid ist die zweithäufigste Todesursache im Jugendalter, wobei die Zahl der Suizidversuche die der vollendeten Suizide weit übersteigt.
Was sind typische Krisen in der Adoleszenz?
Dazu gehören biologische Umbrüche, psychische Wandlungen und die Suche nach der sozialen Position, die oft zu Identitätskrisen führen.
Was ist das „präsuizidale Syndrom“?
Es beschreibt eine spezifische psychische Entwicklung vor einer suizidalen Handlung, die durch Einengung, Aggressionsstau und Fluchtphantasien gekennzeichnet ist.
Welche Rolle spielt die Sozialarbeit bei der Suizidprävention?
Sozialarbeit bietet eine interdisziplinäre Herangehensweise, die psychosoziale Diagnostik und Krisenintervention im ambulanten und stationären Rahmen verbindet.
Was bietet die Einrichtung „NEUhland“ in Berlin an?
NEUhland ist eine spezialisierte Kriseneinrichtung für Jugendliche, die sowohl ambulante Beratung als auch stationäre Hilfe durch interdisziplinäre Teams anbietet.
- Citar trabajo
- Simone Ceru (Autor), 2003, Suizidalität im Jugendalter, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/21251