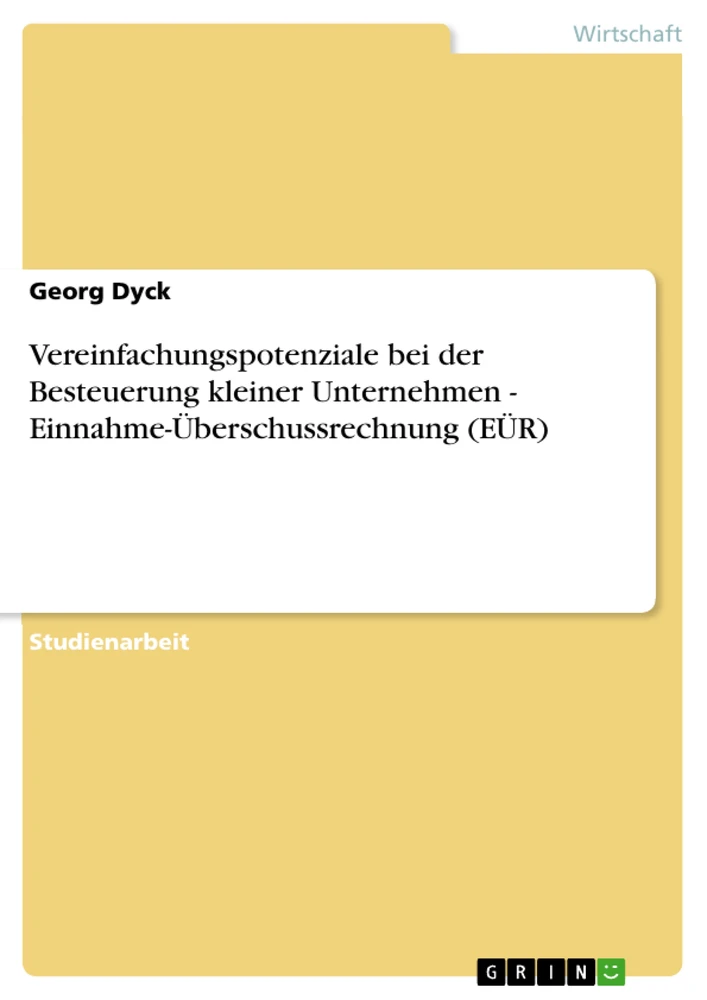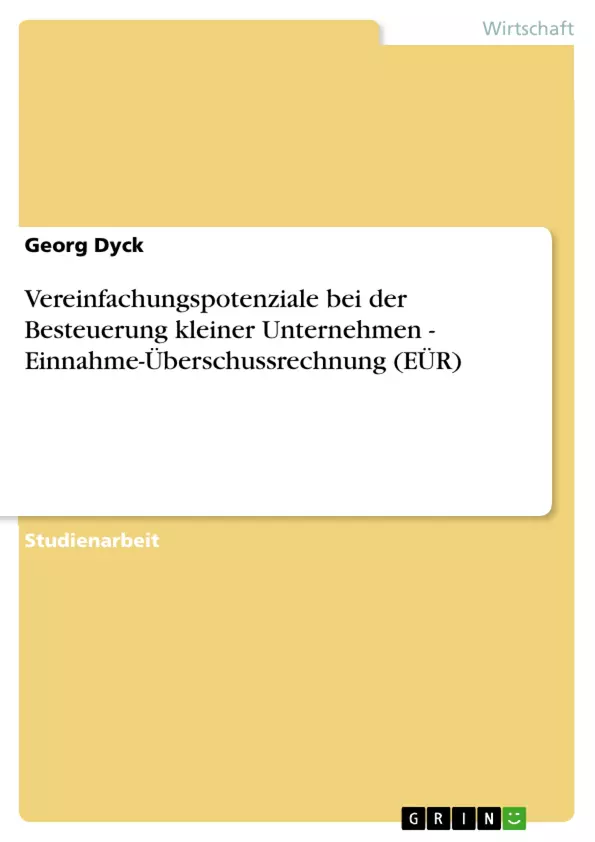In Deutschland gab es im Jahr 2009 rund 3,68 Millionen Unternehmen, davon waren 3,67 Millionen bzw. 99,6 % kleine und mittlere Unternehmen, rund 82 % davon hatten einen Jahresumsatz von weniger als 500.000 Euro. Weitere 4,22 Millionen waren Selbstständige und rund 1,11 Millionen Angehörige der freien Berufe. Insgesamt sind sie alle durch das im Jahre 2003 eingeführte Gesetz zur Förderung von Kleinunternehmern und zur Verbesserung der Unternehmensfinanzierung (Kleinunternehmerförderungsgesetz) direkt oder indirekt betroffen.1
Diese Seminararbeit befasst sich daher mit der Komplexität der Besteuerung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) sowie Angehörige der freien Berufe, insbesondere mit der Einnahme-Überschussrechnung (EÜR) gem. § 4 Abs. 3 EStG und dem mit der Steuererklärung einzureichende Vordruck „Anlage EÜR“. Denn rund 5,36 Millionen Betriebe sind tendenziell von diesem Formular betroffen.
Es soll verdeutlicht werden, dass das im Jahre 2003 eingeführte Kleinunternehmerförderungsgesetz zum Teil sein Ziel, die Steuervereinfachung für KMU, verfehlt. Es wird dargestellt, dass der eigentliche Zweck des neuen Vordrucks nicht vordergründig die Vereinfachung, sondern vielmehr die Ausweitung der Plausibilitätsprüfungs- und Kontrollmöglichkeiten
der Finanzbehörde ist.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Die Einnahme-Überschussrechnung
- Wesen der Einnahme-Überschussrechnung gem. §4 Abs. 3 EStG
- Zur Einnahme-Überschussrechnung berechtigte Personenkreise
- Unterschiede gegenüber dem Bestandsvergleich
- Die Anlage EÜR
- Gesetzesgrundlage zur Abgabepflicht
- Das Risikomanagementsystem der Finanzverwaltung
- Zusätzlich erforderliche Einzelaufzeichnungen
- Mehraufwand durch die Anlage EÜR
- Vorteile aus Sicht von Banken
- Vorteile aus Sicht des Steuerpflichtigen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die Komplexität der Besteuerung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) sowie Angehöriger der freien Berufe, insbesondere im Kontext der Einnahme-Überschussrechnung (EÜR) gem. § 4 Abs. 3 EStG und dem dazugehörigen Formular "Anlage EÜR". Die Arbeit untersucht die Auswirkungen des Kleinunternehmerförderungsgesetzes auf die Steuervereinfachung für KMU und stellt die Frage, ob das Gesetz sein Ziel erreicht hat.
- Die Einnahme-Überschussrechnung (EÜR) und ihre Funktionsweise
- Die Abgrenzung der zur EÜR berechtigten Personenkreise
- Die Auswirkungen der Anlage EÜR auf den Aufwand für Steuerpflichtige
- Der Einfluss der EÜR auf die Steuerkontrolle durch das Finanzamt
- Die Vorteile und Nachteile der Anlage EÜR aus verschiedenen Perspektiven
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung liefert einen Überblick über die Bedeutung des Themas und die Relevanz der Einnahme-Überschussrechnung für KMU.
- Die Einnahme-Überschussrechnung: Dieses Kapitel erläutert das Wesen der Einnahme-Überschussrechnung gem. § 4 Abs. 3 EStG und beschreibt die Personenkreise, die zur Verwendung dieser Berechnungsmethode berechtigt sind. Außerdem werden die Unterschiede zur Vermögensvergleichsmethode gem. § 4 Abs. 1, 5 EStG aufgezeigt.
- Die Anlage EÜR: In diesem Kapitel wird die Anlage EÜR im Detail analysiert. Es werden die rechtlichen Grundlagen, das Risikomanagementsystem der Finanzverwaltung und der zusätzliche Aufwand für den Steuerpflichtigen durch die Anlage EÜR dargestellt. Des Weiteren werden die Vorteile des neuen Vordrucks aus Sicht des Finanzamtes, Banken und des Steuerpflichtigen erläutert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Einnahme-Überschussrechnung (EÜR), die Besteuerung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), das Kleinunternehmerförderungsgesetz, die Anlage EÜR, Steuervereinfachung, Steuerkontrolle und die Finanzverwaltung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Einnahme-Überschussrechnung (EÜR)?
Die EÜR nach § 4 Abs. 3 EStG ist eine vereinfachte Methode zur Gewinnermittlung, bei der lediglich die tatsächlichen Einnahmen den Ausgaben gegenübergestellt werden.
Wer ist zur Erstellung einer EÜR berechtigt?
Berechtigt sind Freiberufler sowie kleine Gewerbetreibende, deren Umsatz und Gewinn bestimmte Schwellenwerte nicht überschreiten.
Welchen Zweck erfüllt der Vordruck "Anlage EÜR"?
Der Vordruck dient der Finanzverwaltung zur Ausweitung der Plausibilitätsprüfungen und als Basis für ein automatisiertes Risikomanagementsystem.
Führt die Anlage EÜR tatsächlich zur Steuervereinfachung?
Kritiker bemängeln, dass der Mehraufwand durch detaillierte Einzelaufzeichnungen das ursprüngliche Ziel der Vereinfachung für Kleinunternehmer zum Teil verfehlt.
Welche Vorteile bietet die Anlage EÜR für Banken?
Durch die standardisierte Form erhalten Banken eine bessere Vergleichbarkeit der Daten, was die Kreditprüfung bei KMU und Freiberuflern erleichtert.
- Citation du texte
- Georg Dyck (Auteur), 2010, Vereinfachungspotenziale bei der Besteuerung kleiner Unternehmen - Einnahme-Überschussrechnung (EÜR), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/212567