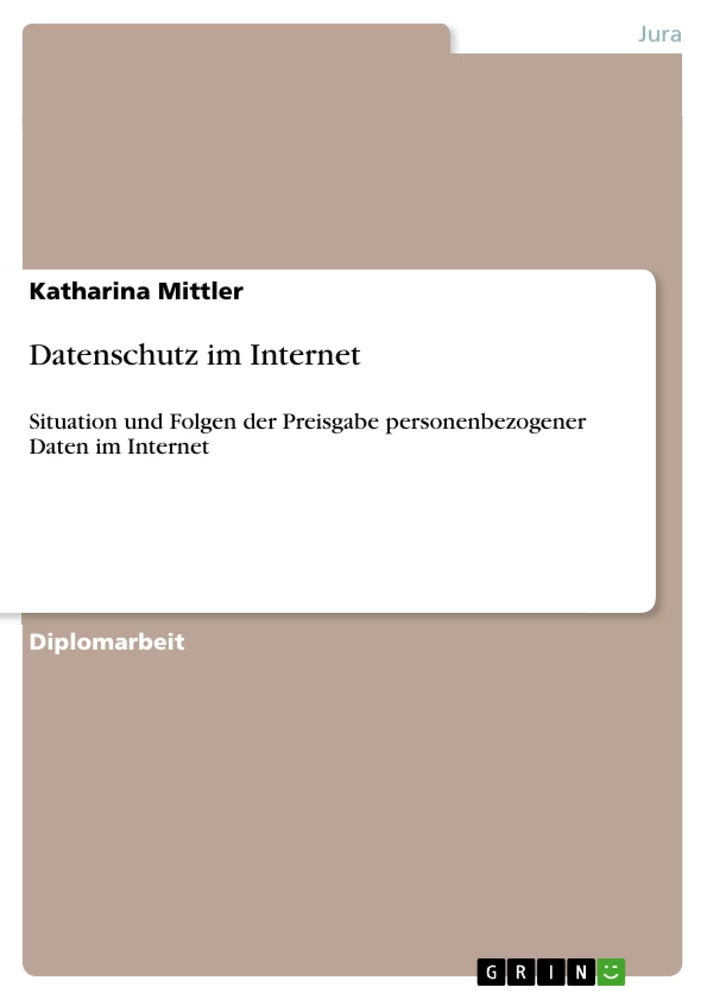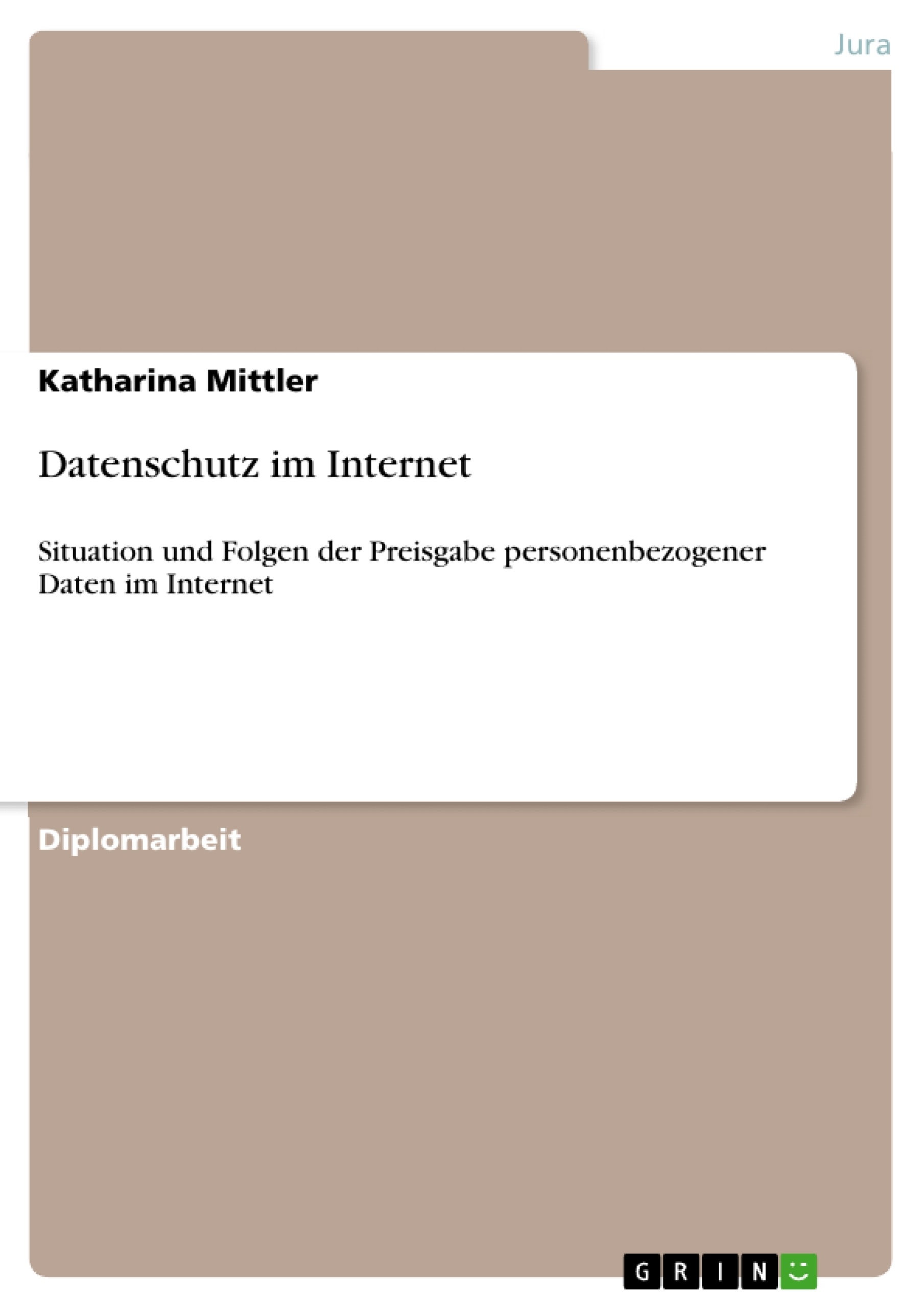Die Wahrung eines privaten Bereichs wird in einer Gesellschaft, in der die Menschen immer weniger Freiräume haben, zunehmend wichtiger. Durch die Tatsache, dass die eigene Privatsphäre immer kleiner wird, wird sie auch immer wertvoller.
Im Internet ist ein privater Bereich für viele Nutzer selbstverständlich. Er wird vorausgesetzt, da sich der Nutzer nicht aktiv identifiziert, um diesen Dienst zu nutzen. Dass eine Anonymität aber tatsächlich nicht gegeben ist und ein Viel-faches der vom Nutzer wahrgenommenen Daten gespeichert wird, ist vielen nicht bekannt.
Ziel dieser Arbeit ist es darzustellen, wie die augenblickliche Situation des Nutzers in Deutschland im Internet in Bezug auf seine informationelle Freiheit ist und welche Folgen die Preisgabe seiner personenbezogenen Daten für ihn haben kann. Weiter soll dargestellt werden, welche Regelungen bereits bestehen, wo sich Lücken in den Gesetzen befinden, und wie der Nutzer diese durch Eigenverantwortung bei der Internetnutzung schließen kann.
So wird im ersten Teil der Arbeit die gesellschaftliche Lage und die Bedeutung eines privaten Bereichs für den Einzelnen verdeutlicht. Der zweite Teil stellt das Internet als Kommunikationsraum dar und hebt die Besonderheiten der Kommunikation in diesem Medium hervor. Im dritten Teil wird die Art und Erstellung von Datensammlungen im und durch das Internet beschrieben, um klar-zustellen, wie die verschiedenen Anbieter an die Nutzerdaten gelangen und wie sie diese nach der Erhebung verwenden. Nach einer Beschreibung der gesetzlichen Lage im vierten Teil wird darauf eingegangen, welche Folgen eine Reduzierung des Datenschutzes im Internet für den Nutzer mit sich bringt. Der fünfte Abschnitt der Arbeit umschreibt somit die tatsächliche Gefährdung des Einzelnen. Im sechsten Abschnitt werden dann Möglichkeiten zur Verbesserung des Datenschutzes aufgezeigt.
Abschließend soll ein Ausblick gegeben werden, wie sich das Internet und mit ihm der Datenschutz voraussichtlich entwickeln werden.
Inhaltsverzeichnis
- TEIL 1: DIE GESELLSCHAFTLICHE AUSGANGSLAGE
- DIE PRIVATSPHÄRE ALS WERT IN DER DEMOKRATISCHEN GESELLSCHAFT
- DEFINITION PRIVATSPHÄRE
- GESCHICHTE DER PRIVATSPHÄRE
- FOLGEN DER INDIVIDUALISIERUNG
- Störung des sozialen Gleichgewichts
- Zunehmende Orientierungslosigkeit
- Ständige Weiterentwicklung des Einzelnen
- Folgen für die Gesellschaft
- PSYCHOLOGIE UND PRIVATSPHÄRE
- SOZIOLOGIE UND PRIVATSPHÄRE
- Die Abgrenzung eines privaten Bereichs
- Die bewusste und unbewusste Beobachtung durch Dritte
- Anonymität in der demokratischen Gesellschaft
- DATENSAMMLUNG DURCH PRIVATE ORGANISATIONEN
- NUTZUNG DER DATEN DURCH DIE UNTERNEHMEN
- Fehlende Kontrolle des Kunden über die Nutzung seiner Daten
- DATA MINING UND DATA WAREHOUSING
- Gefahren durch Data Mining und Data Warehousing
- DATENSAMMLUNGEN DURCH DATA BROKING
- DATENSCHUTZGEFÄHRDUNGEN BEIM E-COMMERCE
- Nutzung von Kundenprofilen im E-Commerce
- TEIL 2: DAS INTERNET ALS KOMMUNIKATIONSRAUM
- DER AUFBAU DES INTERNETS
- DIE ORGANISATION DES INTERNETS
- SCHWACHSTELLEN DES INTERNETS
- KOMMUNIKATIONSINSTANZEN BEIM ZUGRIFF AUF DAS INTERNET
- E-COMMERCE IM INTERNET
- DEFINITION E-COMMERCE
- MARKENTWICKLUNG SEIT 1999
- MARKTSITUATION
- DIE E-MAIL ALS TELEKOMMUNIKATIONSDIENST
- DIE NUTZERSTRUKTUREN DES INTERNETS IN DEUTSCHLAND
- DEMOGRAPHISCHER AUFBAU DER NUTZER
- ONLINEANWENDUNGEN UND AUFGERUFENE INHALTE
- Das Internet als Kommunikationsinstrument
- Das Internet als Informationsquelle
- Onlinebanking
- GRÜNDE FÜR DIE ABLEHNUNG DES INTERNETS
- TEIL 3: DATENSAMMLUNGEN IM INTERNET
- VERÄNDERUNG DER DATENSAMMLUNGEN DURCH DAS INTERNET
- PARADIGMENWECHSEL IN DER DATENVERARBEITUNG
- WACHSEN DER DATENMENGEN
- ENTSTEHUNG VON DATENSAMMLUNGEN DURCH DAS INTERNET
- DATENSAMMLUNGEN BEIM ZUGRIFF AUF DAS INTERNET
- Datensammlungen auf Internetservern
- Datensammlungen durch Suchmaschinen
- Datensammlung beim Client
- BILDUNG UND VERWENDUNG VON NUTZERPROFILEN
- Definition Nutzerprofil
- Gründe für Nutzerprofile
- Erstellung von Nutzerprofilen
- MÖGLICHKEITEN DES PERSONENBEZUGS IM INTERNET
- SERVICE PROVIDER
- IP-ADRESSEN
- IP Nummern und Referer
- LOG FILES
- COOKIES
- Erscheinungsformen
- Arbeitsweise von Cookies
- Vorteile und Nachteile für den Nutzer
- Cookies und Privatsphäre
- SESSION IDS
- WEB BUGS
- Arbeitsweise von Web Bugs
- Web Bugs und Privatsphäre
- GLOBAL UNIQUE IDENTIFIERS
- TEIL 4: DIE GESETZLICHE REGELUNG DES DATENSCHUTZES IM INTERNET
- ANSATZ DES PERSÖNLICHKEITSRECHTS IM INTERNET
- DIE GESCHICHTE DES DATENSCHUTZES IN DEUTSCHLAND
- ÜBERBLICK ÜBER DIE DATENSCHUTZREGELUNGEN
- ARTIKEL 2 DES GRUNDGESETZES
- Das Volkszählungsurteil
- FERNMELDEGEHEIMNIS ART. 10 GG
- BEREICHE DER EINZELNEN DATENSCHUTZGESETZE
- DIE EK-DRL
- Datenschutzgerechte Ausgestaltung von Cookies
- DAS BUNDESDATENSCHUTZGESETZ
- Datenvermeidung und Datensparsamkeit §3a BDSG
- Definition von Cookies §3 Abs. 1 BDSG
- Pseudonyme §3Abs. 6a BDSG
- Grundsatz der Direkterhebung §4 Abs. 2 und 3 BDSG
- Anspruch auf Auskunft § 6 Abs. 3 BDSG
- Schadensersatzregelungen §7 BDSG
- Sicherung personenbezogener Daten §9 BDSG
- Widerspruchsrecht §28 BDSG
- Das Recht auf Benachrichtigung §33 BDSG
- Das Recht auf Auskunft §34 BDSG
- Das Recht auf Benachrichtigung, Löschung und Sperrung § 35 BDSG
- DAS GESETZ FÜR TELEKOMMUNIKATION
- Schutzpflicht § 89 TKG
- Informationspflicht § 91, 93 TKG
- Schutz des Fernmeldegeheimnisses §107 TKG
- DAS TELEDIENSTEGESETZ
- Zumutbarkeitsklausel §5 Abs. 2 TDG
- DAS TELEDIENSTE DATENSCHUTZGESETZ
- Zweckbindungsgrundsatz §3 Abs. 2 TDDSG
- Kopplungsverbot §3 Abs. 4 TDDSG
- Löschung von Nutzungsdaten §4 TDDSG
- Informationspflicht §4 Abs. 1 TDDSG
- Einwilligung in die Nutzung §4 Abs. 2 TDDSG
- Einwilligungsklauseln in AGBs
- Widerrufsrecht §4 Abs. 3 TDDSG
- Zweckbindung §4 Abs. 4 TDDSG
- Recht auf Anonymität §4 Abs. 6 TDDSG
- Widerspruchsrecht §6 Abs. 3 TDDSG
- TELEKOMMUNIKATIONS-DATENSCHUTZVERORDNUNG
- TEIL 5: DIE GEFÄHRDUNG DER PRIVATSPHÄRE IM INTERNET
- GEFAHRENBEWUSSTSEIN DER NUTZER
- DAS VERHALTEN DER NUTZER IM INTERNET
- Das Sicherheitsbewusstsein des Nutzers
- Die Angst der Nutzer vor dem Missbrauch ihrer Daten
- Der Umgang der Nutzer mit Cookies
- GRÜNDE FÜR DIE AUFGABE DER PRIVATSPHÄRE IM INTERNET
- Komplexität des Themas IT
- Bedienerfreundlichkeit der Programme
- Das „Paranoia Problem“
- Die betroffenen Bevölkerungsschichten
- Fehlende Wahrnehmung der Datensammlungen
- Gewöhnung an die Beeinträchtigung der Privatsphäre
- NOTWENDIGKEIT EINER REGELUNG DES DATENSCHUTZES IM INTERNET
- FEHLENDE ANONYMITÄT BEI DER NUTZUNG DES INTERNETS
- MANGELNDE SELBSTBESTIMMUNG DES NUTZERS ÜBER SEINE DATEN
- GEFAHREN DURCH DIE BILDUNG VON NUTZERPROFILEN
- Profilbildung durch Kreditorganisationen
- Missbrauch der Daten und Diskriminierung Einzelner
- Kommerzialisierung des Datenmarkts
- GEFAHREN DURCH DIE GESETZLICHEN REGELUNGEN
- Missachtung von Datenvermeidung und Datensparsamkeit (§3a BDSG)
- Folgen von Outing (§4 Abs. 1 TDDSG)
- Informationspflichten des Diensteanbieters
- Unberechtigte Weitergabe der IP-Adresse durch den ISP
- MÖGLICHE FOLGEN DER OPT-OUT LÖSUNG
- FOLGEN SCHLECHT GEPFLEGTER DATENBANKEN
- TEIL 6: MÖGLICHKEITEN ZUR VERBESSERUNG DES DATENSCHUTZES IM INTERNET
- TECHNISCHE MÖGLICHKEITEN
- KONSTRUKTION DATENSCHUTZGERECHTER SOFTWARE
- ANONYMISIERUNG UND PSEUDONYMISIERUNG
- BEISPIELE FÜR TECHNISCHEN DATENSCHUTZ IM INTERNET
- AN.ON
- P3P
- Privacy Bird
- Ad Aware
- GESETZLICHE MÖGLICHKEITEN
- KLARSTELLUNG DER GESETZLICHEN REGELUNGEN
- Nutzerprofile nach §6 Abs. 3 TDDSG
- Unklare Formulierung des §3a BDSG
- Länge der Speicherdauer von personenbezogenen Daten
- SANKTIONSMITTEL
- Ordnungswidrigkeiten
- Straftaten
- Anspruch auf Schadensersatz oder Schmerzensgeld
- Anspruch auf Unterlassung
- DATENSCHUTZ AUDITS UND GÜTESIEGEL
- Datenschutzaudits
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen des Datenschutzes im Internet. Sie analysiert die gesellschaftlichen und soziologischen Aspekte der Privatsphäre, die Datensammlungspraktiken privater Organisationen und im Internet, sowie die gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz. Ziel ist es, ein umfassendes Bild der Gefährdung der Privatsphäre im Internet zu zeichnen und Möglichkeiten zur Verbesserung des Datenschutzes aufzuzeigen.
- Die Privatsphäre als gesellschaftlicher Wert und ihre Entwicklung
- Datensammlungspraktiken im E-Commerce und durch private Organisationen
- Die Rolle des Internets bei der Datensammlung und -verarbeitung
- Der rechtliche Rahmen des Datenschutzes im Internet (inkl. BDSG, TKG, TDG)
- Möglichkeiten zur Verbesserung des Datenschutzes (technisch und rechtlich)
Zusammenfassung der Kapitel
TEIL 1: DIE GESELLSCHAFTLICHE AUSGANGSLAGE: Dieser Teil legt die Grundlagen der Arbeit, indem er den Wert der Privatsphäre in der demokratischen Gesellschaft definiert und deren geschichtliche Entwicklung sowie die Folgen der Individualisierung auf die Privatsphäre beleuchtet. Er untersucht psychologische und soziologische Perspektiven auf die Privatsphäre und beleuchtet die Datensammlungspraktiken privater Organisationen, einschließlich der Risiken durch Data Mining, Data Warehousing und Data Broking, sowie die Datenschutzgefährdungen im E-Commerce.
TEIL 2: DAS INTERNET ALS KOMMUNIKATIONSRAUM: Dieser Teil beschreibt den Aufbau und die Schwachstellen des Internets als Kommunikationsraum, untersucht den E-Commerce und die E-Mail als Telekommunikationsdienste. Er analysiert die Nutzerstrukturen des Internets in Deutschland, deren Online-Anwendungen und die Gründe für die Ablehnung des Internets durch bestimmte Bevölkerungsgruppen.
TEIL 3: DATENSAMMLUNGEN IM INTERNET: Hier wird die Veränderung der Datensammlung durch das Internet analysiert, einschließlich des Paradigmenwechsels in der Datenverarbeitung und des Wachstums der Datenmengen. Es werden verschiedene Methoden der Datensammlung im Internet (Internetserver, Suchmaschinen, Client-seitig) detailliert beschrieben, sowie die Bildung und Verwendung von Nutzerprofilen. Der Teil erläutert verschiedene Möglichkeiten des Personenbezugs im Internet (Service Provider, IP-Adressen, Log Files, Cookies, Session IDs, Web Bugs, Global Unique Identifiers).
TEIL 4: DIE GESETZLICHE REGELUNG DES DATENSCHUTZES IM INTERNET: Dieser Teil befasst sich mit dem rechtlichen Rahmen des Datenschutzes im Internet. Er beleuchtet den Ansatz des Persönlichkeitsrechts im Internet, die Geschichte des Datenschutzes in Deutschland und gibt einen Überblick über die relevanten Datenschutzregelungen (Artikel 2 des Grundgesetzes, Fernmeldegeheimnis, EK-DRL, BDSG, TKG, TDG, Telekommunikations-Datenschutzverordnung). Die einzelnen Gesetze und ihre Bestimmungen werden im Detail erläutert.
TEIL 5: DIE GEFÄHRDUNG DER PRIVATSPHÄRE IM INTERNET: Dieser Teil untersucht das Gefahrenbewusstsein der Nutzer im Internet, ihr Verhalten und die Gründe für die Aufgabe ihrer Privatsphäre. Er analysiert die Notwendigkeit einer Regelung des Datenschutzes im Internet, unter Berücksichtigung der fehlenden Anonymität, der mangelnden Selbstbestimmung über die eigenen Daten und der Gefahren durch die Bildung von Nutzerprofilen. Die Gefahren durch ungenügende gesetzliche Regelungen werden ebenso diskutiert.
TEIL 6: MÖGLICHKEITEN ZUR VERBESSERUNG DES DATENSCHUTZES IM INTERNET: Dieser Teil präsentiert technische und rechtliche Möglichkeiten zur Verbesserung des Datenschutzes im Internet. Technische Möglichkeiten beinhalten die Konstruktion datenschutzgerechter Software, Anonymisierung und Pseudonymisierung sowie Beispiele für technischen Datenschutz (AN.ON, P3P, Privacy Bird, Ad Aware). Rechtliche Möglichkeiten umfassen die Klarstellung gesetzlicher Regelungen, Sanktionsmittel (Ordnungswidrigkeiten, Straftaten, Schadensersatz) und Datenschutzaudits.
Schlüsselwörter
Privatsphäre, Datenschutz, Internet, Datensammlung, Nutzerprofile, E-Commerce, BDSG, TKG, TDG, Data Mining, Data Warehousing, Anonymität, Gesetzliche Regulierung, Technische Lösungen, Individualisierung, Online-Kommunikation, Gefahrenbewusstsein.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema "Datenschutz im Internet"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht umfassend die Herausforderungen des Datenschutzes im Internet. Sie analysiert die gesellschaftlichen und soziologischen Aspekte der Privatsphäre, die Datensammlungspraktiken privater Organisationen und im Internet, sowie die gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz. Ziel ist es, die Gefährdung der Privatsphäre im Internet darzustellen und Verbesserungsvorschläge aufzuzeigen.
Welche Themen werden in den einzelnen Teilen behandelt?
Teil 1: Gesellschaftliche Ausgangslage legt die Grundlagen, definiert den Wert der Privatsphäre, beleuchtet deren historische Entwicklung und die Folgen der Individualisierung. Datensammlungspraktiken privater Organisationen (Data Mining, Data Warehousing, Data Broking) und die Risiken im E-Commerce werden untersucht. Teil 2: Das Internet als Kommunikationsraum beschreibt Aufbau und Schwachstellen des Internets, analysiert E-Commerce, E-Mail und die Nutzerstrukturen in Deutschland. Teil 3: Datensammlungen im Internet analysiert die Veränderungen der Datensammlung durch das Internet, beschreibt verschiedene Methoden (Internetserver, Suchmaschinen, Client-seitig) und die Bildung von Nutzerprofilen. Teil 4: Gesetzliche Regelung des Datenschutzes im Internet behandelt den rechtlichen Rahmen (Art. 2 GG, Fernmeldegeheimnis, EK-DRL, BDSG, TKG, TDG, Telekommunikations-Datenschutzverordnung) detailliert. Teil 5: Gefährdung der Privatsphäre im Internet untersucht das Gefahrenbewusstsein der Nutzer, ihre Verhaltensweisen und die Notwendigkeit einer Regelung des Datenschutzes. Teil 6: Möglichkeiten zur Verbesserung des Datenschutzes im Internet präsentiert technische (datenschutzgerechte Software, Anonymisierung) und rechtliche Möglichkeiten (Klarstellung gesetzlicher Regelungen, Sanktionen, Datenschutzaudits).
Welche gesetzlichen Regelungen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt ausführlich das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), das Telekommunikationsgesetz (TKG), das Teledienstegesetz (TDG) und die Telekommunikations-Datenschutzverordnung. Es werden einzelne Artikel und Paragraphen dieser Gesetze erläutert, um deren Relevanz für den Datenschutz im Internet zu verdeutlichen. Zusätzlich wird der Artikel 2 des Grundgesetzes und das Fernmeldegeheimnis (Art. 10 GG) im Kontext des Datenschutzes betrachtet.
Welche technischen Möglichkeiten zur Verbesserung des Datenschutzes werden genannt?
Die Arbeit nennt die Konstruktion datenschutzgerechter Software, Anonymisierung und Pseudonymisierung als technische Maßnahmen. Konkrete Beispiele für technischen Datenschutz sind AN.ON, P3P, Privacy Bird und Ad Aware.
Welche Gefahren für die Privatsphäre im Internet werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt die Gefahren durch fehlende Anonymität, mangelnde Selbstbestimmung über die eigenen Daten, die Bildung von Nutzerprofilen (mit Missbrauchspotential und Diskriminierung), und ungenügende gesetzliche Regelungen (z.B. Missachtung von Datenvermeidung und -sparsamkeit). Weiterhin werden die Folgen schlecht gepflegter Datenbanken und die Problematik der Opt-Out-Lösung diskutiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt dieser Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Privatsphäre, Datenschutz, Internet, Datensammlung, Nutzerprofile, E-Commerce, BDSG, TKG, TDG, Data Mining, Data Warehousing, Anonymität, Gesetzliche Regulierung, Technische Lösungen, Individualisierung, Online-Kommunikation, Gefahrenbewusstsein.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den einzelnen Gesetzen und Paragraphen?
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Gesetzen und Paragraphen (BDSG, TKG, TDG etc.) sind in Teil 4 der Arbeit zu finden. Dieser Teil bietet einen Überblick über die relevanten Datenschutzregelungen und erläutert die einzelnen Gesetze und ihre Bestimmungen im Detail.
- Citation du texte
- Katharina Mittler (Auteur), 2005, Datenschutz im Internet, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/212688