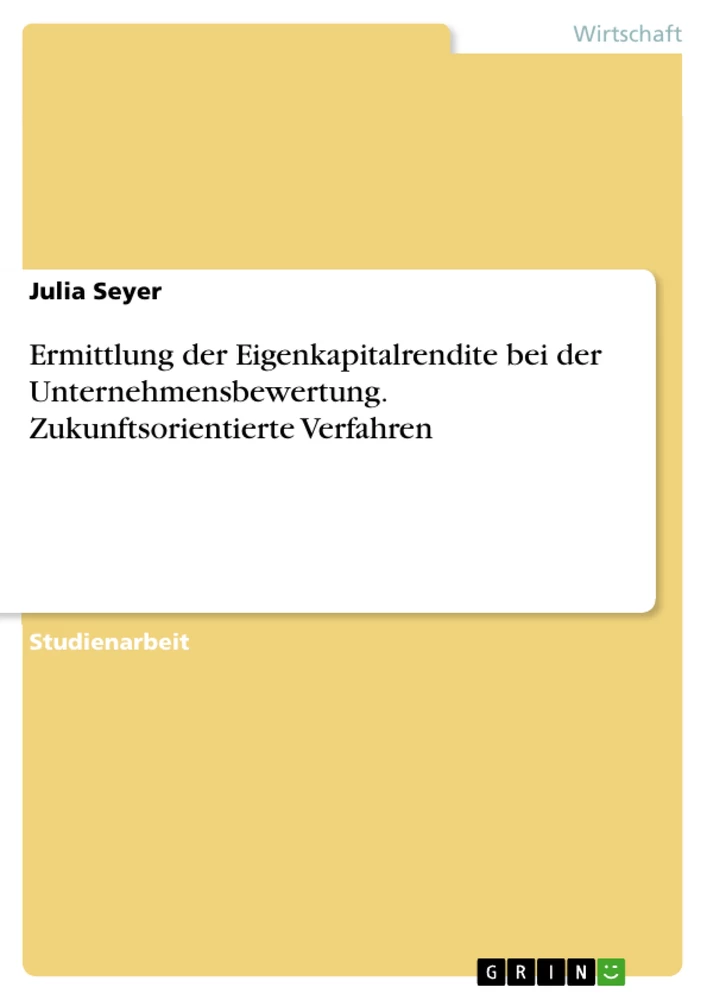Die Verwendung eines geeigneten Diskontierungssatzes zur Berechnung des Barwertes zukünftiger Zahlungsüberschüsse spielt für die Unternehmensbewertung eine entscheidende Rolle. Der Diskontierungssatz soll die Renditeforderungen des Kapitalmarkts für eine vergleichbare Anlagealternative widerspiegeln. Der am weitesten verbreitete Ansatz zur Ermittlung dieser Renditeerwartungen ist das Capital Asset Pricing Model (CAPM). Die Berechnung erfolgt im Gegensatz zu der zukunftsorientierten Ermittlung der Zahlungsüberschüsse auf Basis historischer Kapitalmarktdaten.
Diese Konzeption wird in der Literatur vielfältig kritisiert. Als Alternative
bieten sich zukunftsorientierte Verfahren an, die unter den Implied Cost of Capital bekannt geworden sind.
In der vorliegen Arbeit werden ausgewählte zukunftsorientierte Verfahren zur Schätzung der Eigenkapitalrendite dargestellt und analysiert. Im Anschluss an die Darlegung der Grundlagen dieser Methoden in Kapitel 2 werden in Kapitel 3 (zahlungsorientierte Verfahren) und Kapitel 4 (Residualgewinnmodelle) ausgewählte Schätzverfahren erläutert. Insbesondere wird die Vorgehensweise dieser Modelle aufgezeigt. Ziel der Analyse ist die Untersuchung der Relevanz der Modelle für die Unternehmensbewertung und die Begründung, warum die Verfahren in der Praxis trotz mehrfacher Empfehlungen kaum eine Rolle spielen (Kapitel 5). In Kapitel 6 erfolgt eine thesenförmige Zusammenfassung der Ergebnisse.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Konzeptionelle Grundlagen zukunftsorientierter Schätzverfahren
- 3. Zahlungsorientierte Bewertungsmodelle
- 3.1. Klassisches Dividendendiskontierungsmodell
- 3.2. Wachstumsmodell nach GORDON/SHAPIRO
- 3.3. Finite Horizon Expected Return Model
- 4. Residualgewinnmodelle
- 4.1. Ursprung des Residualgewinnmodells
- 4.2. Grundmodell
- 4.3. Zwei-Phasen-Modell nach CLAUS/THOMAS
- 4.4. Drei-Phasemodell nach GEBHARDT/LEE/SWAMINATHAN
- 5. Praxisrelevanz der Implied Cost of Capital
- 6. Thesenförmige Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Anwendung zukunftsorientierter Verfahren zur Ermittlung der Eigenkapitalrendite bei der Unternehmensbewertung. Ziel ist es, verschiedene Modelle und Methoden zu analysieren und ihre Praxistauglichkeit zu beurteilen.
- Zukunftsorientierte Schätzverfahren zur Eigenkapitalrendite
- Zahlungsorientierte Bewertungsmodelle (z.B. Dividendendiskontierungsmodell)
- Residualgewinnmodelle (verschiedene Varianten)
- Praxisrelevanz der ermittelten Eigenkapitalkosten
- Zusammenfassende Thesen zur Unternehmensbewertung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel dient als Einführung in die Thematik der Unternehmensbewertung und der Ermittlung der Eigenkapitalrendite mithilfe zukunftsorientierter Verfahren. Es skizziert die Problemstellung und die Relevanz des Themas für die Praxis.
2. Konzeptionelle Grundlagen zukunftsorientierter Schätzverfahren: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Anwendung zukunftsorientierter Schätzverfahren bei der Unternehmensbewertung dar. Es beschreibt die verschiedenen Ansätze und deren konzeptionelle Unterschiede, um ein fundiertes Verständnis für die nachfolgenden Kapitel zu schaffen. Die Bedeutung der Prognosegenauigkeit und der zugrundeliegenden Annahmen wird hier herausgestellt.
3. Zahlungsorientierte Bewertungsmodelle: Dieses Kapitel analysiert verschiedene zahlungsorientierte Bewertungsmodelle, darunter das klassische Dividendendiskontierungsmodell, das Wachstumsmodell nach Gordon/Shapiro und das Finite Horizon Expected Return Model. Es vergleicht die Vor- und Nachteile der einzelnen Modelle und zeigt, wie sie in der Praxis angewendet werden können. Die Diskussion konzentriert sich auf die jeweiligen Annahmen, die Sensitivität gegenüber den Eingangsparametern und die praktische Umsetzung.
4. Residualgewinnmodelle: Das Kapitel widmet sich den Residualgewinnmodellen als alternative Bewertungsmethoden. Es beginnt mit den Ursprüngen des Residualgewinnmodells und erklärt dann das Grundmodell, das Zwei-Phasen-Modell nach Claus/Thomas und das Drei-Phasemodell nach Gebhardt/Lee/Swaminathan. Der Fokus liegt auf den Unterschieden in den Modellierungsansätzen und deren Auswirkungen auf die Bewertungsergebnisse. Die unterschiedlichen Prognosehorizonte und die Behandlung von Wachstumsraten werden detailliert erläutert.
5. Praxisrelevanz der Implied Cost of Capital: In diesem Kapitel wird die praktische Relevanz der ermittelten Eigenkapitalkosten im Kontext der Unternehmensbewertung untersucht. Es werden die Herausforderungen bei der Schätzung der Eigenkapitalkosten und deren Auswirkungen auf die Bewertungsergebnisse diskutiert. Der Schwerpunkt liegt auf der Interpretation und Anwendung der Ergebnisse in realen Bewertungssituationen.
Schlüsselwörter
Unternehmensbewertung, Eigenkapitalrendite, Zukunftsorientierte Verfahren, Zahlungsorientierte Modelle, Dividendendiskontierung, Residualgewinnmodelle, Gordon/Shapiro, Claus/Thomas, Gebhardt/Lee/Swaminathan, Implied Cost of Capital, Prognose, Wachstum.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Unternehmensbewertung mit zukunftsorientierten Verfahren
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der Anwendung zukunftsorientierter Verfahren zur Ermittlung der Eigenkapitalrendite bei der Unternehmensbewertung. Ziel ist die Analyse verschiedener Modelle und Methoden und die Beurteilung ihrer Praxistauglichkeit.
Welche Modelle werden behandelt?
Die Arbeit behandelt sowohl zahlungsorientierte Bewertungsmodelle (wie das klassische Dividendendiskontierungsmodell, das Wachstumsmodell nach Gordon/Shapiro und das Finite Horizon Expected Return Model) als auch Residualgewinnmodelle (inkl. Grundmodell, Zwei-Phasen-Modell nach Claus/Thomas und Drei-Phasemodell nach Gebhardt/Lee/Swaminathan).
Was sind die zentralen Themenschwerpunkte?
Die zentralen Themen sind zukunftsorientierte Schätzverfahren zur Eigenkapitalrendite, zahlungsorientierte und Residualgewinnmodelle, die Praxisrelevanz der ermittelten Eigenkapitalkosten und eine zusammenfassende Darstellung der Thesen zur Unternehmensbewertung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Einleitung, konzeptionelle Grundlagen zukunftsorientierter Schätzverfahren, zahlungsorientierte Bewertungsmodelle, Residualgewinnmodelle, die Praxisrelevanz der Implied Cost of Capital und eine thesenförmige Zusammenfassung. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der jeweiligen Methoden und Modelle.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es darin?
Kapitel 1 (Einleitung): Einführung in die Thematik und Relevanz der Unternehmensbewertung. Kapitel 2 (Konzeptionelle Grundlagen): Theoretische Grundlagen zukunftsorientierter Schätzverfahren und deren konzeptionelle Unterschiede. Kapitel 3 (Zahlungsorientierte Modelle): Analyse verschiedener zahlungsorientierter Modelle, Vergleich ihrer Vor- und Nachteile und praktische Anwendung. Kapitel 4 (Residualgewinnmodelle): Detaillierte Erklärung verschiedener Residualgewinnmodelle und deren Unterschiede in den Modellierungsansätzen. Kapitel 5 (Praxisrelevanz der Implied Cost of Capital): Untersuchung der praktischen Relevanz der ermittelten Eigenkapitalkosten und Herausforderungen bei deren Schätzung. Kapitel 6 (Thesenförmige Zusammenfassung): Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse und Thesen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Unternehmensbewertung, Eigenkapitalrendite, Zukunftsorientierte Verfahren, Zahlungsorientierte Modelle, Dividendendiskontierung, Residualgewinnmodelle, Gordon/Shapiro, Claus/Thomas, Gebhardt/Lee/Swaminathan, Implied Cost of Capital, Prognose, Wachstum.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit richtet sich an alle, die sich mit der Unternehmensbewertung und der Ermittlung der Eigenkapitalrendite beschäftigen, insbesondere Wissenschaftler, Studenten und Praktiker im Finanzbereich.
- Arbeit zitieren
- Julia Seyer (Autor:in), 2011, Ermittlung der Eigenkapitalrendite bei der Unternehmensbewertung. Zukunftsorientierte Verfahren, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/212716